Katharina Ernst
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
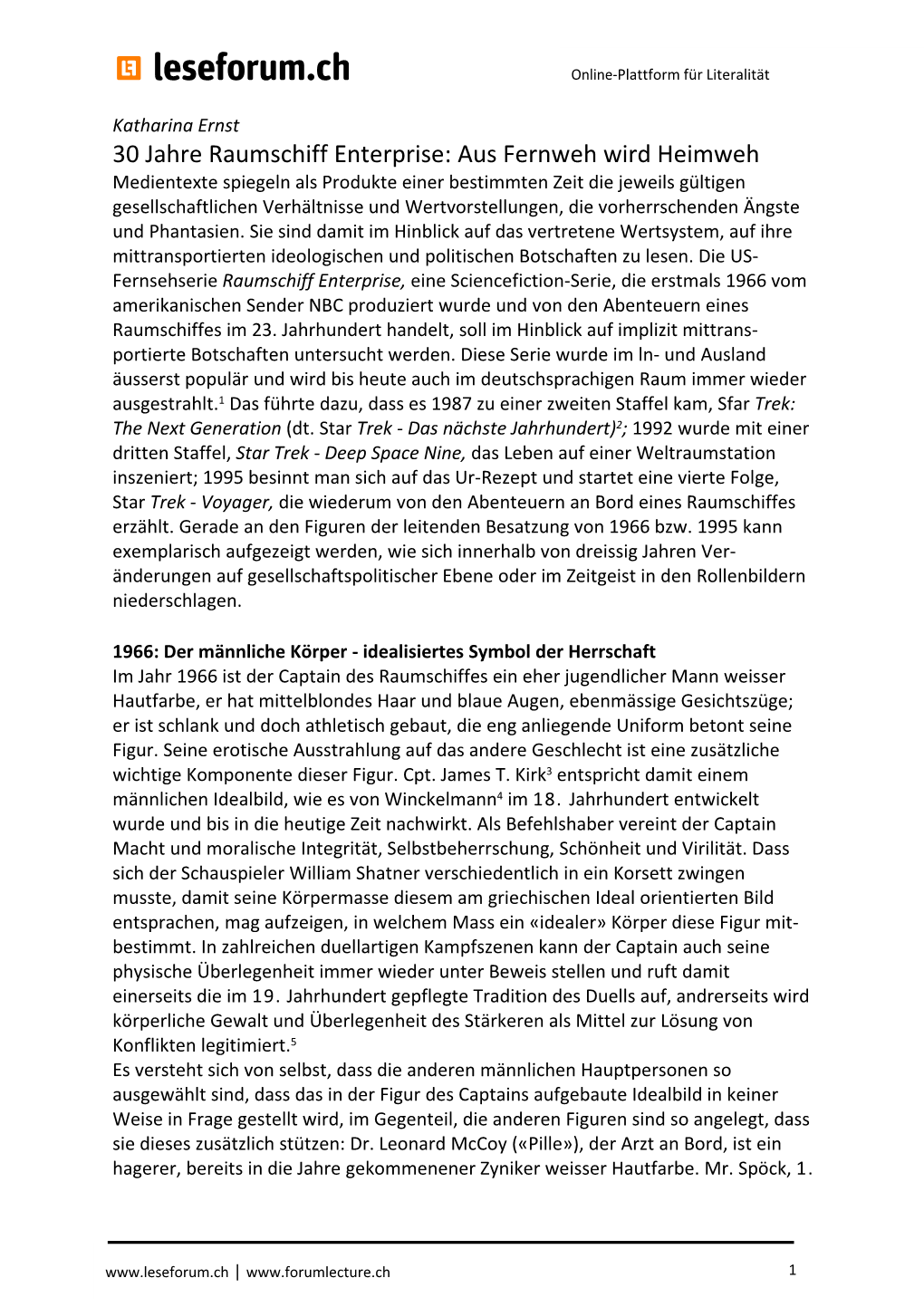
Load more
Recommended publications
-

Bachelorarbeit Saskia Sperfeld
BACHELORARBEIT Frau Saskia Sperfeld Die Entwicklung des Star Trek Franchises am Beispiel der Filme „Star Trek II: Der Zorn des Khan“ (1982) und „Star Trek Into Darkness“ (2013) 2018 Fakultät: Medien BACHELORARBEIT Die Entwicklung des Star Trek Franchises am Beispiel der Filme „Star Trek II: Der Zorn des Khan“ (1982) und „Star Trek Into Darkness“ (2013) Autorin: Frau Saskia Sperfeld Studiengang: Film und Fernsehen Seminargruppe: FF15sR1-B Erstprüfer: Prof. Peter Gottschalk Zweitprüfer: Christian Maintz, M.A. Einreichung: Braunschweig, 24.05.2018 Faculty of Media BACHELOR THESIS Developments in the Star Trek franchise as seen in “Star Trek II: The Wrath of Khan” (1982) and “Star Trek Into Darkness” (2013) author: Ms. Saskia Sperfeld course of studies: Film and Television seminar group: FF15sR1-B first examiner: Prof. Peter Gottschalk second examiner: Christian Maintz, M.A. submission: Braunschweig, 24.05.2018 Bibliografische Angaben Nachname, Vorname: Sperfeld, Saskia Die Entwicklung des Star Trek Franchises am Beispiel der Filme „Star Trek II: Der Zorn des Khan“ (1982) und „Star Trek Into Darkness“ (2013) Developments in the Star Trek franchise as seen in “Star Trek II: The Wrath of Khan” (1982) and “Star Trek Into Darkness” (2013) 53 Seiten, Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences, Fakultät Medien, Bachelorarbeit, 2018 Thema der vorliegenden Arbeit sind die Filme Star Trek II: The Wrath of Khan von 1982 und Star Trek Into Darkness von 2013. Es wird aufgezeigt welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede die beiden, in Handlung und Figuren sehr ähnlichen, Filme aufweisen, um zu untersuchen, ob und wie sich das Star Trek Franchise weiterentwickelt hat. Zu diesem Zweck werden zunächst Filmanalysen der beiden Filme nach den Parametern Hand- lung, Erzählstruktur, Figuren und Thematiken und Kontext durchgeführt. -

Q Allmächtig
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Q Allmächtig Gottesvorstellungen des Star Trek-Universums mit dem Untersuchungs- Schwerpunkt der göttlichen Aspekte des Wesens Q aus der Fernseh-Serie „Star Trek: The Next Generation“ Verfasserin Gabriele Rath-Schneider angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, im Mai 2009 Studienkennzahl: A057 011 Studienrichtung: Individuelles Studium Religionswissenschaft Betreuer: Privatdozent Dr. Mag. Hans Gerald Hödl II Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...............................................................................................................................1 1.1. Frage und Aufgabenstellung ............................................................................................................. 1 1.2. Quellenbasis und auswahl................................................................................................................ 2 1.3. Methoden und Aufbau.......................................................................................................................... 3 1.4. Religion im Film...................................................................................................................................... 5 1.4.1. Film und Religion als symbolische Systeme.......................................................................................6 1.4.1.1. Zeichentheorien ..............................................................................................................................................................7 -

«Il Mio Corpo Ti Premierà»
SABATO 26 OTTOBRE 1991 SPETTACOLI PAGINA 21 L'UNITÀ Legge cinema Francesco Laudadio ha presentato La fotomodella Monica Bellucci La Malfa il suo nuovo film «La riffa» nei panni della protagonista: rilancia La storia di una bellissima vedova «Non temo le reazioni femministe il «garante» che sceglie di mettersi all'asta faccio un personaggio vincente» BB ROMA. Un «garante» della WIM MERTENS INAUGURA «NEW AGE AMBIENT». cinematografia, incentivi alla Questa sera al Palazzo delle Esposizioni di Roma il musi produzione, «snellimento» del cista 'minimale» belga Wim Mertens apre la rassegna di gruppo cinematografico pub concerti New Age Ainbient, affiancala alla mostra m cor blico, e potenziamento delle so degli artisti Inglesi Gilbert & George. Dopo Mertens, sale. Sono le quattro proposte che presenta il suo nuovo disco, la rassegna prosegue che il Partito repubblicano ha con due concerti al giorno, alle 19 gli artisti italiani, alle avanzato ieri, nel corso di una «Il mio corpo ti premierà» 21 quelli stranieri; domani sono di scena Pierluigi Castel lano, Roger Eno e l'I larmoma Ensemble, lunedi il Bala- conferenza stampa, per la nescu Quarte!. Mercoledì 30 ci sono Fabio Lbcraton, nuova legge sul cinema. L'in Hans Joachim Koedelius e Fabio Capanni, si chiude gio contro 0 stato organizzato in Monica Bellucci si mette all'asta. Nei panni di una spaventato la modella, al suo vedì 31 con Arturo Slalleri, Harold Budd e Bill Nelson. vista della discussione, ai primi vedova procace e piena di debiti è la protagonista secondo film dopo il televisivo «ULTIMO TANGO» IN SUDAFRICA. A diciannove anni di novembre, del testo della Vita coi figli di Dino Risi. -

Tea Earl Grey Hot CHI 2021
To appear at CHI 2021 https://doi.org/10.1145/3411764.3445640 Tea, Earl Grey, Hot: Designing Speech Interactions from the Imagined Ideal of Star Trek BENETT AXTELL University of Toronto, TAGlab, Toronto, Canada COSMIN MUNTEANU University of Toronto Mississauga, ICCIT, Mississauga, Canada Speech is now common in daily interactions with our devices, thanks to voice user interfaces (VUIs) like Alexa. Despite their seeming ubiquity, designs often do not match users’ expectations. Science fiction, which is known to influence design of new technologies, has included VUIs for decades. Star Trek: The Next Generation is a prime example of how people envisioned ideal VUIs. Understanding how current VUIs live up to Star Trek’s utopian technologies reveals mismatches between current designs and user expectations, as informed by popular fiction. Combining conversational analysis and VUI user analysis, we study voice interactions with the Enterprise’s computer and compare them to current interactions. Independent of futuristic computing power, we find key design-based differences: Star Trek interactions are brief and functional, not conversational, they are highly multimodal and context-driven, and there is often no spoken computer response. From this, we suggest paths to better align VUIs with user expectations. CCS CONCEPTS • Human-centered computing~Natural language interfaces • Human-centered computing~User interface design Additional Keywords and Phrases: Voice user interfaces, Speech interaction design, Conversational analysis, Star Trek ACM Reference Format: First Author’s Name, Initials, and Last Name, Second Author’s Name, Initials, and Last Name, and Third Author’s Name, Initials, and Last Name. 2018. The Title of the Paper: ACM Conference Proceedings Manuscript Submission Template: This is the subtitle of the paper, this document both explains and embodies the submission format for authors using Word. -

''Star Trek: the Original Series'': Season 3
''Star Trek: The Original Series'': Season 3 PDF generated using the open source mwlib toolkit. See http://code.pediapress.com/ for more information. PDF generated at: Thu, 13 Mar 2014 18:19:48 UTC Contents Articles Season Overview 1 Star Trek: The Original Series (season 3) 1 1968–69 Episodes 5 Spock's Brain 5 The Enterprise Incident 8 The Paradise Syndrome 12 And the Children Shall Lead 16 Is There in Truth No Beauty? 19 Spectre of the Gun 22 Day of the Dove 25 For the World Is Hollow and I Have Touched the Sky 28 The Tholian Web 32 Plato's Stepchildren 35 Wink of an Eye 38 The Empath 41 Elaan of Troyius 44 Whom Gods Destroy 47 Let That Be Your Last Battlefield 50 The Mark of Gideon 53 That Which Survives 56 The Lights of Zetar 58 Requiem for Methuselah 61 The Way to Eden 64 The Cloud Minders 68 The Savage Curtain 71 All Our Yesterdays 74 Turnabout Intruder 77 References Article Sources and Contributors 81 Image Sources, Licenses and Contributors 83 Article Licenses License 84 1 Season Overview Star Trek: The Original Series (season 3) Star Trek: The Original Series (season 3) Country of origin United States No. of episodes 24 Broadcast Original channel NBC Original run September 20, 1968 – June 3, 1969 Home video release DVD release Region 1 December 14, 2004 (Original) November 18, 2008 (Remastered) Region 2 December 6, 2004 (Original) April 27, 2009 (Remastered) Blu-ray Disc release Region A December 15, 2009 Region B March 22, 2010 Season chronology ← Previous Season 2 Next → — List of Star Trek: The Original Series episodes The third and final season of the original Star Trek aired Fridays at 10:00-11:00 pm (EST) on NBC from September 20, 1968 to March 14, 1969. -

DLR Magazine
About DLR 153 DLR, the German Aerospace Center, is Germany’s national research centre for aeronautics and space. Its extensive research and development work in aeronautics, magazine space, energy, transport and security is integrated into national and international DLR G cooperative ventures. In addition to its own research, as Germany’s space agency, DLR D L R m a azineof DLR, the German Aerospace Center · No. 153 · April 2017 has been given responsibility by the federal government for the planning and imple- mentation of the German space programme. DLR is also the umbrella organisation for the nation’s largest project management agency. APRIL 2017 DLR has approximately 8000 employees at 20 locations in Germany: Cologne (Headquarters), Augsburg, Berlin, Bonn, Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Dresden, SUN AT YOUR FINGERTIPS Göttingen, Hamburg, Jena, Jülich, Lampoldshausen, Neustrelitz, Oberpfaffenhofen, Oldenburg, Stade, Stuttgart, Trauen and Weilheim. DLR also has offices in Brussels, Paris, Tokyo and Washington DC. Imprint TWO SPACE ODYSSEYS: Celebrating MIR ‘92 and MIR ‘97 anniversaries 100 SECONDS OF ADDITIONAL THRUST: Rocket boosters made of carbon fibre reinforced plastic DLR Magazine – the magazine of the German Aerospace Center TRACKS IN THE SNOW: Research in Antarctica Publisher: DLR German Aerospace Center (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) Editorial staff: Sabine Hoffmann (Legally responsible for editorial content), Cordula Tegen, Elke Heinemann (Editorial management), Karin Ranero Celius, Linda Carrette and Laylan -

STAR TREK II the WRATH of KHAN by HARVE BENNETT
STAR TREK II THE WRATH OF KHAN by HARVE BENNETT PARTICIPATING WRITERS JACK B. SOWARDS SAMUEL A. PEEPLES MAIN TITLE SEQUENCE (TO BE DESIGNED) FADE IN: 1 BLACK 1 Absolute quiet. SOUND bleeds in. Low level b.g. NOISES of Enterprise bridge, clicking of relays, minor electronic effects. We HEAR A FEMALE VOICE. SAAVIK'S VOICE Captain's log. Stardate 8130.3, Starship Enterprise on training mission to Gamma Hydra. Section 14, coordinates 22/87/4. Approaching Neutral Zone, all systems functioning. INT. ENTERPRISE BRIDGE As the ANGLE WIDENS, we see the crew at stations; (screens and visual displays are in use): COMMANDER SULU at the helm, COMMANDER UHURA at the Comm Con- sole, DR. BONES McCOY and SPOCK at his post. The Captain is new -- and unexpected. LT. SAAVIK is young and beautiful. She is half Vulcan and half Romulan. In appearance she is Vulcan with pointed ears, but her skin is fair and she has none of the expressionless facial immobility of a Vulcan. SULU Leaving Section Fourteen for Section Fifteen. SAAVIK Project parabolic course to avoid entering Neutral Zone. SULU Aye, Captain. UHURA (suddenly) Captain... I'm getting something on the distress channel. Minimal signal... But something... SAAVIK Can you amplify? UHURA I'm trying... SULU Course change projected. UHURA It's an emergency distress call! SAAVIK On speakers! VOICE (filtered, breaking up) Imperative! Imperative! This is the Kobayashi Maru -- nineteen periods out of Altair Six. We have struck a gravitic mine and have lost all power... Our hull is... (breaks up, static) ... and many casualties. UHURA This is the Starship Enterprise. -
2014 Annual Conference Program
2014 U.S.-JAPAN COUNCIL ANNUAL CONFERENCE HONOLULU, HAWAII • OCTOBER 9 - 10, 2014 U.S.-Japan Connections: Contributing to Growth, Security and Sustainability TABLE OF CONTENTS 2014 U.S.-Japan Council Annual Conference 4 WELCOME 22 PRESENTERS AND PANELISTS ABOUT THE U.S.-JAPAN COUNCIL CULINARY FESTIVAL FEATURED CHEFS © 2014 Lockheed on n Corporati VC377_138 Marti 7 36 8 CONFERENCE AGENDA 40 TOMODACHI INITIATIVE 10 PRE-CONFERENCE ACTIVITIES 41 TOMODACHI EMERGING LEADERS PROGRAM 11 CELEBRATING CONNECTIONS: A U.S.-JAPAN CULINARY FESTIVAL 42 ANNUAL CONFERENCE SPONSORS 14 PANEL AND ROUNDTABLE DESCRIPTIONS 44 U.S.-JAPAN COUNCIL LEADERSHIP 18 KEYNOTE SPEAKERS 49 IN REMEMBRANCE 20 2014 LIFETIME ACHIEVEMENT AWARDS 50 SPECIAL THANKS THE SECURITY OF PARTNERSHIP. FHB.COM AT LOCKHEED MARTIN, Strengthening WE’RE ENGINEERING A BETTER TOMORROW. In our increasingly interconnected world, the concept of global security has a legacy. come to encompass a broad spectrum of challenges. Modern leaders look to companies with strong experience in advanced technology, wide-ranging capabiliti es and a broad perspecti ve to solve complex challenges. Our global The friendship between Hawaii and Japan is deeply rooted team partners closely with our customers and approaches each mission and in our traditions, our values, and our people. First Hawaiian challenge as our own, whether we’re supporti ng defense modernizati on Bank is proud to welcome the 2014 U.S. – Japan Council programs, ensuring energy and economic security, protecti ng vital networks from cyber att ack or launching satellites into orbit. When it comes to success DQQXDOFRQIHUHQFHDWWHQGHHVDQGDSSODXG\RXUHRUWVLQ in complex environments, we know partnerships make a world of diff erence. -

The Philosophy of J. J. Abrams
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by University of Kentucky University of Kentucky UKnowledge American Popular Culture American Studies 4-18-2014 The Philosophy of J. J. Abrams Patricia Brace Southwest Minnesota State University Robert Arp Click here to let us know how access to this document benefits ou.y Thanks to the University of Kentucky Libraries and the University Press of Kentucky, this book is freely available to current faculty, students, and staff at the University of Kentucky. Find other University of Kentucky Books at uknowledge.uky.edu/upk. For more information, please contact UKnowledge at [email protected]. Recommended Citation Brace, Patricia and Arp, Robert, "The Philosophy of J. J. Abrams" (2014). American Popular Culture. 17. https://uknowledge.uky.edu/upk_american_popular_culture/17 The Philosophy of J. J. Abrams THE PHILOSOPHY OF J. J. ABRAMS Edited by Patricia Brace and Robert Arp Due to variations in the technical specifications of different electronic reading devices, some elements of this ebook may not appear as they do in the print edition. Readers are encouraged to experiment with user settings for optimum results. Copyright © 2014 by The University Press of Kentucky Scholarly publisher for the Commonwealth, serving Bellarmine University, Berea College, Centre College of Kentucky, Eastern Kentucky University, The Filson Historical Society, Georgetown College, Kentucky Historical Society, Kentucky State University, Morehead State University, Murray State University, Northern Kentucky University, Transylvania University, University of Kentucky, University of Louisville, and Western Kentucky University. All rights reserved. Editorial and Sales Offices: The University Press of Kentucky 663 South Limestone Street, Lexington, Kentucky 40508-4008 www.kentuckypress.com Library of Congress Cataloging-in-Publication Data The philosophy of J. -

Frauen in Uniform Im Star-Trek-Universum. Einladende Oder Abschreckende Modelle Für Frauen Beim Österreichischen Bundesheer1
Stefan Gugerel „Darf ich Ihnen etwas zu trinken bringen, Captain?“ Frauen in Uniform im Star-Trek-Universum. Einladende oder abschreckende Modelle für Frauen beim Österreichischen Bundesheer1 Das Österreichische Bundesheer hat seit über 10 Jahren die Möglichkeit für Frauen, als Soldatin Dienst zu versehen. Sowohl die Einführung als auch die heutige bestehende Minderheitensituation lässt die Frage entstehen, wo weibliche Uniformierte Vorbilder finden können bzw. ob allein die männlichen Konzeptionen auch für sie maßgeblich bleiben. Bei der Analyse von Filmen, die ja nicht unwesentlich gesellschaftliche Rollen prägen, wird nach der Formulierung von Geschlechterrollen (durch die meist männlichen Regisseure) gefragt. MITTAG spitzt das drastisch zu: „Feminis- tische Interventionen ergeben sich vor allem durch die Bewusstmachung sol- cher Kodierungszusammenhänge, durch die Trennung von realer Frau und fiktionaler oder projizierter Weiblichkeit, die nicht zufällig im Bild der Nicht- Sprache, des Nicht-Begehrens, der Leiche kulminiert.‛2 Für den Bereich der Science Fiction gilt das noch einmal mehr, als es sich dabei um sehr männer- zentrierte Themenstellungen und Szenarien handelt. Frauen werden zumeist daher in wenigen stereotypen Gestalten eingeführt: „Ob als eine solche attrak- tive ‚damsel-in-distress‘, die aufgrund ihrer deplatzierten und ablenkenden Emotionalität häufig eine zusätzliche Gefahr bedeutet, oder als begehrenswer- te, oft ‚überirdisch‘ schöne, aber bedrohliche Weltraum-Amazone, die es zu domestizieren und im Zweifelsfalle zu vernichten gilt – die Frau hat v.a. eine Funktion inne: die Männlichkeit des Helden, d.h. seine (heterosexuelle) Po- tenz, seinen Mut und Heroismus, seine Stärke und Macht und seine ‚naturge- gebene‘ Überlegenheit zu bestätigen‛.3 In bisher 726 Serienfolgen und elf Kinofilmen entfaltet sich das auf den US- amerikanischen Science-Fiction-Autor Eugene RODDENBERRY zurückge- 1 Begriffe wie „Vereinigte Föderation der Planeten‛, „Sternenflotte‛ oder „Enterprise‛ werden als bekannt vorausgesetzt. -

COMMUNIQUE \~I Vo Lume 2 , I Ssue 2 Second Quarter 1982
~TARFLEET , I , COMMUNIQUE \~i Vo lume 2 , I ssue 2 Second Quarter 1982 ~ - - STAr-FLEET COMMUNIQUE~ Second Quarter 1982 CONTENTS Star Trek II: The Wrath of Khan Movie Review ...•.•..•.• 3 GEORGE TAKEI - The Man Who Would-be Captain An Exclusive Interview ..••...•.•...... • ...... 5 Star Trek II: The Wrath of Khan Book Review .•.•..•..... 7 LETTERS .•.•..•..........•..•.••...•.••..•......•....•. 11 Caption Contest. •..•..•.•...•.••.••..•..•.....••.•.... 18 Project Scrapbook ..•.••.•..• .• •..•......•..••.•.•.•••. 20 STAR TRACKS ..... •....••.••....•..••.•••••..•..•..•.... 22 Contents Copyright © 1982 by STARFLEET. Photos Copyright © 1982 by Paramount Pictures Corporation. STARFLEET recognizes Paramount Pictures "and its licensees as having sole authority to create profit from the Star Trek trademark, and the STARFLEET copyright in no way intends to infringe upon the copyrights held by Paramount. Ihis publication, therefore, is of non-profit nature, and contributions. both monetary and literary, .are welcome and appreciated. Any contributions made to the COMMUNIQUE become the property - of the club and will not be returned. The COMMUNIQUE 1s published quarterly. Club membership fees: $7.00 U.S. - $10.00 foreign for one year . Single copies of the news letter are availabl~ for $2 . 00 ppd. Rates subject to change without notice. Editor-this-issue - Eric A. Stillwell Editor's Corner old Man Khan may have been a valiant foe for the star ship Enterprise, but STARFLEET's greatest enemy in recent months has been Father Time! We apologize for the delay. In addition to several imprOVements and changes to the COMMUNIQUE, which I hope this issue reflects, STARFLEET welcomes Admiral Mike King as the new Chief of Communicat ions and sends best wishes to out-going Brian Jackson whose resignation became effective September l, 1982. -

"Index." Intermedia Games—Games Inter Media: Video Games and Intermediality. Ed. Michael Fuchs and Jeff Thoss. New York: Bloomsbury Academic, 2019
"Index." Intermedia Games—Games Inter Media: Video Games and Intermediality. Ed. Michael Fuchs and Jeff Thoss. New York: Bloomsbury Academic, 2019. 277–284. Bloomsbury Collections. Web. 1 Oct. 2021. <>. Downloaded from Bloomsbury Collections, www.bloomsburycollections.com, 1 October 2021, 21:51 UTC. Copyright © Michael Fuchs, Jeff Thoss and Contributors 2019. You may share this work for non- commercial purposes only, provided you give attribution to the copyright holder and the publisher, and provide a link to the Creative Commons licence. Index 2001: A Space Odyssey (fi lm) 96 Baudrillard, Jean 254 7th Guest, The (video game) 53, 54 beat-’em up games, see brawler games Berman, Rick 220 Aarseth, Espen 73, 74 Betts, Tom 191 action-adventure games 47, 117, 236 Bichard, John Paul 86 Adorno, Theodor W. 145 Bioshock (video game) 252 Adventure (video game) 42 Bioshock (video game series) 95 adventure games 43, 52, 54, 95, 154, Bittanti, Matteo 72, 83, 140 167–85, 211–17 Bizzell, Patricia 54–5, 57 Afrika (video game) 75–6, 77 Blacksad (comic) 126 agency 16, 59 blogs 69, 83, 102, 158–60, 250 Alan Wake (video game) 4, 155 board games 199, 234, 236 Alienare (mobile app) 162 Bogost, Ian 98, 101, 252 Alone in the Dark (video game) 52 Bolter, Jay David 2, 37, 70, 196 American Horror Story (TV show) 216 Bond, Jeff 212 America’s Army (video game) 191 Bonk, Ecke 190 animation 117–21, 138, 162, 176 Borroughs, William 176 arcade games 1, 54, 136–7 Bourriaud, Nicolas 139 Arcangel, Cory 2, 191 Boyer, Elsa 47, 48 Arsdoom (mod/artwork) 190 Bradbury, Ray 103