Evola-Menschen-Inmit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ordensjournal Ausgabe 21 Anmerkungen Zu Ausgewählten Auszeichnungen März 2011
Ordensjournal Ausgabe 21 Anmerkungen zu ausgewählten Auszeichnungen März 2011 Impressum / © : Uwe Brückner / Am Tegeler Hafen 6 / 13507 Berlin E-Mail: [email protected] URL: http://www.ordensmuseum.de Das von Wilhelm II. im Exil gestiftete Gorgo- Abzeichen und die Gorgo-Becher der Doorner Arbeitsgemeinschaft (D.A.G.) 2. erweiterte Auflage Kaiser Wilhelm II. im Exil. Fotograf: Oscar Tellgmann. Ordensjournal / Ausgabe 21 / März 2011 1 Gorgo-Becher und Gorgo-Abzeichen der Doorner Arbeitsgemeinschaft Diese Ausgabe ist die ergänzte und berichtigte, zweite Auflage des Ordensjournals / Ausgabe 19, und ersetzt diese vollständig! Ordensjournal / Ausgabe 21 / März 2011 2 Während des Aktenstudiums im Geheimen Staatsarchiv Stiftung Preußischer Kulturbesitz, blickte ich zunächst ungläubig auf einige Zeilen, in der Seine Majestät der Kaiser zu bestimmen geruht hatte, wann das Gorgoabzeichen anzulegen wäre. Nun beschäftige ich mich schon seit über 30 Jahren mit deutschen, aber insbesondere auch preußischen Orden, Ehrenzeichen und Abzeichen, aber die Existenz eines Gorgoabzeichens war mir bisher verborgen geblieben. In keiner mir bis dahin bekannten Literatur, die sich mit Themen der Phaleristik beschäftigt, ist dieses Abzeichen je erwähnt worden. Auch die Nachfragen bei anderen, fachkundigen Personen auf dem Gebiet der Orden & Ehrenzeichen brachten keinerlei Erkenntnisse. Da die oben genannte Bestimmung jedoch authentisch war, musste das Abzeichen existiert haben. Deshalb war ich mir sicher, dass es möglich sein musste, mehr über das Abzeichen in Erfahrung zu bringen. Ausgehend von der Bestimmung, wann das Abzeichen angelegt werden sollte, konnten weitere Dokumente gefunden werden, in der auch die Verleihung des Abzeichens dokumentiert wurde. Durch weitere Recherchen von Namen, die ich in den Akten finden konnte, stieß ich auf das Frobenius Institut 1 in Frankfurt am Main. -

Instrumentalising the Past: the Germanic Myth in National Socialist Context
RJHI 1 (1) 2014 Instrumentalising the Past: The Germanic Myth in National Socialist Context Irina-Maria Manea * Abstract : In the search for an explanatory model for the present or even more, for a fundament for national identity, many old traditions were rediscovered and reutilized according to contemporary desires. In the case of Germany, a forever politically fragmented space, justifying unity was all the more important, especially beginning with the 19 th century when it had a real chance to establish itself as a state. Then, beyond nationalism and romanticism, at the dawn of the Third Reich, the myth of a unified, powerful, pure people with a tradition dating since time immemorial became almost a rule in an ideology that attempted to go back to the past and select those elements which could have ensured a historical basis for the regime. In this study, we will attempt to focus on two important aspects of this type of instrumentalisation. The focus of the discussion is mainly Tacitus’ Germania, a work which has been forever invoked in all sorts of contexts as a means to discover the ancient Germans and create a link to the modern ones, but in the same time the main beliefs in the realm of history and archaeology are underlined, so as to catch a better glimpse of how the regime has been instrumentalising and overinterpreting highly controversial facts. Keywords : Tacitus, Germania, myth, National Socialism, Germany, Kossinna, cultural-historical archaeology, ideology, totalitarianism, falsifying history During the twentieth century, Tacitus’ famous work Germania was massively instrumentalised by the Nazi regime, in order to strengthen nationalism and help Germany gain an aura of eternal glory. -

Franz Altheim Y La Historia De Los Siglos De La Antiguedad Tardia
Los Hunos: tradición e historia, Antig. crist. (Murcia) IX, 1991 FRANZ ALTHEIM Y LA HISTORIA DE LOS SIGLOS DE LA ANTIGUEDAD TARDIA 1. VIDA El 17 de octubre de 1976 moría en Münster en Westfalia Franz Altheim. Profesor emérito de la Universidad Libre de Berlín desde 1964, se había retirado a vivir en las llanuras del paraíso westfaliano al calor de sus discípulos y muy especialmente de su hija adoptiva Prof. Dra. Ruth Altheim-Stiehl. Las esquelas funerarias se multiplicaron y en su conjunto recogen una panorá- mica completa de la vida y actividad del maestro1. Había nacido el 6 de octubre de 1898 en Frankfurt am Main. Hijo del conocido pintor Wilhelm Altheim, comenzó a escribir cuando apenas tenía 16 años, fecha en la que publicó su Geschichte von Eschersheim, Hessische Chronik 3, 1914. Tuvo que participar muy joven todavía en la primera guerra mundial durante la cual le tocó servir en Turquía, experiencia que probablemente influyó en sus cosmovisiones posteriores. Su tesis doctoral sobre la política de Aristóteles apareció publicada en extracto en 1924: Die Komposition der Politik des Aristoteles. Diss. Frankfurt 1924, 100 páginas. Se habilitó en 1928 con un notable trabajo, publicado dos años más tarde sobre los dioses griegos en Roma: Griechische Gotter im Alten Rom, Giessen, A. Topelmann Verlag, 1930, 216 p. Desde 1928 a 1938 enseñó en Frankfurt, pasando en este último año a Halle (Saale), donde en 1943 fue designado como Profesor Ordinario para Historia Antigua (catedrático). En 1949 fue llamado por la Universidad Libre de Berlín, donde enseñó hasta 1964, fecha en que se jubiló, pasando en 1966 a vivir en Münster. -

The Master Plan: Himmler's Scholars and the Holocaust Heather Pringle
1 The Master Plan: Himmler’s Scholars and the Holocaust Heather Pringle Chapter 1: Foreign Affairs 1. What was the Ahnenerbe? Who founded it and why did they do it? 2. The Ahnenerbe engaged in what sorts of activities? Chapter 2: The Reader 1. What was Heinrich Himmler like as a person? 2. What was Heinrich Himmler’s family background? Describe the relationship between Heinrich Himmler and his father Gebhard and how it affected his education and his politics. 3. How did Himmler come into contact with the Nazi party? Why was he attracted to the Nazi movement and how did he begin to move up in the organization? Terms (definition and significance): o Tacitus o Nibelungenlied o Houston Steward Chamberlain Chapter 3: Aryans 1. Describe the history of the concept of “race.” How did the nature of the concept of “race” help the Nazis? 2 2. Describe the evolution of Aryanism from the mid-eighteenth century to the 1920s. Terms (definition and significance): o James Parsons o Sir William Jones o Fredrich Schlegel o Theodor Benfey o Nordic Race o Hans F. K. Günther Chapter 4: Death’s-Head 1. How did Heinrich Himmler become the head of the SS and how did he transform that organization? 2. What did the Artamanen and Richard Walther Darré contribute to Himmler’s plans to transform the SS and Germany society? 3. How did Himmler conduct racial classification and how did he match the Aryan ideals himself? 4. What was the purpose of the “education offensive” and how was it conducted? Terms (definition and significance): o RuSHA o SS-Leitheft o Nordic Academy o Karl-Maria Wiligut o Weisthor o Wewelburg Chapter 5: Making Stones Speak 1. -

Nazi Secrets: an Occult Breach in the Fabric of History
CONTENTS Title Copyright INTRODUCTION HISTORICAL ODDITIES Non-Whites & Jews in the German Army Spring of Life and Baby Abductions Lake Toplitz: the Nazi Abyss Werewolves The Underground Reich Wonder Weapons NAZI OCCULTISM The Hollow Earth Theory World Ice Theory Neuschwabenland The Ahnenerbe The Wewelsburg Hexen Files Hitler and Magic Wotan and the Aryan Archetype POST-WAR MYTHS The Morning of the Magicians Hitler’s Death The Mystic Treasure of the SS Fantasy Wonder Weapons The Genocide Nazism Becomes a Semi-Religious Movement The Black Sun The Vril EPILOGUE PICTURE CREDITS 2 NAZI SECRETS An Occult Breach in the Fabric of History Revised and Augmented Edition Frank Lost 3 Updated facts about Nazi Secrets and new books at: www.euromyst.com Copyright © 2013 Frank Lost All rights reserved. 4 INTRODUCTION Sometimes reality can be stranger than fiction. It is therefore unnecessary to add more fantasies to the genuine historical facts in the field of Nazi occultism, especially when it comes to their weird expeditions and their pseudo-scientific researches. The true amateur of sensational and strange stories can still be fully satisfied with Himmler's Witch Project, or the Hollow Earth Theory, or the various moons of the World Ice Theory that fell on our planet and drowned the Atlanteans. This is real history and some high-ranking Nazis did believe in these theories, no matter how sensational they may sound to modern ears. It does not add anything to the uncanny spell of such stories to pollute them with material that cannot be verified or, even worse, with pure lies coming straight out of the imagination of poor authors in search of quick money and fame. -

Relations Between Spanish Archaeologists and Nazi Germany (1939–1945)
II. Papers Relations between Spanish Archaeologists and Nazi Germany (1939–1945). A preliminary examination of the influence of Das Ahnenerbe in Spain Francisco Gracia Alonso University of Barcelona ([email protected]) Abstract Julio Martínez Santa Olalla, appointed Commissioner-General for Archaeological Excavations at the Spanish Ministry of National Education and Fine Arts in 1939, established, with the support of the Falange (Spain’s fascist political organisation), relations with the Third Reich’s Das Ahnenerbe, a research institute that formed part of the Allgemeine SS commanded by Reichsführer Heinrich Himmler. The first collaboration between the two institutions comprised the excavation of the Visigothic necropolis of Castiltierra (Segovia). In October 1940, during Himmler’s official visit to Spain, the personal relationship established between Himmler and Martínez Santa Olalla resulted in a plan to set up a Falange-sponsored institution for archaeological research modelled on that of Das Ahnenerbe. Political, academic and personal relations were maintained between Martínez Santa Olalla and SS members Sievers, Wüst, Langsdorff and Jankuhn, and also with the Amt Rosenberg directed by Reichsminister Alfred Rosenberg, until the fall of the Nazi regime. This study analyses these and other relations between Spanish archaeologists and Nazi Germany between 1939 and 1945. [Julio Martínez Santa Olalla, Comisario General de Excavaciones Arqueológicas del Ministerio de Educación Nacional y Bellas Artes desde 1939, estableció, con el apoyo de Falange, relaciones científicas y personales con la sociedad Das Ahnenerbe, una de las instituciones de investigación englobadas en la Allgemeine-SS dirigida por el Reichsführer Heinrich Himmler. La primera colaboración entre ambas instituciones se centró en la excavación de la necrópolis visigoda de Castiltierra (Segovia). -

Origin Myths
chapter 1 Origin Myths Ex septentrione lux For a good ending, one needs a good beginning. (It is important to begin well, because of course the main thing is to continue well—this is storytelling.) Such is the implicit but all-powerful rule that a community anxious to edify by telling its story—to itself, to others, to posterity—should follow. —Nicole Loraux, Born of the Earth: Myth and Politics in Athens History also teaches how to laugh at the solemnities of the origin. The origin always precedes the Fall. It comes before the body, before the world and time; it is associated with the gods, and its story is always sung as a theogony. But historical beginnings are lowly: not in the sense of modest or discreet like the steps of a dove, but derisive and ironic, capable of undoing every infatuation. —Michel Foucault, “Nietzsche, Genealogy, History” Questions of identity are often linked to those of origins. The concep- tual bond between the two is such that the celebration of the former frequently involves the embellishment of the latter. The Nazis developed a coherent origin myth and provided the Ger- man people with a distinguished ancestry precisely because they wished to glorify a nation severely humiliated in 1918, fi rst by a military defeat that was rarely acknowledged as such and subsequently by a peace at Versailles that was perceived as a diktat. 17 18 | Annexing Antiquity This discourse on origins was conceived and transmitted in various ways, including academic and scholarly research. History and anthro- pology, often perceived as auxiliary sciences, were thrust into the serv- ice of the new reigning discipline, racial science (Rassenkunde), produc- ing the kind of scholarship under the Third Reich that its leaders demanded. -

Christian Leden Og SS Ahnenerbe
Christian Leden og SS Ahnenerbe Hvordan en norsk komponist og musikketnograf ble involvert i Heinrich Himmlers forskningsstiftelse SS Ahnenerbe Per Ivar Hjeldsbakken Engevold Masteroppgave i historie UNIVERSITETET I OSLO Insitutt for arkeologi, konservering og historie Høsten 2013 I Sammendrag I denne masteroppgaven belyser jeg forholdet mellom den norske komponisten, ekspedisjonslederen og etnografen Christian Leden (1882-1957) og Heinrich Himmlers forskningsstiftelse SS Ahnenerbe. Oppgaven tar for seg skjæringspunktet mellom vitenskap og völkischideologi og veien fra diffusjonsteori til raseideologi. Internnotater fra Ahnenerbe, en omfattende korrespondanse mellom Ahnenerbes medarbeidere og Leden, samt Ledens egne brev og tallrike artikler i aviser og tidsskrifter danner kildegrunnlaget for denne masteroppgaven. På bakgrunn av disse kildene har jeg belyst hvilke motiver Ahnenerbe hadde for å samarbeide med Leden, hvordan Ledens nazifiseringsprossess foregikk og hva som ble resultatet av dette samarbeidet. Både Ledens livsløp og Ahnenerbes historie blir fremstilt, for å gi et detaljert bilde av hva som utgjorde den ideologiske bakgrunnen til de forskjellige aktørene. Forholdet mellom diffusjonsteori og raseforskning i denne perioden blir også analysert og drøftet. II III Forord Først av alt vil jeg særskilt takke min svært dyktige og engasjerte veileder Terje Emberland for all oppmuntring, gode faglige innspill, kildehjelp og kyndige bistand under arbeidet med dette prosjektet. En stor takk går også til Anne Kristine Furuseth for viktige bidrag om Ledens tid i Sør-Amerika. Under hele arbeidet med masteroppgaven har jeg vært så heldig å få benytte en leseplass hos Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) på Bygdøy. Som en effekt av dette har jeg fått nyte godt av det gode faglige miljøet ved dette senteret og jeg vil derfor rette en stor takk til alle ansatte for god hjelp. -

Carl Gustav Jung, Avant-Garde Conservative
Carl Gustav Jung, Avant-garde Conservative by Jay Sherry submitted to the Doctoral Committee of the Department of Educational Science and Psychology at the Freie Universität Berlin March 19, 2008 Date of Disputation: March 19, 2008 Referees: 1. Prof. Dr. Christoph Wulf 2. Prof. Dr. Gunter Gebauer Chapters Page 1. Introduction 3 2. Basel Upbringing 5 3. Freud and the War Years 30 4. Jung’s Post-Freudian Network 57 5. His Presidency 86 6. Nazi Germany and Abroad 121 7. World War II Years 151 8. The Cold War Years 168 9. Jung’s Educational Philosophy 194 Declaration of independent work 210 Jay Sherry Resumé 211 Introduction Carl Gustav Jung has always been a popular but never a fashionable thinker. His ground- breaking theories about dream interpretation and psychological types have often been overshadowed by allegations that he was anti-Semitic and a Nazi sympathizer. Most accounts have unfortunately been marred with factual errors and quotes taken out of context; this has been due to the often partisan sympathies of those who have written about him. Some biographies of Jung have taken a “Stations-of-the-Cross” approach to his life that adds little new information. Richard Noll’s The Jung Cult and The Aryan Christ were more specialized studies but created a sensationalistic portrait of Jung based on highly selective and flawed assessment of the historical record. Though not written in reaction to Noll (the research and writing were begun long before his books appeared), this dissertation is intended to offer a comprehensive account of the controversial aspects of Jung’s life and work. -
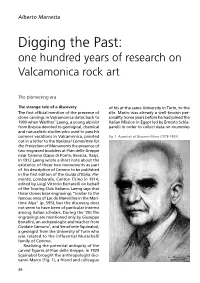
Read the Article As
Alberto Marretta Digging the Past: one hundred years of research on Valcamonica rock art The pioneering era The strange tale of a discovery of his at the same University in Turin, to the The first official mention of the presence of site. Marro was already a well-known per- stone carvings in Valcamonica dates back to sonality. Some years before he had joined the 1909 when Walther1 Laeng, a young alpinist Italian Mission in Egypt led by Ernesto Schia- from Brescia devoted to geological, chemical parelli in order to collect data on mummies and naturalistic studies who used to pass his summer vacations in Valcamonica, pointed Fig. 1. A portrait of Giovanni Marro (1875-1952). out in a letter to the National Committee for the Protection of Monuments the presence of two engraved boulders at Pian delle Greppe near Cemmo (Capo di Ponte, Brescia, Italy). In 1912 Laeng wrote a short note about the existence of these two monuments as part of his description of Cemmo to be published in the first edition of theGuida d’Italia: Pie- monte, Lombardia, Canton Ticino in 1914, edited by Luigi Vittorio Bertarelli on behalf of the Touring Club Italiano. Laeng says that these stones bear engravings “similar to the famous ones of Lac de Marveilles in the Mari- time Alps” (p. 595), but the discovery does not seem to have been of particular interest among Italian scholars. During the ‘20s the engravings are mentioned only by Giuseppe Bonafini, an archaeologist and teacher from Cividate Camuno2, and Senofonte Squinabol, a geologist from the University of Turin who was related to the influential Murachelli family of Cemmo. -

The Photographic Universe: Vilém Flusser's Theories of Photography
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 2-2016 The Photographic Universe: Vilém Flusser’s Theories of Photography, Media, and Digital Culture Martha Schwendener Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/693 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] THE PHOTOGRAPHIC UNIVERSE: VILÉM FLUSSER’S THEORIES OF PHOTOGRAPHY, MEDIA, AND DIGITAL CULTURE by MARTHA SCHWENDENER A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Art History in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York 2016 ©2016 MARTHA SCHWENDENER Some rights reserved. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 United States License. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ii This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Art History in satisfaction of the Dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy __________________ ________________________________________ Date Professor Anna Chave Chair of Examining Committee ____________________ ________________________________________ Date Professor Rachel Kousser Executive Officer ____________________________ Professor Maria Antonella Pelizzari ____________________________ Professor David Joselit ____________________________ Professor Alexander R. Galloway THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK iii ABSTRACT THE PHOTOGRAPHIC UNIVERSE: VILÉM FLUSSER’S THEORIES OF PHOTOGRAPHY, MEDIA, AND DIGITAL CULTURE Adviser: Professor Anna Chave Despite accelerated changes in the way we create, view, and experience photographs, critics and scholars in North America continue to read and assign an accepted canon of photography theory, often predicated on old concepts and technologies. -

1482258184735.Pdf
CONTENTS Introduction The Secret of the Runes The Thule Gesellschaft Hidden Energies The Ahnenerbe Tibet and the Secret Kingdom Unholy Quests Aktion Hess Werwolf Black Sun and Fourth Reich Further Reading, Watching, and Gaming Glossary Introduction The Nazi occult legend predates the war, coming into its own alongside the Nazis themselves. Various “Aryan mystics” claimed the Nazi Party was predestined, even mythic, but the theory of occult, conspiratorial forces intertwined with the rise of the Third Reich first explicitly appeared in a novel entitled Les Sept Têtes du Dragon Vert (The Seven Heads of the Green Dragon; 1933) by a French journalist (and possible French spy) named Pierre Mariel. A number of other French publications elaborated on this theme during the 1930s, culminating in Edouard Saby’s Hitler et les Forces Occultes (Hitler and the Occult Forces; 1939). That same year, the disenchanted German politician Hermann Rauschning published Gespräche mit Hitler (Conversations with Hitler; UK title Hitler Speaks) a book describing Hitler’s encounters with “the new man” of quasi-Theosophist lore, and his “bondage to … evil spirits.” With the outbreak of war in September 1939, the “occult Reich” theory reached the English press in Lewis Spence’s The Occult Causes of the Present War (1941). The actual business of fighting slowed down such speculations, but the concept re-emerged in Louis Pauwels and Jacques Bergier’s Le Matin des Magiciens (The Morning of the Magicians; 1960) and Trevor Ravenscroft’s The Spear of Destiny (1972), both of which sold millions of copies and spawned hundreds of imitators, all of which reconstruct and emphasize each others’ larger claims while contradicting each others’ details.