Koloniale Kämpfe Am Himalaya
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
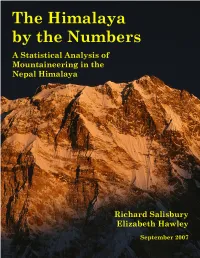
A Statistical Analysis of Mountaineering in the Nepal Himalaya
The Himalaya by the Numbers A Statistical Analysis of Mountaineering in the Nepal Himalaya Richard Salisbury Elizabeth Hawley September 2007 Cover Photo: Annapurna South Face at sunrise (Richard Salisbury) © Copyright 2007 by Richard Salisbury and Elizabeth Hawley No portion of this book may be reproduced and/or redistributed without the written permission of the authors. 2 Contents Introduction . .5 Analysis of Climbing Activity . 9 Yearly Activity . 9 Regional Activity . .18 Seasonal Activity . .25 Activity by Age and Gender . 33 Activity by Citizenship . 33 Team Composition . 34 Expedition Results . 36 Ascent Analysis . 41 Ascents by Altitude Range . .41 Popular Peaks by Altitude Range . .43 Ascents by Climbing Season . .46 Ascents by Expedition Years . .50 Ascents by Age Groups . 55 Ascents by Citizenship . 60 Ascents by Gender . 62 Ascents by Team Composition . 66 Average Expedition Duration and Days to Summit . .70 Oxygen and the 8000ers . .76 Death Analysis . 81 Deaths by Peak Altitude Ranges . 81 Deaths on Popular Peaks . 84 Deadliest Peaks for Members . 86 Deadliest Peaks for Hired Personnel . 89 Deaths by Geographical Regions . .92 Deaths by Climbing Season . 93 Altitudes of Death . 96 Causes of Death . 97 Avalanche Deaths . 102 Deaths by Falling . 110 Deaths by Physiological Causes . .116 Deaths by Age Groups . 118 Deaths by Expedition Years . .120 Deaths by Citizenship . 121 Deaths by Gender . 123 Deaths by Team Composition . .125 Major Accidents . .129 Appendix A: Peak Summary . .135 Appendix B: Supplemental Charts and Tables . .147 3 4 Introduction The Himalayan Database, published by the American Alpine Club in 2004, is a compilation of records for all expeditions that have climbed in the Nepal Himalaya. -

Kolonialität Und Geschlecht Im 20. Jahrhundert
Patricia Purtschert Kolonialität und Geschlecht im 20. Jahrhundert Postcolonial Studies | Band 33 Patricia Purtschert ist Philosophin und Kulturwissenschaftlerin sowie Co-Lei- terin des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung an der Uni- versität Bern. Patricia Purtschert Kolonialität und Geschlecht im 20. Jahrhundert Eine Geschichte der weißen Schweiz Publiziert mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds zur Förde- rung der wissenschaftlichen Forschung Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deut- schen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution-NonCommerci- al-NoDerivs 4.0 Lizenz (BY-NC-ND). Diese Lizenz erlaubt die private Nutzung, gestat- tet aber keine Bearbeitung und keine kommerzielle Nutzung. Weitere Informationen finden Sie unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de Um Genehmigungen für Adaptionen, Übersetzungen, Derivate oder Wiederverwen- dung zu kommerziellen Zwecken einzuholen, wenden Sie sich bitte an rights@tran- script-verlag.de Die Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz gelten nur für Originalmaterial. Die Wiederverwendung von Material aus anderen Quellen (gekennzeichnet mit Quellen- angabe) wie z.B. Schaubilder, Abbildungen, Fotos und Textauszüge erfordert ggf. wei- tere Nutzungsgenehmigungen durch den jeweiligen Rechteinhaber. © 2019 transcript Verlag, Bielefeld Umschlaggestaltung: Maria Arndt, Bielefeld Umschlagabbildung: Bild 1: Werbung für Lux-Seife (Ausschnitt), Quelle: Schweizer Illustrierte Zeitung 1932(7); Bild 2: Bergsteiger Peter Diener, Quelle: Titelbild Schweizer Illustrierte Zeitung 1960(26) Lektorat: Petra Schäfter, textetage Satz: Justine Buri, Bielefeld Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar Print-ISBN 978-3-8376-4410-4 PDF-ISBN 978-3-8394-4410-8 https://doi.org/10.14361/9783839444108 Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei gebleichtem Zellstoff. -

2012Bibarxiuizardfllibres Per
BIBLIOTECA ARXIU IZARD-LLONCH FORRELLAD DE LLEIDA 1 de 82. 21/05/2012 GRAL. X TITOL. Arxiu IZARD FORRELLAD. "Biblioteca" t/v Vol. AUTOR EDITORIAL Lloc Any Pags Fots Graf Maps Idioma Lleida 1949(I-IX), 1950(I-XII), 1951(I-XII) i 1952(I-XII+esp) t 1949 a 1952 CIUDAD LLEIDA 1949 castellà RomBeat rev Les pintures murals de Mur a la col.lecció Plandiura W 28 oct 1919, ed. tarda, pàg 6 La Veu de Catalunya Barcelona 1919 CATALÀ lleida rev AU VIGNEMALE. Les grottes du comte Russell dans les Pyrénées t A. de L. ILLUSTRATION, L' Paris 1898 2 10 FRENCH RomBeat La Batalla del Adopcionismo. t ABADAL i VINYALS/MILLÀS R Acad Buenas Letras de Barcelona 1949 190 0 castellà Osca DE NUESTRA FABLA t ABALOS, J. URRIZA, Lib y Enc de R. LLEIDA 64 0 castellà Lleida ELS PIRINEUS I LA FOTOGRAFIA t ABEL,Ton i JMª Sala Alb Novaidea Barcelona 2004 60 104 CATALÀ Lleida NOTES PER A LA HISTÒRIA DE PUIGCERCÓS t 7 Abella/Armengol/Català/PR GARSINEU EDICIONS TREMP 1992 93 40 div CATALÀ Lleida EL PALLARS REVISITAT. .... J.Morelló..... t 5 Abella/Cuenca/Ros/Tugues GARSINEU EDICIONS TREMP 2002 36 83 CATALÀ Lleida CATÀLEG de Bitllets dels Ajuntaments Catalans, 1936-38 t ABELLÓ/VIÑAS Auto Edició Reus/Barna 1981 102 0 molts CATALÀ Lleida EL INDICE DE PRIVILEGIOS DEL VALLE DE ARAN t ABIZANDA, Manel Institut Estudis Ilerdencs Balaguer 1944 85 3 castellà Arreu JANNU t ABREGO, Mari ARAMBURU IRUNEA 1982 132 +++ + castellà Arreu EN LA CIMA K-2 / CHOGOLISA t ABREGO/ARIZ KAIKU IRUNEA 1987 117 +++ castellà Osca Tras las Huellas de Lucien Briet. -

Peverest Base Camp Trek
Ultimate Island peak PeveRest Base Camp Trek A trekking & climbing experience that blows the mind! Your go to trekking experts for Nepal, Everest and all the adventures inbetween. What's inside? Why trek with EverTrek? 3 Route map 4 Trip overview 5 What’s included 6 Experience needed 7 Your itinerary 8 Equipment list 18 Extend your adventure 22 2 ultimate island peak & eveRest base camptrek 21 days Nepal Trip Duration - 21 Days Accommodation - 15 nights lodge, 2 nights tent, 3 nights hotel Tour Detail - 18 days trekking Max altitude - 6189m (20,305ft) IntroductioN High in the Khumbu region of Nepal, close to Mt Everest and closer still to the steep south face of Mt Lhotse, the aptly named Island Peak (6189m) rises above the glaciated valleys below. With its outrageous location and challenging summit ridge, this peak has been a favourite with our guides, leaders, and clients for a number of years. Ultimate Island Peak and Everest Base Camp Expedition is the ultimate experience in the Everest region for any one looking to attempt a Himalayan peak for the first time. You will not only climb Island Peak at 6189m (20,305ft) but also reach the historic Everest Base Camp (5364m) whilst also climbing 2 of the high passes of Cho La (5,420m) and Kongma La (5,535m) along with the sunrise hike to Kala Patthar (5,545m). One heck of an adventure! 3 clockwise route map of ultimate island peak and eveRest base camp 4 trip overview Trekking via Namche Bazaar we follow the route to Everest Base Camp via the Gokyo valley and Cho La Pass route and into Lobuche beside the Khumbuglacier. -

Mt. Everest Base Camp Trek 15 Days
MT. EVEREST BASE CAMP TREK 15 DAYS TRIP HIGHLIGHTS Trekking Destination: Everest Base Camp, Nepal Maximum Altitude: 5,364m/17,594ft Duration of Trek: 15 Days Group Size: 1 People Or Above Mode of Trekking Tour: Tea House/Lodge Trekking Hour: Approx 5-7 Hours Best Season: March/April/May/Sept/Oct/Nov TRIP INTRODUCTION Everest Base Camp Trek is an opportunity to embark on an epic journey that Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay set off on in 1953. If you like adventure and you like to walk then it is once in a lifetime experience that takes you through the beautiful Khumbhu valley, spectacular Everest High Passes and stunning Sherpa village ultimately leading you to the foot of the Mighty Everest at 5430 meters. Trekking through the Everest also offers the opportunities to go sightseeing around Sagarmatha National Park (a world heritage site) and get a closer look at the sacred Buddhist monasteries. The stunning landscapes and the breathtaking views of the Himalayan giants including Everest, Lhotse, Cho Oyu and Ama Dablam are the highlights of the trek. Other major highlights include beautiful Rhododendron forest, glacial moraines, foothills, rare species of birds and animals, sunrise from Kala Patthar, the legendary Sherpas village their culture, tradition, festivals, and dances. We serve you with the best trekking adventure with our finest services. Our experienced guides will make your adventure enjoyable as well as memorable. Since your safety is our utmost concern we have tailored our itinerary accordingly. DETAIL PROGRAM ITINERARY Day 01: Arrival in Kathmandu City (1300m). After a thrilling flight experience through the Himalayas, observing magnificent views of snow-topped peaks, you land in this beautiful and culturally rich city of Kathmandu. -

1 "Documentary Films" an Entry in the Encylcopedia of International Media
1 "Documentary Films" An entry in the Encylcopedia of International Media and Communication, published by the Academic Press, San Diego, California, 2003 2 DOCUMENTARY FILMS Jeremy Murray-Brown, Boston University, USA I. Introduction II. Origins of the documentary III. The silent film era IV. The sound film V. The arrival of television VI. Deregulation: the 1980s and 1990s VII. Conclusion: Art and Facts GLOSSARY Camcorders Portable electronic cameras capable of recording video images. Film loop A short length of film running continuously with the action repeated every few seconds. Kinetoscope Box-like machine in which moving images could be viewed by one person at a time through a view-finder. Music track A musical score added to a film and projected synchronously with it. In the first sound films, often lasting for the entire film; later blended more subtly with dialogue and sound effects. Nickelodeon The first movie houses specializing in regular film programs, with an admission charge of five cents. On camera A person filmed standing in front of the camera and often looking and speaking into it. Silent film Film not accompanied by spoken dialogue or sound effects. Music and sound effects could be added live in the theater at each performance of the film. Sound film Film for which sound is recorded synchronously with the picture or added later to give this effect and projected synchronously with the picture. Video Magnetized tape capable of holding electronic images which can be scanned electronically and viewed on a television monitor or projected onto a screen. Work print The first print of a film taken from its original negative used for editing and thus not fit for public screening. -

The Epic of Everest: Austere Mountain, Austere Score by Jeremy Reynolds
The Epic of Everest: austere mountain, austere score by Jeremy Reynolds In 1935, Frances Bolton acquired the Cleveland Museum of Art’s first film projector and began hosting screenings of works by prominent filmmakers. Now, 80 years later, the program is still going strong, with around 90 annual screenings of historic and avant-garde movies alike. According to the Museum’s website, the program is one of the oldest in the nation, and it continues to draw thousands of patrons over the course of the year. On Friday evening, June 19, a modest crowd gathered in Morley Lecture Hall in the Museum. A projection screen hangs in the front of the hall, with speakers dotted around the room to provide an optimal surround sound experience. At precisely 7:00 pm, the lights dimmed and the night’s program began, though latecomers continued to trickle into the hall. A heroic saga, The Epic of Everest details the third attempt to summit the highest peak on Earth. John Baptist Lucius Noel directed the black-and-white film, originally shot with a hand-cranked camera in 1924. Climbers George Mallory and Andrew Irvine both perished less than a thousand feet from their goal, but this documentary lives on, both as a testament to their bravery in the face of nature’s awesome might and as the earliest filmed record of Tibetan life. The British Film Institute restored the 87-minute silent film and commissioned an original musical score by composer Simon Fisher Turner (pictured above), begging the question: does an originally silent film need a musical score? The movie opens with several screens of subtitles explaining the history behind Irvine’s and Mallory’s expedition, then transitions into about five minutes of different shots of Mount Everest in all its frigid splendor. -

Films and Videos on Tibet
FILMS AND VIDEOS ON TIBET Last updated: 15 July 2012 This list is maintained by A. Tom Grunfeld ( [email protected] ). It was begun many years ago (in the early 1990s?) by Sonam Dargyay and others have contributed since. I welcome - and encourage - any contributions of ideas, suggestions for changes, corrections and, of course, additions. All the information I have available to me is on this list so please do not ask if I have any additional information because I don't. I have seen only a few of the films on this list and, therefore, cannot vouch for everything that is said about them. Whenever possible I have listed the source of the information. I will update this list as I receive additional information so checking it periodically would be prudent. This list has no copyright; I gladly share it with whomever wants to use it. I would appreciate, however, an acknowledgment when the list, or any part, of it is used. The following represents a resource list of films and videos on Tibet. For more information about acquiring these films, contact the distributors directly. Office of Tibet, 241 E. 32nd Street, New York, NY 10016 (212-213-5010) Wisdom Films (Wisdom Publications no longer sells these films. If anyone knows the address of the company that now sells these films, or how to get in touch with them, I would appreciate it if you could let me know. Many, but not all, of their films are sold by Meridian Trust.) Meridian Trust, 330 Harrow Road, London W9 2HP (01-289-5443)http://www.meridian-trust/.org Mystic Fire Videos, P.O. -

Annual Report 2014
ANNUAL REPORT 2014 1 2014 Photograph by Michael Palma 2 2014 TABLE OF CONTENTS Letter from the Executive Director 5 Exhibitions 6 Publications 7 Education 8 Programming 10 Gifts and Purchases of Art 14 Individual and Institutional Support 18 Individual Membership 20 Corporate Membership 21 Volunteer Support 23 Financial Statements 24 3 2014 Photograph by Michael Seto Photography 4 LETTER FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR Dear friends and supporters, I am pleased to share with you the highlights of Having gained a distinct position in the cultural our activities in 2014, including acknowledgements landscape of New York City and beyond, our of our generous supporters and our audited goal is to focus on areas where we can be most financial statement. uniquely impactful. We will continue the strategy of maintaining a tightly focused collection while using 2014 marked the ten-year anniversary of the Rubin our exhibitions to give voice to the broader region Museum—a significant milestone and reason to and trans-cultural and contemporary expressions. celebrate. Since we opened in 2004, we have And we will be sure to occasionally surprise you presented more than one hundred exhibitions, with unexpected and provocative exhibitions. offered thousands of programs, and welcomed more than 1.6 million visitors. Over the past ten years the Rubin Museum has established close ties with individuals and At the Rubin we create experiences that spark communities, local and worldwide. Being an new ways of seeing the world and inspire internationally respected institution as well as a you, the visitor, to make connections between place-centered organization with responsibilities contemporary life and the art and ideas of the to local constituencies is a challenge and an Himalayas and neighboring regions. -

Catalogue of the National Film Library of Sixteen
NATlONALg^LlB . -r MMMtMt^mmtiMiMMMIliflUf'flni*' Scanned from the collection of Karl Thiede Coordinated by the Media History Digital Library www.mediahistoryproject.org Funded by a donation from David Pierce ;'// v/-^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from IVIedia History Digital Library http://www.archive.org/details/catalogueofnatio01nati r CATALOGUE of the NATIONAL FILM LIBRARY of Sixteen Millimeter Motion Pictures FIRST EDITION Published by the NATIONAL FILM LIBRARY 811 Richfield Building Los Angeles, California Telephone: MUtual 5916 Price: 1 5 c Copyright 1931 By National Film Library FOREWORD The National Film Library was established to provide a free source of films for use in sixteen millimeter motion picture projectors in homes, schools, churches and clul)s of six Southern California Counties, namely : Los Angeles, Ventura. Santa Barbara, Orange, Riverside and San Ber- nardino. In this territory there are approximately 30.000 sixteen milli- meter projectors. Hitherto the use of these projectors has been restricted largely be- cause of the high cost of buying or renting films. Now, however, through the co-operation of public spirited advertisers, the National Film Library is able to loan free to projector owners a large numl>er of desirable films. This catalogue is furnished without charge to all members of the Library. It includes complete descriptions of the films in the Library at the time it was issued. At regular intervals it will be supplemented by special bulletins containing reviews of films recently added to the Library. Watch for these supplements. A perusal of the catalogue will reveal the fact that the films are diversified in character so that subjects may be selected which will be suitable for all occasions and all tastes. -

Everest 1953
Everest 1953 THE EPIC STORY OF THE FIRST ASCENT MICK CONEFREY OW_507_Prelims.indd iii 3/19/2013 11:25:42 AM A Oneworld Book First published by Oneworld Publications 2012 Th e paperback edition published in 2013 Copyright © Mick Conefrey 2013 All photographs in plate section © Royal Geographical Society All maps © Mick Conefrey Th e moral right of Mick Conefrey to be identifi ed as the Author of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988 All rights reserved Copyright under Berne Convention A CIP record for this title is available from the British Library ISBN 978-1-78074-230-4 ebook 978-1-78074-103-1 Typeset by Jayvee, Trivandrum, India Printed and bound by CPI Mackays, Croydon, UK Cover design by Stuart Polson Cover photographs: Everest team © Royal Geographical Society; Everest © David Pearson / Alamy Oneworld Publications 10 Bloomsbury Street, London WC1B 3SR, England Stay up to date with the latest books, special offers, and exclusive content from Oneworld with our monthly newsletter Sign up on our website www.oneworld-publications.com OW_507_Prelims.indd iv 3/14/2013 1:59:09 PM To Stella Bruzzi OW_507_Prelims.indd v 3/14/2013 1:59:09 PM What a strange and thrilling thing we have let loose – a very wonderful experience awaits us, if we don’t lose our heads. John Hunt’s Diary, 3 June 1953 OW_507_Prelims.indd vi 3/14/2013 1:59:10 PM Contents Prologue: Our Mountain ix 1 Mr Everest 1 2 Th e Real Climbers 27 3 Th e Turquoise Goddess 39 4 A Very British Coup 59 5 A Paper Mountain 83 6 Th e Kathmandu Cold Shoulder 105 7 Th e Icefall 135 8 Th e Lhotse Face 157 9 First Up 179 10 To the Summit 201 11 Snow Conditions Bad 223 12 Whose Mountain? 237 13 Bringing Everest Home 261 Epilogue 279 Aft erword 293 Notes 295 Bibliography and notes on sources 305 Index 311 OW_507_Prelims.indd vii 3/14/2013 1:59:10 PM Prologue Our Mountain For British climbers of the 1920s and 1930s, Everest was, quite simply, ‘our mountain’. -

The Structural Geometry, Metamorphic and Magmatic Evolution of the Everest Massif, High Himalaya of Nepal–South Tibet
Journal of the Geological Society, London, Vol. 160, 2003, pp. 345–366. Printed in Great Britain. The structural geometry, metamorphic and magmatic evolution of the Everest massif, High Himalaya of Nepal–South Tibet M. P. SEARLE1,R.L.SIMPSON1,R.D.LAW2,R.R.PARRISH3 &D.J.WATERS1 1Department of Earth Sciences, Oxford University, Parks Road, Oxford OX1 3PR, UK (e-mail: [email protected]. uk) 2Department of Geological Sciences, Virginia Tech., Blacksburg, Virginia 24061, USA 3Department of Geology, Leicester University, Leicester LE1 7RH, and NERC Isotope Geosciences Laboratory, Keyworth, Nottingham, NG12 5GG Abstract: This paper presents a new geological map together with cross-sections and lateral sections of the Everest massif. We combine field relations, structural geology, petrology, thermobarometry and geochronology to interpret the tectonic evolution of the Everest Himalaya. Lithospheric convergence of India and Asia since collision at c. 50 Ma. resulted in horizontal shortening, crustal thickening and regional metamorphism in the Himalaya and beneath southern Tibet. High temperatures (.620 8C) during sillimanite grade metamorphism were maintained for 15 million years from 32 to 16.9 Æ 0.5 Ma along the top of the Greater Himalayan slab. This implies that crustal thickening must also have been active during this time, which in turn suggests high topography during the Oligocene–early Miocene. Two low-angle normal faults cut the Everest massif at the top of the Greater Himalayan slab. The earlier, lower Lhotse detachment bounds the upper limit of massive leucogranite sills and sillimanite–cordierite gneisses, and has been locally folded. Ductile motion along the top of the Greater Himalayan slab was active from 18 to 16.9 Ma.