Daniel Ernst Jablonski Steht an Der Wiege Der Brandenburgisch
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
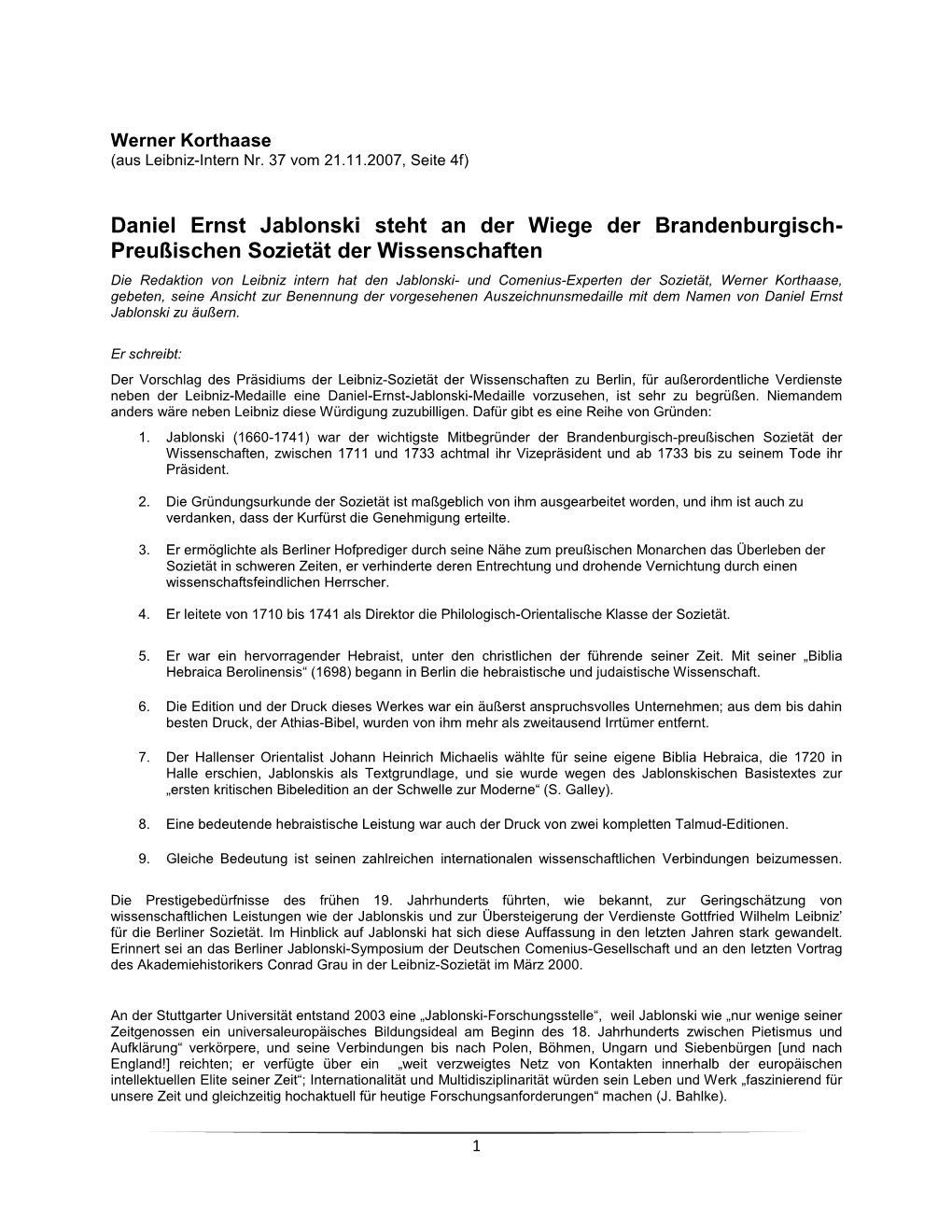
Load more
Recommended publications
-
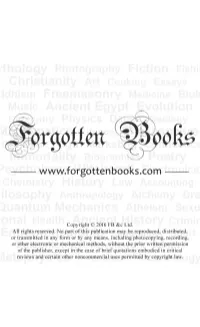
Moravian Missions
”5 ° A H I ST O R Y O O O O O 1 S I O N S N C H U RC H . TA Y L O R HA M I LTO N . A H I S T O R Y 4, ‘O " ‘OCM L semi O F T H F. M I S S I O N S O F T H E OR AV A N C H U R C H . D U R I N G T H E E I G H T E E N T H A N D N I N ET E E N I H C E N T U R I E S . B Y J. TA Y L O R H A M I L TO N . " P m x O P ( nc u H ISTO R Y m T m: M OR A V I A N T n aowu cu . S u sanna ” r rsso n u , A N D V i m: P a mmns'r 0? T m: Sea m FO R P R OP AGATI NG T mz Gosru A M ONG T H E H u r u m. e n u mm . PA . B ET H L E H E M . P A C O P Y R I G H T I oI g , L R H A M I L T O N . B Y j . TAY O I ’ R E I ’A C I E ssentia ll y a reprint of p ortion s of the H istory of the Mora C h u rch u bl ish ed by a u th or 1 00 vian p the in the year 9 , the account of the mission ary labors which constitute a chief ra ison ’ d [We for its separate denominational existence is herewi th issued in separate form in the belief that thus the needs of a wider public desirous of some insight into the details of Mora vian missionary activity may be met . -

The Leibniz Review, Vol. 23, 2013 Brückenschläge: Daniel Ernst
Brückenschläge: Daniel Ernst Jablonski im Europa der Frühaufklärung, ed. Hartmut Rudolph, et al. Dössel: Verlag Janos Stekovics, 2010. Pp. 439, numerous color plates. Reviewed by Patrick Riley, Harvard University n 2011, the Berlin-Brandenburg Academy published, after a wait of 313 years, Leibniz’ great 1698 irenical treatise entitled Unvorgreiffliches Bedencken I(“Unprejudiced Thoughts”) on Lutheran-Calvinist re-unification (A IV, 7, pp. 462 ff.)—a work which the eminent Reformation-scholar Irena Backus has rightly called Leibniz most important contribution to philosophical theology before the 1710 Théodicée itself. (The Academy-edition offers, on facing pages, both the “First Version” of Unvorgreiffliches Bedencken—the radical, boldly anti- Cartesian, Calvin-doubting version—and the shorter, more diplomatic (but also less philosophically effective) “Final Version.”) Both versions of Leibniz’ Unvorgreiffliches Bedencken are responses to the so-called Kurtze Vorstellung (“Short Representation”) of Lutheran-Calvinist differences by the Calvinist preacher to the Prussian court in Berlin, Daniel Ernst Jablonski (Oxford-educated and broad-minded); the Kurtze Vorstellung (1697) was first published by Dr. Hartmut Rudolph (distinguished retired editor of Leibniz’ Politische Schriften) in a Sonderheft of Studia Leibnitiana, “Labora Diligenter,” in 1999. Now Hartmut Rudolph, the world’s leading authority on the Leibniz-Jablonski connection, has given us (together with two colleagues, J. Bahlcke and B. Dybas) a splendid large book on Jablonski as “bridge-builder,” linking not just Lutherans and Calvinists, but also Berlin and Hannover, Leibniz and Berlin intellectuals, and indeed all those who helped set up the Berlin Academy of Sciences at the dawn of the 18th century. Three of Brückenschläge’s best chapters are by Dr. -

Hartmut Rudolph Daniel Ernst Jablonski Und Gottfried Wilhelm Leibniz
Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät 101(2009), 7–26 der Wissenschaften zu Berlin Hartmut Rudolph Daniel Ernst Jablonski und Gottfried Wilhelm Leibniz – Kirchen- und akademiegeschichtliche Beobachtungen zur Frühaufklärung1 I. Grundlagen des Leibnizschen Akademiegedankens Es ist üblich, in der Historiographie des Akademiegedankens im 17. Jahrhun- dert auf die Utopien Johann Valentin Andreaes, Tommaso Campanellas und Francis Bacons zu verweisen, weil sie auf eine durchgreifende gesellschaft- liche Erneuerung zielten, die im Wesentlichen von Gelehrten, von Wissen- schaftlern, realisiert werden sollte2. Comenius, dessen Reformpläne nicht nur die Gründung der Londoner Royal Society beeinflusst haben, sondern der auch zur Vorgeschichte der brandenburg-preußischen wissenschaftlichen So- zietät zählt, kann als ein herausragender Repräsentant utopisch-chiliastischer Bestrebungen der Zeit im und nach dem Dreißigjährigen Krieg gelten. Es geht bei diesem Chiliasmus nicht um ein gegen die Obrigkeiten sich wen- dendes gewaltsames Errichten des Tausendjährigen Reiches Christi auf Er- den, sondern um einen „subtilen“ Chiliasmus, wie ihn Siegfried Wollgast mehrfach für die frühe Neuzeit beschrieben und vom „Chiliasmus crassus“ unterschieden hat3 und wie er uns auf der Bühne, die es hier zu betrachten gilt, etwa mit Philipp Jakob Spener begegnet, neben Daniel Ernst Jablonski einer führenden und einflussreichen Gestalt des kirchlichen Lebens in der Zeit der 1 Festvortrag am Leibniz-Tag 2008 der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin am 26. Juni 2008 – Vortrag und diese Ausarbeitung sind dem Gedächtnis Dr. Dr. h.c. Werner Kort- haases, gest. am 6. Mai 2008, gewidmet. 2 Vgl. etwa Conrad Grau: Komenský und der Akademiegedanke im 17. Jahrhundert. In: Symposium Comenianum 1986. (Praha 1989), S. 143-148; ders.: Anfänge der neuzeit- lichen Berliner Wissenschaft 1650-1790. -

Daniel Ernst Jablonski: Ein Brückenbauer Im Europa Der Frühen Neuzeit
HARTMUT RUDOLPH DANIEL ERNST JABLONSKI: EIN BRÜCKENBAUER IM EUROPA DER FRÜHEN NEUZEIT ABSTRACT: The biography of Daniel Ernst Jablonski (1660-1741), bishop of the Moravian Brethren in Poland and at the same time a most influential Prussian court preacher, reflects the relationships between East-, Central- and Western Europe during the Early Enlightenment. Both, his Grandfather, Jan Amos Comenius, and his father, were bishops of a church, which had been exiled from Czechia to Poland, where Daniel Ernst Jablonski was born. He studied in Frankfurt (Oder), and at the Christ Church College in Oxford, where he became friend with several prominent members of the Anglican Church. He was an outstanding member in the European respublica literaria in different fields, Orientalistic, i.e. Jewish and biblical studies, and he was highly esteemed as a scholar in Old Slav church history. These were good preconditions for making him a bridge builder between nations and ideas. Side by side with Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) he worked at the foundation of the later-on famous Prussian Academy of Sciences and over decades he worked at the union of the separated Protestant churches. For his lifelong commitment to the religious tolerance and to the rights of religious minorities, along with his scientific work, he deserves to be considered a representative (if in a moderate way) of the European Enlightenment. SOMMARIO: Daniel Ernst Jablonski (1660-1741), vescovo dei fratelli moravi in Polonia fu uno dei più influenti predicatori di corte in Prussia e la sua biografia riflette le relazioni tra l’Europa centro-orientale e quella occidentale durante il primo Illuminismo. -

Protestant Propaganda in a Cold War of Religion: from the Hartlib Circle to the Society for Promoting Christian Knowledge Sugiko Nishikawa
LITHUANIAN historical STUDIES 16 2011 ISSN 1392-2343 PP. 51–59 PROTESTANT PROPAGANDA IN A COLD War OF RELIGION: FROM THE HARTLIB CIRCLE TO THE SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE Sugiko Nishikawa ABSTRACT This article considers how, impelled by confessional divisions caused by the Reformation, a general sense of pan-Protestant community grew across Europe, and its members launched a long battle against Ro- man Catholicism far beyond the 16th century. Indeed, it continued into the mid-18th century, the so-called Age of Reason. If it cannot necessarily be described as an open war of religion like the Thirty Years War, it was at least a cold war. From their points of view, the Protestant minorities threat- ened by the Roman Catholic Counter Reformation, such as the Waldensi- ans in northern Italy and the Lithuanian Calvinists, stood on the front line in this war. Thus, financial support was regularly offered by the Protestant churches in Great Britain and Ireland to their distressed brethren across the continent, university scholarships were set up for students from Catholic- dominated areas, and plans were drafted for a Protestant union in Europe, from a military level to an ecclesiastical one. It is in this context that we must understand how apparently strange a phenomenon as British support for the translation of the Bible into Lithuanian developed. The author sees Chylinski’s activities in the tradition of learning and charity exhibited in the 1650s by the three leading members of the Hartlib philosophical circle, namely, Samuel Hartlib (originally from Elbing), Jan Amos Comenius (from Moravia), and John Dury (born in Edinburgh, he spent his early life in vari- ous places in northern Europe), who were, in a sense, Protestant refugees to England from north-central Europe. -

Entity Name (BCDA) BATIBO CULTURAL and DEVELOPMENT ASSOCIATION 01:CONCEPT LLC 1 800 COLLECT INC
Entity Name (BCDA) BATIBO CULTURAL AND DEVELOPMENT ASSOCIATION 01:CONCEPT LLC 1 800 COLLECT INC. 1 CLEAR SOLUTION, LLC 10 GRANT CIRCLE LLC 10 Grant KNS LLC 1000 URBAN SCHOLARS 1001 16TH STREET LLC 1001 H ST, LLC 1001 L STREET SE, L.L.C. 1001 SE Holdings LLC 1003 RHODE ISLAND LLC 1005 E Street SE L.L.C. 1005 Rhode Island Ave NE Partners LLC 1007 Irving Street NE Partners LLC 1007-1009 H STREET, NE LLC 100TH BOMB GROUP FOUNDATION INC. 101 5th Street NE LLC 101 CONSTITUTION Trust 101 WAYNE LLC 1010 MASSACHUSETTS AVENUE CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION 1010 V LLC 1011 Otis Place L.L.C. 1011 Otis Place NW LLC 1012 9th St. Builders LLC 1015 Euclid Street NW LLC 1015 U STREET LLC 1016 16TH STREET CONDOMINIUM LLC 1016 7TH STREET LLC 1019 VENTURES LLC 102 MILITARY ROAD LLC 1020 45th St. LLC 1021 48TH ST NE LLC 1022 47TH STREET LLC 1026 45th St. LLC 1030 TAUSSIG PLACE, LLC 1030 W. 15TH LLC 1033 BLADENSBURG ROAD, NE LLC 1035 48th Street LLC 104 13TH STREET LLC 104 Kennedy Street LLC 1042 LIMITED PARTNERSHIP LLP 105 35th Street N.E. LLC 1061 INN, LLC 107 LLC 1070 THOMAS JEFFERSON ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP 1075 KENILWORTH AVENUE LLC 1085805 SE LLC 1090 Vermont LLC 1090 VERMONT AVENUE GP LLC 109-187 35TH STREET N.E. BENEFICIARY LLC 109-187 35TH STREET N.E. TRUSTEE LLC 10TH & M STREET CONDOMINIUMS LLC 10th Street Parking Cooperative Association, Inc. 1100 21ST STREET ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP 1100 FIRST INC. -

Moravian Moravian
From the Sanctuary From the mmoravianoravian Sanctuary DECEMBER 2018 mmessengeressenger Ever since my mother died on 20th December, seven years ago, With the birth narratives placing so much emphasis on the I have found myself re-evaluating Christmas each year. 'coming of Christ' as a baby, it is easy to ignore or overlook the Christmas comes at the time of year when the year is dying - death, transition, journeying and fear that are imbedded in the and at a time when many significant folk in our congregation experience of Christ's birth. and community are dying. That is not morbid, but merely an acknowledgment that what for many is a joyful occasion, is Strange as it may seem, that gives me comfort; for whilst others also contaminated with paradox and death. Indeed, the celebrate I have permission to both celebrate and grieve. The celebration of Christmas is there to bring light into that darkness. birth narratives show us that life is very much about holding, That itself is a paradox. and living with, the tension between its paradoxes. Life and This sense of paradox and death are very much reflected in the death are both parts of the same entity. That is our reality. So, Christmas stories. In spite of our attempts to dress them up whilst we righty focus on the celebrations that make Christmas with cute children and animals, the narratives are full of death, joyful and meaningful, don't ignore the fact that some are in cruelty and paradox. We see contrasts between those who pain at this time of year. -

English Attitudes Toward Continental Protestants with Particular Reference to Church Briefs C.1680-1740
English Attitudes toward Continental Protestants with Particular Reference to Church Briefs c.1680-1740 By Sugiko Nishikawa A Dissertation for the degree of Ph. D. in the University of London 1998 B CL LO\D0 UNIV Abstract Title: English Attitudes toward Continental Protestants with Particular Reference to Church Briefs c.1680-1740 Author: Sugiko Nishikawa It has long been accepted that the Catholic threat posed by Louis X1V played an important role in English politics from the late seventeenth century onwards. The expansionist politics of Louis and his attempts to eliminate Protestants within his sphere of influence enhanced the sense of a general crisis of Protestantism in Europe. Moreover news of the persecution of foreign Protestants stimulated a great deal of anti-popish sentiment as well as a sense of the need for Protestant solidarity. The purpose of my studies is to explore how the English perceived the persecution of continental Protestants and to analyse what it meant for the English to be involved in various relief programmes for them from c. 1680 to 1740. Accordingly, I have examined the church briefs which were issued to raise contributions for the relief of continental Protestants, and which serve as evidence of Protestant internationalism against the perceived Catholic threat of the day. I have considered the spectrum of views concerning continental Protestants within the Church; in some attitudes evinced by clergymen, there was an element which might be called ecclesiastical imperialism rather than internationalism. At the same time I have examined laymen's attitudes; this investigation of the activities of the SPCK, one of the most influential voluntary societies of the day, which was closely concerned with continental Protestants, fulfills this purpose. -

Escape from Rome: Teofan Prokopovych and Ukrainian Orthodox Ties to the Eternal City, 1650–1721* Andr Ey V
Harvard Ukrainian Studies 37,Escap no. E1–2 from (2020): rom 47–81.E 47 Escape from Rome: Teofan Prokopovych and Ukrainian Orthodox Ties to the Eternal City, 1650–1721* Andr Ey V. Ivanov Introduction vEr thE cEnturiEs of European religious history, Rome served as the ultimate destination for many spiritually rewarding journeys ofO devotion and pious learning. Rarely did a sojourn in Rome turn a devotee into a disillusioned rebel, with one exception: the famous case of the 1511 pilgrimage of a monk named Martin Luther. Another, less known, example was Teofan (Feofan) Prokopovych (1681–1736), a scion of a Kyivan merchant family who studied in the city between 1698 and 1701. Although Prokopovych was one of the hundreds of Ukrainians who * For the support for research and travel involved in the writing of this article, I owe a debt of gratitude to funding provided by the residential fellowship of Herzog August Library, Wolfenbüttel, in 2016; the Scholarly Activity Improvement Fund, provided by the University of Wisconsin-Platteville in 2015; and research travel funding provided by the Boston College History Department in 2013. I thank Frs. Jim McCann, SJ, and Manuel Nin, OSB, for making my stay in Rome a very productive one and for facilitating access to the important library and archival collections in the city. The faculty and associates of the Harvard Ukrainian Research Institute, where a version of this work was presented at a seminar held on 19 October 2015, offered invaluable comments and criticisms that helped me sharpen my arguments and shape the article’s conceptual framework. -

(FINAL DRAFT).Pages
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ RELIGION ON THE MARGINS: TRANSATLANTIC MORAVIAN IDENTITIES AND EARLY AMERICAN RELIGIOUS RADICALISM A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in HISTORY by Benjamin M. Pietrenka September 2017 The Dissertation of Benjamin M. Pietrenka is approved: ________________________________ Professor Marilyn J. Westerkamp, chair ________________________________ Assoc. Professor Gregory E. O’Malley ________________________________ Professor Susan Harding ________________________________ Tyrus Miller Vice Provost and Dean of Graduate Studies Copyright © by Benjamin M. Pietrenka 2017 Contents Abstract……………………………………………………………… iv Dedication…………………………………………………………… v Acknowledgements…………………………………………….…… vi Introduction…………………………………………………………. 1 1. Ecclesiastical Intrusions and the Politics of Vagueness….……..…… 42 2. Bringing the New World Home………..……………………………. 86 3. Bloody Bodies………………………………………………………. 129 4. New Moravian Bodies………………………………………………. 199 5. Dangerous Corporealities…………………………………………… 274 Conclusion……………………………………………….……..…… 350 Bibliography………………………………………………………… 368 !iii Abstract Religion on the Margins: Transatlantic Moravian Identities and Early American Religious Radicalism by Benjamin M. Pietrenka This dissertation traces transatlantic processes of German religious and social identity formation in eighteenth-century North America through the lens of an expansive correspondence network established by the pastoral missionaries and common believers -

Voices from the Vault
Newsletter from the Moravian Archives, Bethlehem PA Voices from the Vault Issue 1 October 2004 After Six Months Special points of interest: An Epistle from Paul • New title for newsletter. It was on the first day of Wall fell and little did I March 2004 that I started • Archives’ oldest book know that only a few years my new job as the archivist was written by an oppo‐ later I would be working of the Moravian Archives in nent of the Hussite there! After completing my movement. Bethlehem. Since then, I Ph.D. I trained to become have met many of you and I • Jablonski Papers are an archivist at the State am looking forward to inventoried. Archives School in The getting to know many more • New archival software in Hague. At that time I was of the Archives’ Friends in use in Bethlehem ar‐ asked to come to Herrnhut the near future. Let me chives. to become archivist at the explain a bit about myself. • Volunteers help empty Unity Archives. Living in a My name is Paul Peucker vault. country where people grew (which is in fact a German up under such different name, pronounced poiker). circumstances and seeing I was born and raised in the was my introduction to the challenges of the post‐ Moravian community of archival research. After communist era were very Zeist in the Netherlands. studying the relevant interesting experiences. I While studying history at records in the Zeist learned a lot at the Unity the University of Utrecht I archives I traveled to Archives and I hope to be chose to write my thesis on Herrnhut, Germany, where able to take advantage of Heerendijk, the first I learned about the wealth my experience here in European Moravian of information kept there Inside this issue: Bethlehem. -
David Nitschmann's Bishop's Ordination, 1735
Moravian Archives, Bethlehem, Pa. Issue 51 March 2010 David Nitschmann’s Bishop’s Ordination, 1735 On March 13, 1735, David Nitschmann was ordained as the first bishop of the renewed Moravian Church. Though not much publicity was given to it at the time, this ordination had major consequences for the later development of the Moravian Church. During the 1730s the Moravian movement spread beyond the original community of Herrnhut. With Moravians working as mis- sionaries on various Caribbean islands, in Copy of the ordination certificate, David Nitschmann Papers, Moravian Archives. Bethlehem. Greenland and in Lapland, it became neces- sary to ordain missionaries as ministers so He was born in Zauchtenthal (Suchdol) in Herrnhut. Unlike the bishops of the Unitas they could baptize and administer Holy Moravia in 1696. After he joined the com- Fratrum, however, Moravian bishops did not Communion. Herrnhut was officially part of munity of Herrnhut in 1724 he undertook have any administrative authority. According the Lutheran parish of Berthelsdorf during several trips to Moravia to visit with other to his ordination certificate David Nitsch- these years, so the Berthelsdorf minister Protestants. Zinzendorf sent him on mis- mann’s main responsibility was to visit and was responsible for administrating the sacra- sions to England (1728) and Livonia (1729), to ordain “Pastors and Servants of the ments. Beyond Herrnhut this was different. and he accompanied Zinzendorf to the Church.” Until this day, Moravian bishops What were the missionaries to do when coronation of the King of Denmark in 1731. are primarily responsible for ordinations and they needed to baptize someone? Moravian Together with Leonhard Dober, Nitsch- for the pastoral care of the ministers.