Der Libellen-Schmetterlingshaft
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
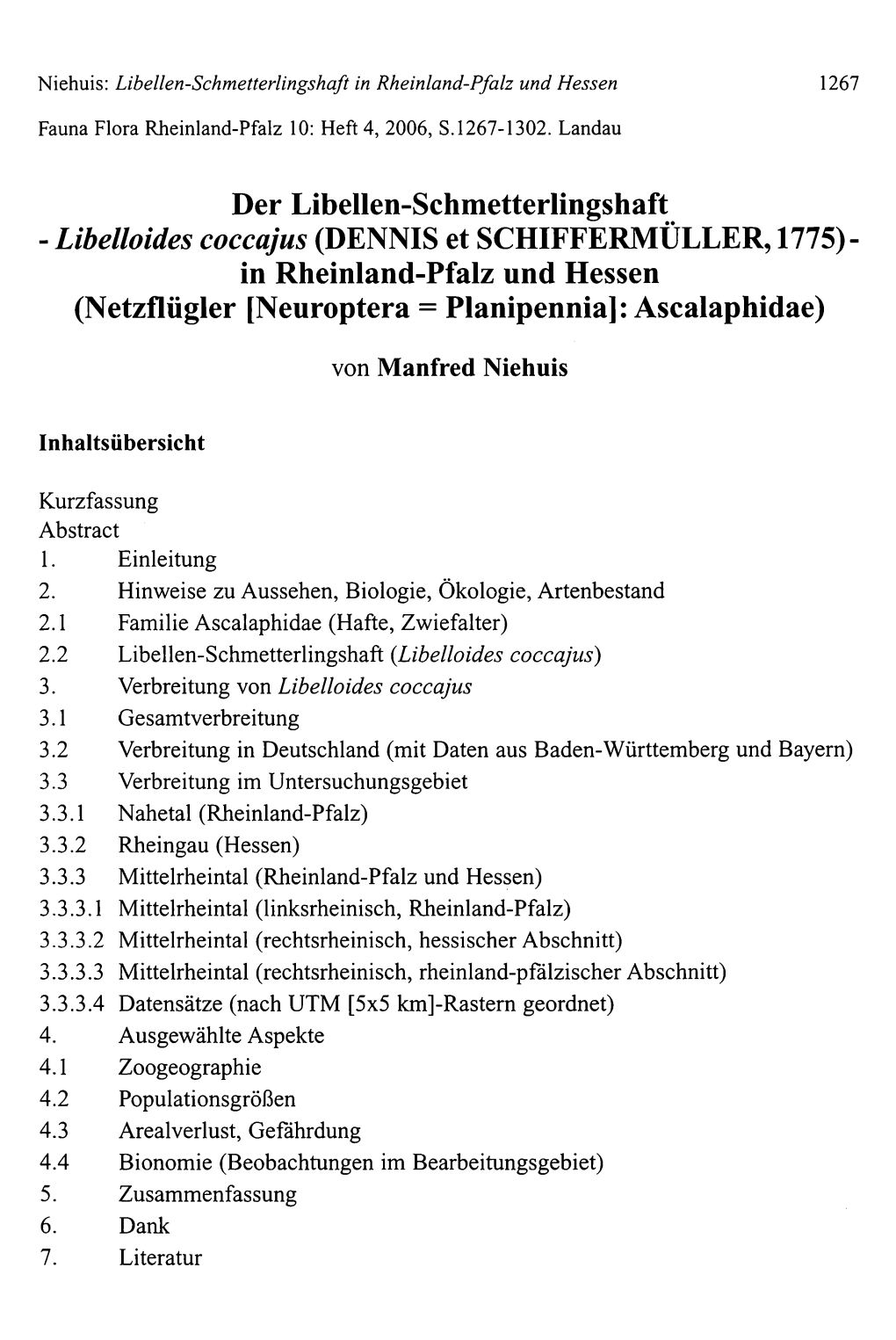
Load more
Recommended publications
-

Bntomojauna ZEITSCHRIFT FÜR ENTOMOLOGIE
© Entomofauna Ansfelden/Austria; download unter www.biologiezentrum.at Bntomojauna ZEITSCHRIFT FÜR ENTOMOLOGIE Band 1, Heft 14 ISSN O25O-4413 Linz, 15.Oktober 1980 Die Arten des Genus Libelloides Tjeder, 1972, der Iberischen Halbinsel (Neuroptera, Planipennia, Ascalaphidae). Täxonomie, Arealkunde, Phaenologie, Habltatwahl ( 3. Beitrag zur Kenntnis der Entomofauna der Iberischen Halbinsel) Eyjolf Aistleitner Abstract New data of distribution in Europe and especially in Spain, observations of phaenology, choice of habitat of the five species of the genus Libelloides TJEDER, 1972, and the description of four new subspecific taxa of Li- belloides longicornis (LINNE, 1764): boixolsius ssp.n., ramiroi ssp.n., aspoeckiaspoeckaegue ssp.n., penibeticus ssp.n. are the result of eight expanded journeys by the author and his family to the Iberian peninsula during the years 1969-1979. Maps of distribution, diagrams and plates are added. 234 © Entomofauna Ansfelden/Austria; download unter www.biologiezentrum.at Inhalt 1. Zusammenfassung 2. Belegmaterial, chorologische Daten und Danksagung 3. Systematischer Teil 3.1. Libelloides coccajus (DEN. et SCHIFF.) 3.2. Libelloides baeticus (RAMB.) 3.2.1. ssp. baeticus RAMB. 3.2.2. ssp. miegii comb.nov. 3.2.3.. ssp. cunii SELYS 3.3. Libelloides ictericus (CHARP.) 3.4. Libelloides hispanicus (RAMB.) 3.5. Libelloides longicornis (L.) 3.5.1. ssp. boixolsius ssp.nov. 3.5.2. ssp. ramiroi ssp.nov. 3.5.3. ssp. aspoeckiaspoeckaeque ssp.nov. 3.5.4. ssp. bolivari VAN DER WEELE 3.5.5. ssp. penibeticus ssp.nov. 3.5.6. Statistische Auswertung des 2ongicornis-Materials 3.5.7. Diagramme 3.5.8. Extra-iberische Funde 3.6. Übersicht zur Phaenologie 3.7. -
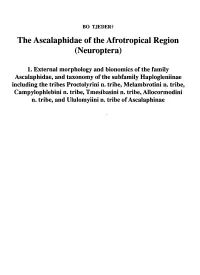
The Ascalaphidae of the Afrotropical Region (Neurop Tera)
The Ascalaphidae of the Afrotropical Region (Neuroptera) 1. External morphology and bionomics of the family Ascalaphidae, and taxonomy of the subfamily Haplogleniinae including the tribes Proctolyrini n. tribe, Melambrotini n. tribe, Campylophlebini n. tribe, Tmesibasini n. tribe, Allocormodini n. tribe, and Ululomyiini n. tribe of Ascalaphinae Contents Tjeder, B. T: The Ascalaphidae of the Afrotropical Region (Neuroptera). 1. External morphology and bionomics of the family Ascalaphidae, and taxonomy of the subfamily Haplogleniinae including the tribes Proctolyrini n. tribe, Melambro- tinin. tribe, Campylophlebinin. tribe, Tmesibasini n. tribe, Allocormodini n. tribe, and Ululomyiini n. tribe of Ascalaphinae ............................................................................. 3 Tjeder, B t &Hansson,Ch.: The Ascalaphidaeof the Afrotropical Region (Neuroptera). 2. Revision of the hibe Ascalaphini (subfam. Ascalaphinae) excluding the genus Ascalaphus Fabricius ... .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 17 1 Contents Proctolyrini n. tribe ................................... .. .................60 Proctolyra n . gen .............................................................61 Introduction .........................................................................7 Key to species .............................................................62 Family Ascalaphidae Lefebvre ......................... ..... .. ..... 8 Proctolyra hessei n . sp.......................................... 63 Fossils ............................. -

Research Article Selection of Oviposition Sites by Libelloides
Hindawi Publishing Corporation Journal of Insects Volume 2014, Article ID 542489, 10 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/542489 Research Article Selection of Oviposition Sites by Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775) (Neuroptera: Ascalaphidae), North of the Alps: Implications for Nature Conservation Markus Müller,1 Jürg Schlegel,2 and Bertil O. Krüsi2 1 SKK Landschaftsarchitekten, Lindenplatz 5, 5430 Wettingen, Switzerland 2 Institute of Natural Resource Sciences, ZHAW Zurich University of Applied Sciences, Gruental,8820W¨ adenswil,¨ Switzerland Correspondence should be addressed to Markus Muller;¨ [email protected] Received 27 November 2013; Accepted 18 February 2014; Published 27 March 2014 Academic Editor: Jose´ A. Martinez-Ibarra Copyright © 2014 Markus Muller¨ et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. (1) The survival of peripheral populations is often threatened, especially in a changing environment. Furthermore, such populations frequently show adaptations to local conditions which, in turn, may enhance the ability of a species to adapt to changing environmental conditions. In conservation biology, peripheral populations are therefore of particular interest. (2) In northern Switzerland and southern Germany, Libelloides coccajus is an example of such a peripheral species. (3) Assuming that suitable oviposition sites are crucial to its long-term survival, we compared oviposition sites and adjacent control plots with regard to structure and composition of the vegetation. (4) Vegetation structure at and around oviposition sites seems to follow fairly stringent rules leading to at least two benefits for the egg clutches: (i) reduced risk of contact with adjacent plants, avoiding delayed drying after rainfall or morning dew and (ii) reduced shading and therefore higher temperatures. -
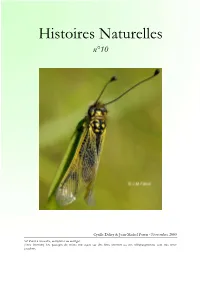
Libelloides Coccajus
Histoires Naturelles n°10 - Novembre 2009 Histoires Naturelles n°10 Cyrille Deliry & Jean-Michel Faton - Novembre 2009 !w! Point à résoudre, compléter ou corriger. [liens Internet] Les passages de textes renvoyant sur des liens Internet ou des téléchargements sont mis entre crochets. 1 Histoires Naturelles n°10 - Novembre 2009 Sur mon âme ! s'écria tout à coup Gringoire, nous sommes allègres et joyeux comme des ascalaphes ! Nous observons un silence de pythagoriciens ou de poissons ! Pasque-Dieu ! mes amis, je voudrais bien que quelqu'un me parlât. Notre-Dame de Paris (Victor Hugo) 2 Histoires Naturelles n°10 - Novembre 2009 HISTOIRE NATURELLE DES ASCALAPHES 1999-2009 - Diverses versions antérieures déposées sur le Web Villette de Vienne, le 7 novembre 2009 Les Ascalaphes sont apparentés à l’ordre des Neuroptères, comme les fourmilions et les chrysopes en raison des caractéristiques de l'appareil buccal des larves et de leurs ailes membraneuses armées de fortes nervures. Il existe 300 espèces d’Ascalaphidés dans le monde, une douzaine seulement réside dans la France méridionale. Leur aspect peut être considéré comme intermédiaire entre des Libellules et des Papillons, ce qui leur donne un charme tout particulier. Au repos, ils tiennent leurs ailes en toit, comme les Cigales. Ascalaphes de France Ordre Neuroptera Famille des Ascalaphidae Rambur, 1842 Sous-famille des Ascalaphinae Rambur 1842 Bubopsis Mac Lachlan 1898 o Bubopsis agrionoides (Rambur 1838) Delecproctophylla Lefebvre 1842 o Delecproctophylla australis (Fabricius 1787) o Delecproctophylla dusmeti (Navas 1914) Libelloides Tjeder 1972 Les noms scientifiques des Neuroptera ont été revus au niveau international en 1991. Ainsi le genre Ascalaphus semble réservé à des espèces américaines, le genre Libelloides concernant les espèces d’Europe. -

Evolution of Insect Color Vision: from Spectral Sensitivity to Visual Ecology
EN66CH23_vanderKooi ARjats.cls September 16, 2020 15:11 Annual Review of Entomology Evolution of Insect Color Vision: From Spectral Sensitivity to Visual Ecology Casper J. van der Kooi,1 Doekele G. Stavenga,1 Kentaro Arikawa,2 Gregor Belušic,ˇ 3 and Almut Kelber4 1Faculty of Science and Engineering, University of Groningen, 9700 Groningen, The Netherlands; email: [email protected] 2Department of Evolutionary Studies of Biosystems, SOKENDAI Graduate University for Advanced Studies, Kanagawa 240-0193, Japan 3Department of Biology, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenia; email: [email protected] 4Lund Vision Group, Department of Biology, University of Lund, 22362 Lund, Sweden; email: [email protected] Annu. Rev. Entomol. 2021. 66:23.1–23.28 Keywords The Annual Review of Entomology is online at photoreceptor, compound eye, pigment, visual pigment, behavior, opsin, ento.annualreviews.org anatomy https://doi.org/10.1146/annurev-ento-061720- 071644 Abstract Annu. Rev. Entomol. 2021.66. Downloaded from www.annualreviews.org Copyright © 2021 by Annual Reviews. Color vision is widespread among insects but varies among species, depend- All rights reserved ing on the spectral sensitivities and interplay of the participating photore- Access provided by University of New South Wales on 09/26/20. For personal use only. ceptors. The spectral sensitivity of a photoreceptor is principally determined by the absorption spectrum of the expressed visual pigment, but it can be modified by various optical and electrophysiological factors. For example, screening and filtering pigments, rhabdom waveguide properties, retinal structure, and neural processing all influence the perceived color signal. -

Rhein-Lahn-Kurier
Stadt Lahnstein Rhein-Lahn-Kurier Heimat- und Bürgerzeitung Jahrgang 58 FREITAG, 23. Oktober 2020 Nummer 43 voba-rll.de beraten Renditen Gut Mit Wertpapieren und Geldanlagen . der R+V für Ihr Vermögen. erwarten Auch in Zeiten niedriger Zinsen können Jetzt Termin Sie entspannt Vermögen aufbauen. Zum inbaren! Beispiel mit Geldanlagen bei unserem Ver- vere bundpartner R+V und Wertpapieren. Wir zeigen Ihnen wie. Nutzen Sie dazu unsere Genossenschaftliche Beratung, die Finanz- beratung, die erst zuhört und dann berät. Rhein-Lahn-Kurier 2 Nr. 43/2020 Notrufe / Bereitschaftsdienste POLIZEI LAHNSTEIN ZAHNÄRZTE Nordallee 3 Notruf ................................................................ 0180/5040308 Notruf ................................................................................. 110 Ansage des Notdienstes zu folgenden Zeiten: Telefon.................................................................. 02621/913-0 Freitag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr Fax ................................................................... 02621/913-100 Samstag von 8.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr Mittwoch von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr FREIWILLIGE FEUERWEHR an Feiertagen von 8.00 Uhr früh bis zum nachfolgenden Tag Notruf ................................................................................. 112 8.00 Uhr an Feiertagen mit einem Brückentag von Donnerstag 8.00 Uhr bis Samstag 8.00 Uhr SCHIEDSPERSON Weitere Informationen zum zahnärztlichen Notfalldienst kön- Lothar Fleck, Amselweg 1, 56112 Lahnstein nen Sie unter www.bzk-koblenz.de nachlesen. Eine Inan- -

Algunos Neurłpteros (Neuroptera: Ascalaphidae Y Nemopteridae) De La Colecciłn De Artrłpodos De Louriz˘N (Pontevedra, No España)
Boletín BIGA 16 (2018). ISSN: 1886-5453 PINO PÉREZ: ASCALAPHIDAE NEMOPTERIDAE: 69-72 ALGUNOS NEURŁPTEROS (NEUROPTERA: ASCALAPHIDAE Y NEMOPTERIDAE) DE LA COLECCIŁN DE ARTRŁPODOS DE LOURIZ˘N (PONTEVEDRA, NO ESPAÑA) 1 Juan José Pino Pérez 1 Departamento de Ecología y Biología Animal. Facultad de Biología. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende E-36310 Vigo (Pontevedra, España). (Recibido el 1 de marzo de 2018 aceptado el 10 de octubre de 2018) Resumen En esta nota aportamos la información de las etiquetas y otras fuentes de los ejemplares de Neuroptera (Ascalaphidae y Nemopteridae), depositados en la colección de artrópodos ABIGA, LOU-Arthr, del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra, Galicia, NO España). Palabras clave: Neuroptera, Ascalaphidae, Nemopteridae, colección ABIGA, colección LOU-Arthr, corología, Galicia, NO España. Abstract The present work gives information about the Neuroptera specimens deposited in the arthropod collection, ABIGA, LOU- Arthr, of the Centro de Investigación Forestal (CIF) of Lourizán (Pontevedra, NW Spain). Key words: Neuroptera, Ascalaphidae, Nemopteridae, ABIGA collection, LOU-Arthr collection, chorology, Galicia, NW Spain. INTRODUCCION1 portal http://www.gbif.org/, así como en la plataforma IPT (Integrated Publishing Tool-kit), disponible en Para Monserrat et al. (2014: 149), los ascaláfidos apenas http://www.gbif.es:8080/ipt/. tienen carácter antrópico y son por tanto buenos indicado- res del estado del ecosistema. En Galicia (NO España), es evidente que aquellas zonas con mayor densidad de pobla- MATERIAL Y MÉTODOS ción, las costeras en general, han perdido buena parte de Todos los ejemplares han sido recolectados mediante man- su biodiversidad debido al cambio en los usos del suelo y ga entomológica. -

Kopulation Und Sexualethologie Von Schmetterlingshaften
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Galathea, Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V. Jahr/Year: 2018 Band/Volume: 34 Autor(en)/Author(s): Mader Detlef Artikel/Article: Kopulation und Sexualethologie von Schmetterlingshaften, anderen Netzflüglern, Blutzikaden und anderen Zikaden sowie Addendum zu Hornisse, Delta- Lehmwespe und Mauer-Grabwespe 63-147 ©Kreis Nürnberger Entomologen; download unter www.zobodat.at gal athea Band 34 • Beiträge des Kreises Nürnberger Entomologen • 2018 • S. 63-147 Kopulation und Sexualethologie von Schmetterlingshaften, anderen Netzflüglern, Blutzikaden und anderen Zikaden sowie Addendum zu Hornisse, Delta-Lehmwespe und Mauer-Grabwespe DETLEF MADER Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis ..................................................................................................................................................... 63 Zusammenfassung ................................................................................................................................................... 66 Abstract .......................................................................................................................................................................... 66 Key Words .................................................................................................................................................................... 67 1 Kopulation und Sexualethologie -

Lacewings and Citizen Science in Italy: a Young but Very Promising Relationship
15 December 2019 Lacewings and Citizen science in Italy Lacewings and Citizen science in Italy: a young but very promising relationship Agostino Letardi ENEA, Lungotevere Thaon di Revel, 76, 00196 Roma, Italy; [email protected] Received 28th August 2018; revised and accepted 13th August 2019 Abstract. Citizen science is growing as a field of research with contributions from diverse disci- plines, promoting innovation in science, society, and policy. Citizen science platforms (i.e., iNat, https://www.inaturalist.org/) and capacity-building programmes foster the visibility of projects and establish networks for knowledge exchange within and among members of the citizen sci- ence community. Several recent events of citizen science in Italy (mainly by means of bioblitzes) have given a new perspective to the knowledge of Neuropterida in Italy. Introduction As a scientist, I have continuously been involved in training activities and in engag- ing the public in scientific subjects. Entomology, but more generally the dissemination of scientific knowledge, and social commitment have always been two sectors I have walked together. For this reason, one of the first objectives that I gave myself in the study of Neuropterida was to create a web site to disseminate information to an Italian audience: this web site (URL: http://neurotteri.casaccia.enea.it/), online since 2000, has been updated to 03.viii.2018. From the beginning, it has been perfectly clear to me that researchers benefit from using the Internet on a one-to-one basis (e-mail, File Transfer Protocol), a one-to-many basis (discussion groups, Internet conferences), and from ac- cessing large databases of knowledge (Young et al. -

A New Type of Neuropteran Larva from Burmese Amber
A 100-million-year old slim insectan predator with massive venom-injecting stylets – a new type of neuropteran larva from Burmese amber Joachim T. haug, PaTrick müller & carolin haug Lacewings (Neuroptera) have highly specialised larval stages. These are predators with mouthparts modified into venominjecting stylets. These stylets can take various forms, especially in relation to their body. Especially large stylets are known in larva of the neuropteran ingroups Osmylidae (giant lacewings or lance lacewings) and Sisyridae (spongilla flies). Here the stylets are straight, the bodies are rather slender. In the better known larvae of Myrmeleontidae (ant lions) and their relatives (e.g. owlflies, Ascalaphidae) stylets are curved and bear numerous prominent teeth. Here the stylets can also reach large sizes; the body and especially the head are relatively broad. We here describe a new type of larva from Burmese amber (100 million years old) with very prominent curved stylets, yet body and head are rather slender. Such a combination is unknown in the modern fauna. We provide a comparison with other fossil neuropteran larvae that show some similarities with the new larva. The new larva is unique in processing distinct protrusions on the trunk segments. Also the ratio of the length of the stylets vs. the width of the head is the highest ratio among all neuropteran larvae with curved stylets and reaches values only found in larvae with straight mandibles. We discuss possible phylogenetic systematic interpretations of the new larva and aspects of the diversity of neuropteran larvae in the Cretaceous. • Key words: Neuroptera, Myrmeleontiformia, extreme morphologies, palaeo evodevo, fossilised ontogeny. -

Bornich 30.03
15.03. Programm: 29.03. 20.00 Uhr 19.00 Uhr Eröffnung mit: Hermann-Josef- Maibach liest literasich bis lustig Kultur Peter - Rudolf - Stephan -Kossi im und Uwe heizen mit Rock die Winzerkeller Halle warm 16.03. ab 14.00 Uhr Eröffnung mit Schirmherr: Staatssekretär Günter Kern ( ISIM ) BORNICH 30.03. ab 14.00 Uhr Timo Krusch lädt ein zur 15.03. - 05.04.2014 Schinkenverkostung Wildes zum Verkosten mit Timo Krusch & Sa. ab 18.00 Uhr Horst Guth schnitz live Götz Neubauer So. 14.00-18.00 Uhr Horst Guth schnitz live 22.03. 19.00 Uhr Kulturmonat der Winzergenossenschaft Bornich es tanzen für Sie die „Oriental Diamonds“ und der Verbandsgemeinde Loreley Zauber - Max Schirmherr: Günter Kern für groß und klein mit orientalischem Staatssekretär im Ministerium des Buffet mit Innern und für Sport Werner Fingerle und 23.03 Kindertöpfern mit Almi Süß Alwine Fingerle ab 16.00 Uhr Drechseln mit Dietmar Lamm und Steffen Süß 05.04. 19.00 Uhr Bildhauerei mit Herman - Josef Maibach „Jiddischkeit“ ein lustiger Abend von und mit Tombola VerZAUBERSHOW mit Ordelia Lazar mit Stanislaus Spalis Sonntag Kaffee und Kuchen (nicht nur für die kleinen) Eintritt an allen Tagen frei! Tagen allen an Eintritt Unsere Künstlerinnen und Künstler Holzarbeiten Schmuck Dietmar Lamm - Drechseln Doris Klinkhammer Malerei Römerstr. 30 56357 Marienfels 06772 967536 Schmuck - Fotos -Skulpturen Edgar Defayay - Malerei - Zeichnungen aller Art Steffen Süß - Drechseln 56357 Reichenberg 06771 599349 Im Kaltenborn 4a 56357 Marienfels 06772 953213 Im Höms 10 56357 Lollschied 06772 960410 Veronika Maczey - Modeschmuck Jochen Erbach - sureale Kunst - Kalligraphie Horst Guth - Schnitzkunst Weinberg 19 56130 Bad Ems 02603 5183 56357 Reichenberg 06771 599349 Am kleinen Feldchen 21 56348 Bornich 06771 599172 Yvonne & Dominik Herhold Schmuckgestaltung Hermann-Josef Maibach 56348 Bornich Kirchgasse 89 06771 802255 Grafik - Gemälde - Bildhauerei Weben - Textilien Loreleyring 13 56346 St. -

Närrische Zeiten Beginnen in Bornich Schienenfräsen Kom- Men
Rhein-Lahn Post LOKALANZEIGER für die Stadt Lahnstein, VG Bad Ems-Nassau, VG Loreley und VG Nastätten 22. Januar 2020 • Woche 4 43. Jahrgang • Auflage 38 670 Die Marine begrüßt Stadt Lahnstein begrüßt Frauen in Winterpreise ARKISE RR-MARKISEN M PREISWERTER vom HERSTELLER N GmbH das neue Jahr das neue Jahr mit Empfang die Räte Paul-Spindler-Str. 5-7 PROFI-MONTAGEN - Neubespannungen Nastätten Unsere Ausstellung ist nur nach Marinekameradschaft Admiral Mischke Lahnstein Überlegungen zur Schaffung des Kur- und Heilwaldes Schüler fühlen sich fit Terminvereinbarung geöffnet! 06772-960994 veranstaltet Empfang S. 3 waren ein Schwerpunktthema S. 4 für die Kommunalpolitik S. 7 www.Markisenfabrik.com Aus der Region Gut zu wissen . Hungrig nach Nach der Schule in die Schule: Fast Food Freiwilliges Soziales Jahr wartet KOBLENZ. -ots- Zwei „Natur als Quelle KREIS. Vielfältige Aufga- junge „Ausreißer“ (10 benfelder, spannende Ein- und 11 Jahre) wurden blicke in das Berufsfeld von der Fahndungs- der Inspiration – Schule und ein Jahr zur gruppe der Bundes- persönlichen Orientierung polizei im Hauptbahn- bietet das FSJ an Ganz- hof Koblenz in Ge- Waldszenen, Erlkönig!“ tagsschulen in Rheinland- wahrsam genommen. Pfalz. An Schulen im Kreis Die beiden Freundin- Bad Ems ist ein solches nen waren ohne Wis- Freiwilliges Soziales Jahr sen ihrer Eltern mit dem mit Start zum August 2020 Zug von Bad Ems nach (teilweise auch zum April 2020) möglich. Nach der eige- Koblenz gefahren, um nen Schullaufbahn ermöglicht das FSJ Ganztagsschule, in einem amerikani- die Perspektive zu wechseln und die Prozesse auf der an- schen Schnellrestau- deren Seite der Schulbank mit zu gestalten, um Einblicke rant zu essen.