Die Wahrnehmung Der Ratte in Der Geschichte Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

TMNT Instant Quote Form
Brian's Toys TMNT Buy List Playmates Toys Quantity Year Buy List Name Line Series Class Mfr Number UPC you have TOTAL Notes Released Price to sell Last Updated: April 14, 2017 Questions/Concerns/Other Full Name: Address: Delivery Address: W730 State Road 35 Phone: Fountain City, WI 54629 Tel: 608.687.7572 ext: 3 E-mail: Referred By (please fill in) Fax: 608.687.7573 Email: [email protected] Brian’s Toys will require a list of your items if you are interested in receiving a price quote on your collection. It is very important that we have an accurate description of your items so that we can give you an accurate price quote. By following the below format, you will help Guidelines for ensure an accurate quote for your collection. As an alternative to this excel form, we have a webapp available for http://buylist.brianstoys.com/lines/TMNT/toys . Selling Your Collection The buy list prices reflect items mint in their original packaging. Before we can confirm your quote, we will need to know what items you have to sell. The below items are listed by Halo category. The list is compiled to the best of our ability with the information we've obtained. Therefore, accuracy cannot be guaranteed, but information will be updated in future updates. STEP 1 Search for each of your items and mark the quantity you want to sell in the column with the red arrow. STEP 2 Once the list is complete, save this as an excel sheet and e-mail to [email protected]. -

The Teenage Mutant Ninja Turtles and Other Supporting Characters Are Adapted from the Comic Books
COMPATIBLE WITH . Heroes Unlimited Ninjas & Superspies and other Palladium RPGs 1 . Vega e Ren d an a Siembied n Kevi , world e th n i s master e gam t greates o tw e th o t d dedicate s i k wor s Thi Eighth Printing — March 1989 . Convention t Copyrigh l Universa e th r unde d reserve s right l Al . Siembieda n Kevi y b 5 198 © t Copyrigh No part of this book may be reproduced in part or whole, in any form or by any means, without permission from the publisher, except for brief quotes for use in reviews. All incidents, situations, institutions, s person r o s character f o , intent c satri t withou , similarity y an d an l fictiona e ar e peopl d an s government living or dead is strictly coincidental. n Eastma n Kevi 5 198 © t Copyrigh t Ar r Cove Interior Art and Illustrations © 1985 Peter Laird and Kevin Eastman . Studios e Mirag y b d owne k trademar d registere a s i . T.M.N.T Palladium Books is a registered trademark owned by Kevin Siembieda. , Shredder , Foot e th , Splinter , Michaelangelo) , Donatello , Leonardo , (Raphael s Turtle a Ninj t Mutan e Teenag April O'Neil, Baxter Stockman, Casey Jones, T.C.R.I. Aliens and Triceraton are copyrights and trademarks . Books m Palladiu y b e licens r unde d use d an d Lair r Pete d an n Eastma n Kevi f o . Siembieda n Kevi y b 8 198 , 1987 , 1986 , 1985 , 1984 , 1983 © t Copyrigh , Group s Comic l Marve d an . -

Leonardo Leonardo (Secret)
LEONARDO LEONARDO (SECRET) SOLO 8 Disciplined PP 4 BUDDY 6 Honor Of A Samurai OR 8 +1PP TEAM 10 We Work As A Team P H NINJA TURTLE LEADER Y 8 Enhanced Durability Enhanced Reflexes8 Enhanced Stamina 8 S 8 I Mystic Sense6 Psychic Resistance C SFX: Focus. If a pool contains a Ninja Turtle Leader power, you may replace two dice of the same size A with one die +1 step larger. SFX: Meditation. Add Psychic Resistance to your dice pool when helping yourself or others recover Emotional L Stress. Spend 1 PP to recover your own or another’s Emotional Stress or step back your own or another's Emotional Trauma by -1. Limit: Exhausted. Shutdown any Ninja Turtle Leader power to gain 1 PP. Recover power by activating an Opportunity or during a Transition Scene. M KATANA NINJITSU E 8 Enhanced Durability Weapons8 N SFX: Area Attack. Add a D6 and keep an additional Effect Die for each additional target. T SFX: Riposte. On a reaction against a Physical Stress attack action, inflict Physical Stress with your Effect Die at A no PP cost or spend a PP to step up the damage by +1. SFX: Unleashed. Step up or double any Katana Ninjutsu power for one action. If the action fails, add a die L to the Doom Pool equal to the normal rating of the power die. Limit: Gear. Shutdown Katana Ninjutsu and gain 1 PP. Take an action versus the Doom Pool to recover. E Acrobatic Expert 8 Combat Expert 8 Covert Master 10 M O 8 8 8 Crime Expert Menace Expert Psych Expert T I O SPLINTER'S PRIZE STUDENT 1 XP when you make a tactical decision based on what you think Splinter would want you to do. -
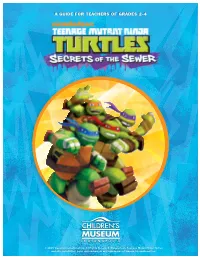
A Guide for Teachers of Grades 2–4
A GUIDE FOR TEACHERS OF GRADES 2–4 © 2015 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, Teenage Mutant Ninja Turtles and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. Exhibit produced by The Children’s Museum of Indianapolis in collaboration with Nickelodeon The Children’s Museum of Indianapolis is a nonprofit institution dedicated to creating extraordinary learning experiences across the arts, sciences, and humanities that have the power to transform the lives of children and families. It is the largest children’s museum in the world and serves more than 1 million people across Indiana as well as visitors from other states and nations. The museum provides special programs and experiences for students as well as teaching materials and profes- sional development opportunities for teachers. To plan a visit or learn more about educational programs and resources, visit the Teacher section of the museum’s website at childrensmuseum.org. VISIT THE MUSEUM The museum provides special programs and experiences for students as well as teaching materials and professional development opportunities for teachers. To plan a visit or learn more about educational programs and resources, visit the Teacher section of the museum’s website at childrensmuseum.org. © 2016 THE CHILDREN’s MusEUM OF INDIANAPOLIS TaBlE oF CoNtEnTs Introduction ..................4 Experience 1: Communication Is Key ........6 Experience 2: Personal Strengths ........10 Experience 3: Team “Building” ...........13 Culminating experience: Better together .....17 Resources ....................18 Academic standards ...............19 TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: SECRETS OF THE SEWER • A GUIDE FOR TEACHERS OF GRADES 2–4 3 Introduction The Exhibit In this exhibit, visitors will have the opportunity to explore the world of the Teenage Mutant Ninja Turtles— Leonardo, Donatello, Raphael, and Michelangelo—through immersive environments representing their sewer lair and the streets of New York, where they patrol to keep the city safe from evil. -

Michelangelo Michelangelo (Secret)
MICHELANGELO MICHELANGELO (SECRET) SOLO 6 Booyakasha! PP BUDDY 10 Conoscitore Di Pizza 4 OR 8 +1PP TEAM 8 Not The Sharpest Weapon On The Rack P H GO NINJA GO NINJA GO! Y 8 Enhanced Durability Enhanced Reflexes8 Enhanced Stamina 8 S 8 I Gourmet Sense6 Psychic Resistance C SFX: Second Chance. Spend 1 PP to reroll when using any Go Ninja Go Ninja Go power. A SFX: On The Scent. Add a D6 and step up the Effect Die by +1 when using Gourmet Sense to create Assets. SFX: Turtle May Care. Shutdown Enhanced Durability to step up or double Enhanced Reflexes for one L action. Recover Enhanced Durability by activating an Opportunity or during a Transition Scene. Limit: Exhausted. Shutdown any Go Ninja Go Ninja Go power to gain 1 PP. Recover power by activating an Opportunity or during a Transition Scene. NUNCHUCK NINJITSU M E 8 8 Enhanced Durability Weapons N SFX: Area Attack. Add a D6 and keep an additional Effect Die for each additional target. T SFX: Bounceback. On a reaction against a Physical Stress attack action, inflict Physical Stress with your Effect Die at no PP cost or spend a PP to step up the damage by +1. A SFX: Overly Confident. Step down Enhanced Durability by -1 for one action in order to double Weapons for that L action. Limit: Gear. Shutdown Nunchuck Ninjutsu and gain 1 PP. Take an action versus the Doom Pool to recover. E Acrobatic Master 10 Combat Expert 8 Covert Expert 8 M O 10 8 Psych Master Vehicle Expert T I O LABEL MAKER 1 XP when you encounter a new enemy and come up with a ‘perfect’ name for that enemy. -

Mike Elliott • Eric M. Lang
COMPONENTS • 92 Custom Dice 12 Basic Action Dice (3 in each of 4 different colors) 48 Character Dice (2 in each of 8 types) 32 Sidekick Dice (white) • 62 Cards 48 Character Cards (3 versions Mike Elliott • Eric M. Lang for each of the 15 characters; Sidekicks have no cards) In Teenage Mutant Ninja Turtles Dice Masters, 10 Basic Action Cards two or four players take on the role of masterminds 4 Color Reminder Cards directing the actions of a team of powerful super heroes (represented by dice) to battle each other! • 1 Dice Masters Core Rulebook Each turn, you roll your dice to see what resources • 4 Paper Playmats you have available, buy more dice, send your team • 4 Dice Bags members into the field, and then strike at the enemy mastermind. Reduce the opposing mastermind’s life to zero, and save the day! There are multiple cards available Additional cards and dice to expand your team for each character die; you can can be found in foil packs — ask your retailer! High- choose which one you want to use! quality playmats are also available for purchase, or This lets you specialize your dice to you can download one from dicemasters.com and suit your play style. print it out yourself. QUICK START Ready for awesome TMNT action? Hope so! It’s a smack-down in the city — and you’re in the middle of it! Set up Player 1’s heroes, Player 2’s Only Player 2 can heroes, and the Basic Action Cards buy these dice shown here: Player 2 Player 1 For card anatomy, Only Player 1 can see page 7. -
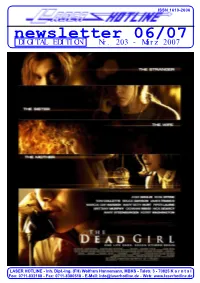
Newsletter 06/07 DIGITAL EDITION Nr
ISSN 1610-2606 ISSN 1610-2606 newsletter 06/07 DIGITAL EDITION Nr. 203 - März 2007 Michael J. Fox Christopher Lloyd LASER HOTLINE - Inh. Dipl.-Ing. (FH) Wolfram Hannemann, MBKS - Talstr. 3 - 70825 K o r n t a l Fon: 0711-832188 - Fax: 0711-8380518 - E-Mail: [email protected] - Web: www.laserhotline.de Newsletter 06/07 (Nr. 203) März 2007 editorial Hallo Laserdisc- und DVD-Fans, spielsweise den von uns in einer vori- liebe Filmfreunde! gen Ausgabe angesprochenen BUBBA Wir gehen zum Es ist vollbracht! In einer harten HO-TEP. So, aber jetzt räumen wir WIDESCREEN Nachtschicht ist es uns gelungen, Aus- das Feld um noch rechtzeitig unsere WEEKEND gabe 203 unseres Newsletters noch Koffer zu packen und Ihnen genügend rechtzeitig vor unserer Abreise nach Gelegenheit zu geben, sich durch die nach Bradford! Bradford unter Dach und Fach zu brin- Massen von amerikanischen Releases gen. Und wie bereits angekündigt ent- zu wühlen. Übrigens gelten für alle hält diese Ausgabe nur die amerikani- Vorankündigungen selbstverständlich Daher bleibt unser schen Releases, die für die nächsten wieder unsere Pre-Order-Preise, sofern Geschäft in der Zeit vom Wochen angekündigt sind. Wer also uns Ihre Bestellung spätestens eine 15. März 2007 nur an deutscher DVD-Kost interes- Woche vor dem amerikanischen Erst- siert ist, der darf diesen Newsletter verkaufstag vorliegt. Noch Fragen? Ab bis einschließlich getrost beiseite legen. Es sei denn, Sie dem 22. März sind wir wieder in ge- 21. März 2007 möchten jetzt schon wissen, was wir wohnter Weise für Sie da. zukünftig als deutsche Veröffentlichun- geschlossen. gen erwarten dürfen. Denn die Erfah- Ihr LASER HOTLINE Team rung lehrt uns, dass die Amerikaner Wir bitten um Beachtung meist nur ein paar Wochen früher mit den Titeln auf den Markt stürmen als und danken für Ihr die europäischen Vermarkter. -

Link De Descarga: Dossier Especial Las Tortugas Ninja
ECC Ediciones da la bienvenida a Raphael, Michelangelo, Donatello y Leonardo. ¡Las Tortugas Ninja! Los héroes de medio caparazón que cautivan al mundo desde los años ochenta han protagonizado sonadas apariciones en películas de imagen real, series de animación, videojuegos y merchandising variado. Pero el origen de este fenómeno de la cultura popular fruto de la imaginación de Kevin Eastman y Peter Laird se remonta al mundo del cómic, medio en el que se han narrado sus aventuras a través de diferentes cabeceras orientadas a todo tipo de lectores. En diciembre publicaremos nuestros dos primeros lanzamientos de esta esperada licencia. Y ambos títulos son representativos de la variedad y la riqueza de una franquicia con casi cuatro décadas de historia a sus espaldas. En primer lugar, Las Tortugas Ninja: La serie original vol. 1 (de 6) dará inicio a una edición con la que recopilaremos la etapa inicial de los personajes –publicada en blanco y negro por Mirage Studios–, en la que Eastman y Laird sentaron las bases de su rica mitología. Cada volumen en tapa dura incluirá comentarios de los autores revelando anécdotas y detalles sobre el proceso creativo de las entregas recopiladas, y contendrá una sección final a todo color con las portadas originales. En segundo lugar, Las Tortugas Ninja vol. 1, primera entrega de la actual colección, que, iniciada en 2011 por IDW y recibida con entusiasmo por la crítica y los lectores, sumerge a los cuatro protagonistas en una sucesión de aventuras trepidantes narradas a través de un enfoque más contemporáneo. Liderada por el propio Eastman –quien hace las veces de guionista y asesor–, esta serie también cuenta en su equipo creativo con el talento de Tom Waltz o Sophie Campbell, autores habituales del mercado independiente estadounidense, y con dibujantes de la talla de Dan Duncan, Andy Khun, Freddie E. -
Mutant Origin: Michelangelo/Raphael (Teenage Mutant Ninja Turtles) Free
FREE MUTANT ORIGIN: MICHELANGELO/RAPHAEL (TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES) PDF Prof Michael Teitelbaum,Random House | 128 pages | 07 Aug 2012 | Random House USA Inc | 9780449809945 | English | New York, United States Mutant Origin: Michelangelo/Raphael (Teenage Mutant Ninja Turtles) - Teenage Mutant Ninja Turtles Michelangelonicknamed Mike or Mikeyis a fictional superhero and one of the four main characters of the Teenage Mutant Ninja Turtles comics and all related media. He is usually Mutant Origin: Michelangelo/Raphael (Teenage Mutant Ninja Turtles) wearing an orange eye mask. His signature weapons are dual nunchakuthough he has also been portrayed using other weapons, such as a grappling hookmanriki-gusaritonfaand a three-section staff in some action figures. Michaelangelo is the most naturally skilled of his four brothers. But prefers having a good time than training. More fun-loving than his brothers, Michelangelo was given a much bigger role in the cartoon seriesdirected at a younger audience, than in the more serious original comic books [3] which were aimed at an older audience. He often coins most of their catchphrases, such as "Cowabunga! Like all of the brothers, he is named after a Renaissance artist; in this case, he is named after Michelangelo Buonarroti. The spelling of the character's name varies from source to source, and he has been alternately shown as both Michelangelo and Michaelangelo. In these original comic booksMichelangelo was initially depicted as fun-loving, carefree, and, while not as aggressive as Raphaelalways ready to fight. He is much more serious-natured in the comic book than in the film incarnations, which have labeled his character a Mutant Origin: Michelangelo/Raphael (Teenage Mutant Ninja Turtles) "dude" talking teenager. -

This Is Soul Calibur the Real One Though Eliwood Royark Chase
this is Soul Calibur the real one though Eliwood Royark Chase(Hector), beast? vegeta? I don’t know, no, it’s Chase, from sword of truth? uhm, no a kid Serra Priscilla Erk (duh though, he gods that game, and, serra also, has a weapon, it’s soul calibur) kid though, Roy is young too, his father though, check bull, youngest you’ve ever seen them, all settings, there Uther now, check, check, it’s happening now, the strategist is live, Eliwood had a name, for your quarters, you get it? he is a lord, called Eliwood, to you he’s been Elijah Wood, hi, I’m Roy Uther, is Serra’s father, Liam Neeson Tarzan(his too, young, cool) Hercules(greatswords one handed, youth, small, not, but lean, or, lithe? lean, Hercules, he can, one hand a greatclub,, so yeah) Rapunzel (gwenevere his wife, no, she isn’t under capture, but her hiar looks good long) Sain (lancelot) Kent (cool kid) Lyn (god she’s cool, if, Bella, was Elaina, hunting and killing, Cullen, a jiang jai shi, Jeremy’s Jasper and) Rath Catarina (yeah, miley cyrus though, so that’s right, Lynn, is cooler, than the chick who played her on tv, catherine) she’s my dancer though, Lyn is, I’ll kill you, so fucking fast... she wins a lot, at love and nevermind, look, more I’m Simba though, blonde, love, baby, worlds, on, and, life, game, set, love Priscilla’s Nala, yes, I have a dancer, Nala’s my wife, and blonde, you get her right really fast, this game’s, mega existing.. -

Teenage Mutant Ninja Turtles
Contents Articles Teenage Mutant Ninja Turtles (1987 TV series) 1 Teenage Mutant Ninja Turtles (1987 TV series) (season 1) 13 Teenage Mutant Ninja Turtles (1987 TV series) (season 2) 15 Teenage Mutant Ninja Turtles (1987 TV series) (season 3) 18 Teenage Mutant Ninja Turtles (1987 TV series) (season 4) 24 Teenage Mutant Ninja Turtles (1987 TV series) (season 5) 29 Teenage Mutant Ninja Turtles (1987 TV series) (season 6) 33 Teenage Mutant Ninja Turtles (1987 TV series) (season 7) 36 Teenage Mutant Ninja Turtles (1987 TV series) (season 8) 41 Teenage Mutant Ninja Turtles (1987 TV series) (season 9) 43 Teenage Mutant Ninja Turtles (1987 TV series) (season 10) 45 References Article Sources and Contributors 47 Image Sources, Licenses and Contributors 48 Article Licenses License 49 Teenage Mutant Ninja Turtles (1987 TV series) 1 Teenage Mutant Ninja Turtles (1987 TV series) Teenage Mutant Ninja Turtles Genre Action/Adventure Science fiction Comedy Martial arts Format Animated series Created by Kevin Eastman Peter Laird Fred Wolf Developed by David Wise Directed by Yoshikatsu Kasai (season 1) Bill Wolf (seasons 2–7) Tony Love (seasons 8–10) Voices of Cam Clarke Townsend Coleman Barry Gordon Rob Paulsen Michael Gough Peter Renaday Renae Jacobs Pat Fraley James Avery Jim Cummings Tony Jay Theme music composer Chuck Lorre Dennis C. Brown Country of origin United States No. of seasons 10 No. of episodes 193 (List of episodes) Production Executive producer(s) Fred Wolf Kevin Eastman Peter Laird Producer(s) Rudy Zamora (season 1) Walt Kubiak Andy Luckey -

Mcgill a Questions By: Ambuj Dewan, Mike Engle, Stuart Locke
2010 Hybrid Tournament: McGill A Questions by: Ambuj Dewan, Mike Engle, Stuart Locke Tossups 1. While serving on the Sixth Circuit, he presided over a case that determined that Cowles Electric Smelting infringed on the patent for the Hall process, which ultimately led to Alcoa becoming the only aluminium producer in the US in 1893. He also made a decision in the Addyston Pipe and Steel antitrust case shortly before moving to a political career. As (*) Secretary of War, he signed an eponymous agreement with Japan that recognized their influence in Korea and America’s sphere over the Philippines, where he had earlier served as governor. Ending his career as Chief Justice of the Supreme Court, for 10 points, name this man who welcomed Arizona and New Mexico as states while serving as President between Roosevelt and Wilson. ANSWER: William Howard Taft 2. A play-by-play commentator associated with this name made calls like “top shelf, where mama hides the cookies!” and “May day! May day!” Upon their expansion entry, this NHL team wore socks with a triple-triple stripe pattern, mimicking that of the Toronto Maple Leafs. Their first pick in the amateur draft was the first Quebecois player for whom the Montreal Canadiens did not have exclusive initial rights, (*) Gilbert Perreault. Past captains include Pat LaFontaine, Michael Peca and current coach Lindy Ruff. For ten points, identify the home team of the first Winter Classic on American soil and the victim of Brett Hull’s 1999 Stanley Cup-winning goal in the crease, a hockey team that plays out of HSBC Arena near the Canadian border.