Lepidoptera Hesperiidae
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
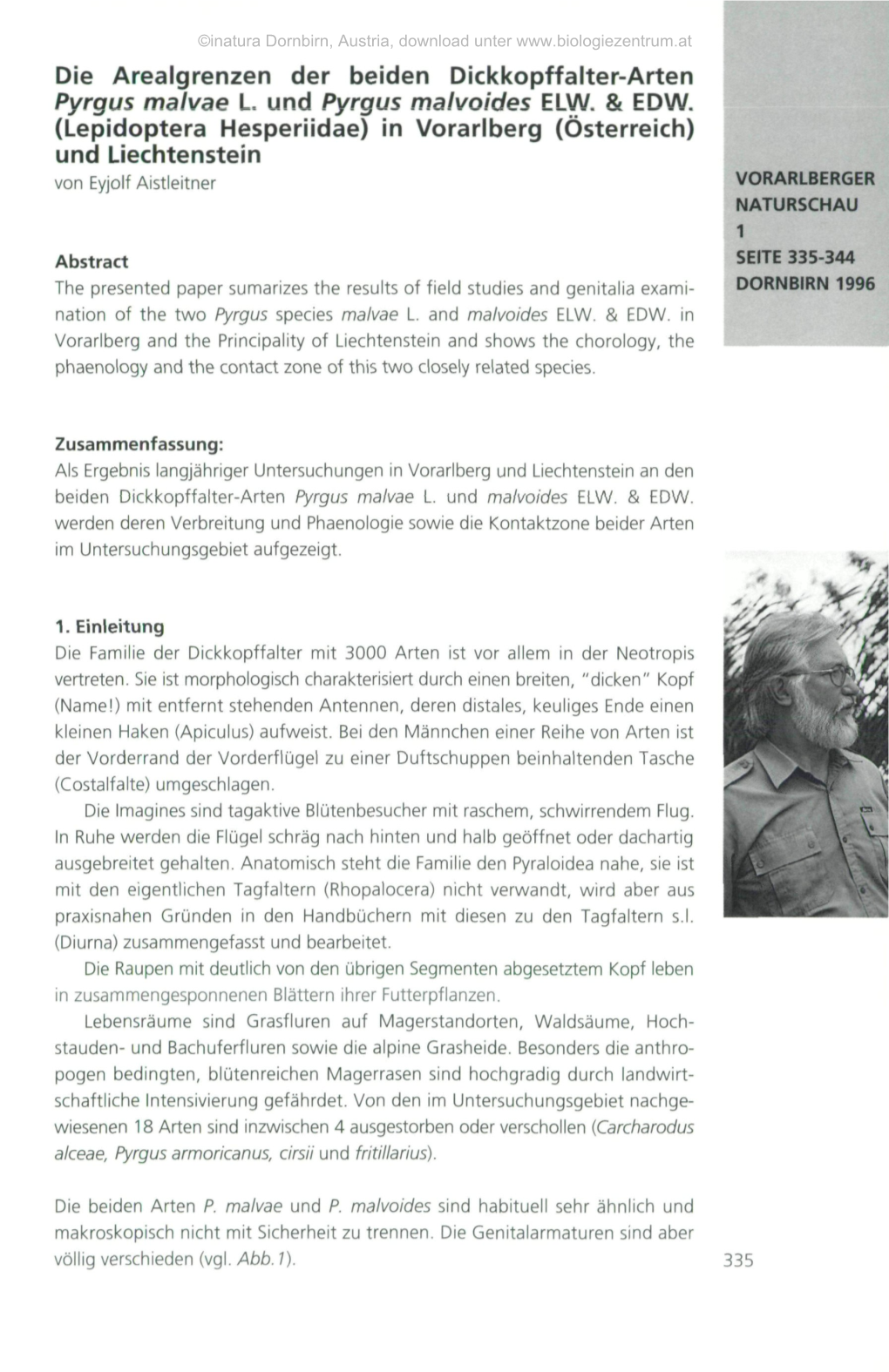
Load more
Recommended publications
-

Tuscany in Spring
Tuscany in Spring Naturetrek Tour Report 25 April – 2 May 2019 Daphne sericea Ophrys sphegodes Chrysosplenium alternifolium Lobster Moth Report and Images by Paul Harmes Naturetrek Wolf’s Lane Chawton Alton Hampshire GU34 3HJ UK T: +44 (0)1962 733051 F: +44 (0)1962 736426 E: [email protected] W: www.naturetrek.co.uk Tour Report Tuscany in Spring Tour Participants: Paul Harmes (leader) with four Naturetrek clients Day 1 Thursday 25th April Pisa – San Gimignano - Alberese. Three tour members met with Paul at Heathrow’s Terminal 5 for the 8.25am British Airways flight BA0602, to Pisa, Galileo Galilei Airport. Upon arrival, we quickly completed immigration formalities, collected our luggage and made our way out to the Arrivals hall, where we met with Gil, who had made his own way to Pisa. We now took the shuttle bus to the car rental area, where we collected our minibus. Joining the main Pisa to Florence motorway east towards Empoli, we then turned south, heading for San Gimignano. As we went, we saw Black Kite, Barn Swallow and Grey Heron, and many of the verges were red with patches of Hedysarum coronarium (Italian Sainfoin). We also spotted a small group of four Fallow Deer. A light lunch was taken at a service area. We spent an hour and a half exploring the medieval walled town of San Gimignano, before continuing past Siena and joining the E80 south towards Grosseto. Jackdaws and Starlings were noted as we went. Passing Grosseto, we left the road at Alberese and soon arrived at the lovely comfortable La Fattoria Il Duchesco, our base for the next five nights, where we were met by our host, Fabio. -

Révision Taxinomique Et Nomenclaturale Des Rhopalocera Et Des Zygaenidae De France Métropolitaine
Direction de la Recherche, de l’Expertise et de la Valorisation Direction Déléguée au Développement Durable, à la Conservation de la Nature et à l’Expertise Service du Patrimoine Naturel Dupont P, Luquet G. Chr., Demerges D., Drouet E. Révision taxinomique et nomenclaturale des Rhopalocera et des Zygaenidae de France métropolitaine. Conséquences sur l’acquisition et la gestion des données d’inventaire. Rapport SPN 2013 - 19 (Septembre 2013) Dupont (Pascal), Demerges (David), Drouet (Eric) et Luquet (Gérard Chr.). 2013. Révision systématique, taxinomique et nomenclaturale des Rhopalocera et des Zygaenidae de France métropolitaine. Conséquences sur l’acquisition et la gestion des données d’inventaire. Rapport MMNHN-SPN 2013 - 19, 201 p. Résumé : Les études de phylogénie moléculaire sur les Lépidoptères Rhopalocères et Zygènes sont de plus en plus nombreuses ces dernières années modifiant la systématique et la taxinomie de ces deux groupes. Une mise à jour complète est réalisée dans ce travail. Un cadre décisionnel a été élaboré pour les niveaux spécifiques et infra-spécifique avec une approche intégrative de la taxinomie. Ce cadre intégre notamment un aspect biogéographique en tenant compte des zones-refuges potentielles pour les espèces au cours du dernier maximum glaciaire. Cette démarche permet d’avoir une approche homogène pour le classement des taxa aux niveaux spécifiques et infra-spécifiques. Les conséquences pour l’acquisition des données dans le cadre d’un inventaire national sont développées. Summary : Studies on molecular phylogenies of Butterflies and Burnets have been increasingly frequent in the recent years, changing the systematics and taxonomy of these two groups. A full update has been performed in this work. -

Elevational Gradient and Human Effects on Butterfly Species Richness in the French Alps
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by AIR Universita degli studi di Milano Received: 9 November 2016 | Revised: 12 January 2017 | Accepted: 14 January 2017 DOI: 10.1002/ece3.2803 ORIGINAL RESEARCH Elevational gradient and human effects on butterfly species richness in the French Alps Arnaud Gallou1 | Yann Baillet2 | Gentile Francesco Ficetola1,3 | Laurence Després1 1Laboratoire d’Ecologie Alpine UMR5553, Université Grenoble-Alpes, CNRS, Abstract Grenoble, France We examined how butterfly species richness is affected by human impact and eleva- 2 Flavia, A.P.E. Association pour l’Etude des tion, and how species ranges are distributed along the elevational gradient (200– Papillons, Trept, France 2700 m) in the Isère Department (French Alps). A total of 35,724 butterfly observations 3Department of Biosciences, Universita degli Studi di Milano, Milano, Italy gathered in summer (May–September) between 1995 and 2015 were analyzed. The number of estimated species per 100- m elevational band was fitted to the elevational Correspondence Laurence Després, Laboratoire d’Ecologie gradient using a generalized additive model. Estimations were also performed on a Alpine, UMR5553 UGA, Grenoble, France. 500 m × 500 m grid at low altitude (200–500 m) to test for the human impact on spe- Email: laurence.despres@univ-grenoble-alpes. fr cies richness using generalized least squares regression models. Each species eleva- tional range was plotted against the elevational gradient. Butterfly richness along the Funding information Pôle Biodiversité of the Conseil elevational gradient first increased (200–500 m) to reach a maximum of 150 species at Départemental de l’Isère. -

The Status and Distribution of Mediterranean Butterflies
About IUCN IUCN is a membership Union composed of both government and civil society organisations. It harnesses the experience, resources and reach of its 1,300 Member organisations and the input of some 15,000 experts. IUCN is the global authority on the status of the natural world and the measures needed to safeguard it. www.iucn.org https://twitter.com/IUCN/ IUCN – The Species Survival Commission The Species Survival Commission (SSC) is the largest of IUCN’s six volunteer commissions with a global membership of more than 10,000 experts. SSC advises IUCN and its members on the wide range of technical and scientific aspects of species conservation and is dedicated to securing a future for biodiversity. SSC has significant input into the international agreements dealing with biodiversity conservation. http://www.iucn.org/theme/species/about/species-survival-commission-ssc IUCN – Global Species Programme The IUCN Species Programme supports the activities of the IUCN Species Survival Commission and individual Specialist Groups, as well as implementing global species conservation initiatives. It is an integral part of the IUCN Secretariat and is managed from IUCN’s international headquarters in Gland, Switzerland. The Species Programme includes a number of technical units covering Species Trade and Use, the IUCN Red List Unit, Freshwater Biodiversity Unit (all located in Cambridge, UK), the Global Biodiversity Assessment Initiative (located in Washington DC, USA), and the Marine Biodiversity Unit (located in Norfolk, Virginia, USA). www.iucn.org/species IUCN – Centre for Mediterranean Cooperation The Centre was opened in October 2001 with the core support of the Spanish Ministry of Agriculture, Fisheries and Environment, the regional Government of Junta de Andalucía and the Spanish Agency for International Development Cooperation (AECID). -

A FINAL with Revise
Identification Guide to the Pyrgus Group of Grizzled Skippers in Europe European Butterflies Group Identification Guide to the Pyrgus Group of Grizzled Skippers in Europe Bill Raymond and Roger Gibbons For more information on all aspects of European butterflies please go to european-butterflies.org.uk The other free to download guides in this series are available at EBG Identification Guides How to use this Guide I Introduction Please read the Introduction on page I which gives some background to the difficulties of Pyrgus identification. II List of Species The sixteen species of Pyrgus found in Europe and covered by this guide are listed on page II. If you wish to go direct to a Species Description click here to go to the list. III Is it Pyrgus? Use the guide on page III to ensure that your butterfly is a Pyrgus and not one of the similar looking species. Explanation of An explanation of the terms used in this guide to describe wing markings is given on page IV. Links back to this IV Terms used page Terms are included on each Species Description page. For simplicity we have used the scientific species name in the text to avoid unwieldy repetition of the common English names, and in some instances we have not strictly followed the scientific conventions on the use of italics in the interests of readability. Quick Upperside For a definitive identification of many Pyrgus it is usually necessary to have a view of both upper and underside. V Identification Key To help narrow down the possibilities start with the Quick Upperside Identification Key on page V. -

A Tribute to Jules Pierre Rambur (1801-1870)
94 entomologische berichten 76 (3) 2016 A tribute to Jules Pierre Rambur (1801-1870) Rienk de Jong KEY WORDS Hesperiidae, genitalia, identification Entomologische Berichten 76 (3): 94-98 As early as 1839, the French medical doctor Rambur published the first drawings of genitalia of Hesperiidae (Lepidoptera), probably the first of Lepidoptea in general. His pioneering work was ignored or even abused by contemporaries and later students, delaying the large-scale introduction of genitalia as a means for identifying species by some 70 years. Research by Reverdin (from 1910 onwards) and Warren (1926) proved Rambur’s conclusions correct. The first and only appreciation for his work received Rambur from Evans in 1949, 110 years after the publication. Time for a tribute. Introduction published with Hesperiidae. Of these, plate 8 is the most impor- By 1910 all European species of the genera Carcharodus, Spialia, tant one, showing a number of species of the genus ‘Hesperia’, Muschampia and Pyrgus (Lepidoptera, Hesperiidae), as recog- now in Muschampia and Pyrgus (figure 2). The very nice hand nized today, a total of ca. 26 species, had been described, ex- colored illustrations of wings, natural size and accurate, are ac- cept two. It does not imply that they could easily be identified. companied by small drawings of the male genitalia, the largest There was much uncertainty and confusion about the identity having a length of 10 mm. In spite of their small size, the draw- of a number of species and about species limits. The situation ings are incredibly accurate and for one who is acquainted with started to improve when the Swiss medical doctor Jacques Louis Hesperiidae, it is not difficult to identify the species on the basis Reverdin (1842-1929), living in Geneva, began his study of the of these drawings only. -

The Role of Ecological Compensation Areas in Conservation Biological Control
The role of ecological compensation areas in conservation biological control ______________________________ Promotor: Prof.dr. J.C. van Lenteren Hoogleraar in de Entomologie Promotiecommissie: Prof.dr.ir. A.H.C. van Bruggen Wageningen Universiteit Prof.dr. G.R. de Snoo Wageningen Universiteit Prof.dr. H.J.P. Eijsackers Vrije Universiteit Amsterdam Prof.dr. N. Isidoro Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italië Dit onderzoek is uitgevoerd binnen de onderzoekschool Production Ecology and Resource Conservation Giovanni Burgio The role of ecological compensation areas in conservation biological control ______________________________ Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor op gezag van de rector magnificus van Wageningen Universiteit, Prof. dr. M.J. Kropff, in het openbaar te verdedigen op maandag 3 september 2007 des namiddags te 13.30 in de Aula Burgio, Giovanni (2007) The role of ecological compensation areas in conservation biological control ISBN: 978-90-8504-698-1 to Giorgio Multaque tum interiisse animantum saecla necessest nec potuisse propagando procudere prolem. nam quaecumque vides vesci vitalibus auris aut dolus aut virtus aut denique mobilitas est ex ineunte aevo genus id tutata reservans. multaque sunt, nobis ex utilitate sua quae commendata manent, tutelae tradita nostrae. principio genus acre leonum saevaque saecla tutatast virus, vulpis dolus et gfuga cervos. at levisomma canum fido cum pectore corda et genus omne quod est veterino semine partum lanigeraeque simul pecudes et bucera saecla omnia sunt hominum tutelae tradita, Memmi. nam cupide fugere feras pacemque secuta sunt et larga suo sine pabula parta labore, quae damus utilitatiseorum praemia causa. at quis nil horum tribuit natura, nec ipsa sponte sua possent ut vivere nec dare nobis praesidio nostro pasci genus esseque tatum, scilicet haec aliis praedae lucroque iacebant indupedita suis fatalibus omnia vinclis, donec ad interutum genus id natura redegit. -

A Simplified Key to the Butterflies of Aquitaine
A simplified key to the Butterflies of Aquitaine Butterflies are distinguished from most moths by their club-ended thread-like antennae, their wings closed together above the body at rest and their absence of a system of coupling between the anterior and posterior wings. Butterflies are active by day, whereas moths generally fly at night. Note that the separation of these two sub-orders has no real scientific basis but remains an accepted convention. Table 1: Butterflies in Aquitaine Large : 7-9 cm Approximately 159 species of butterflies found in Aquitaine. Knowledge of their geographical distribution is still fragmentary and there are still potentially other species present. The production of this key aims to support recording for the first Aquitaine atlas of butterflies – a joint project by CEN Aquitaine and LPO Aquitaine which will provide an important monitoring baseline. This key provides a simple way to identify the different species of butterflies in Aquitaine. It has been constructed in such a way as to display all closely related species on each page. It must be remembered that a key such as this cannot provide all of the criteria for confirming the identification of every species. It is intended as a simplified key which for many species should be sufficient though it will sometimes have to be supplemented by reference to other more specialized works as indicated. Distributional information by Department is provided to help you to determine your identifications. Good luck! AW Anterior wing PW Posterior wing Means that validation requires genitalia AW analysis either in the hand or (most Medium : 3-7 cm Male ♂ often) later with a voucher specimen. -

Eiablage Und Futterpflanzen Der Falter Der Gattung Pyrgus HÜBNER
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen Jahr/Year: 1998 Band/Volume: 50 Autor(en)/Author(s): Gros Patrick Artikel/Article: Eiablage und Futterpflanzen der Falter der Gattung Pyrgus Hübner, 1819 im Bundesland Salzburg, unter besonderer Berücksichtigung von Pyrgus andromedae (Wallengren, 1853) (Lepidoptera: Hesperiidae, Pyrginae). 29-36 ©Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen, Wien, download unter www.biologiezentrum.at Z.Arb.Gem.Öst.Ent. 50 29-36 Wien, 30.5.1998 ISSN 0375-5223 Eiablage und Futterpflanzen der Falter der Gattung Pyrgus HÜBNER, 1819 im Bundes- land Salzburg, unter besonderer Berücksichtigung von Pyrgus andromedae (WALLENGREN, 1853) (Lepidoptera: Hesperiidae, Pyrginae). Patrick GROS Abstract The author observed oviposition by 7 of the 8 species of Pyrgus HÜBNER, 1819 occuring in Salzburg. Previously, no observations on the biology of Salzburg's skippers were available. The ovipositional behaviour is briefly described, and a list of the corresponding host-plants is given. Information on the poorly known P. andromedae (WALLENGREN, 1853) and its host-plant in Salzburg is given. These observations are discussed with reference to pertinent literature on this subject. Key words: Lepidoptera, Hesperiidae, Pyrgus, Austria, Salzburg, biology, ecology, egg-laying, host- plants. Zusammenfassung Die Eiablage von 7 der 8 derzeit in Salzburg heimischen Falter der Gattung Pyrgus wurde in diesem Bundesland, in dem noch keine konkreten Angaben über die Biologie der hier heimischen Dickkopf- falterarten vorlagen, vom Autor beobachtet. Eiablage sowie Futterpflanzen der Raupen werden kurz beschrieben bzw. aufgelistet. Beobachtungen über die noch nicht gut bekannte Biologie des P. andromedae werden ebenfalls behandelt. -

Lepidoptera Hesperiidae
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Vorarlberger Naturschau - Forschen und Entdecken Jahr/Year: 1996 Band/Volume: 1 Autor(en)/Author(s): Aistleitner Eyjolf Artikel/Article: Die Arealgrenzen der beiden Dickkopffalter-Arten Pyrgus malvae L. und Pyrgus malvoides (ELW. et EDW.) (Lepidoptera, Hesperiidae) in Vorarlberg (Österreich) und Liechtenstein. 335-344 ©inatura Dornbirn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Die Arealgrenzen der beiden Dickkopffalter-Arten Pyrgus malvae L, und Pyrgus malvoides ELW. & EDW. (Lepidoptera Hesperiidae) in Vorarlberg (Österreich) und Liechtenstein von Eyjolf Aistleitner VORARLBERGER NATURSCHAU 1 Abstract SEITE 335-344 The presented paper sumarizes the results of field studies and genitalia exami- DORNBIRN 1996 nation of the two Pyrgus species malvae L. and malvoides ELW. & EDW. in Vorarlberg and the Principality of Liechtenstein and shows the chorology, the phaenology and the contact zone of this two closely related species. Zusammenfassung: Als Ergebnis langjähriger Untersuchungen in Vorarlberg und Liechtenstein an den beiden Dickkopffalter-Arten Pyrgus malvae L. und malvoides ELW. & EDW. werden deren Verbreitung und Phaenologie sowie die Kontaktzone beider Arten im Untersuchungsgebiet aufgezeigt. 1. Einleitung Die Familie der Dickkopffalter mit 3000 Arten ist vor allem in der Neotropis vertreten. Sie ist morphologisch charakterisiert durch einen breiten, "dicken" Kopf (Name!) mit entfernt stehenden Antennen, deren distales, keuliges Ende einen kleinen Haken (Apiculus) aufweist. Bei den Männchen einer Reihe von Arten ist der Vorderrand der Vorderflügel zu einer Duftschuppen beinhaltenden Tasche (Costalfalte) umgeschlagen. Die Imagines sind tagaktive Blütenbesucher mit raschem, schwirrendem Flug. In Ruhe werden die Flügel schräg nach hinten und halb geöffnet oder dachartig ausgebreitet gehalten. -

Tijdschrift Voor Entomologie
lan LIBRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOliniliSNI NVINOSHIIWS S3iaVban NoiiniiiSNi NvmosHiiws saidvaan libraries Smithsonian institution HON •- i \. ^ .<z.^ i - jan libraries Smithsonian institution NoiifiiiisNi nvinoshiiws saiavaar ITION NGIiniliSNI MVINOSHilWS S3iyvaan libraries SMITHSONIAN~INSTITUTIOr aan libraries 'Smithsonian institution NoiiniiiSNi NviN0SHiiiMs"s3iyvaar — "> ~ C/5 — '" 2 J 2 -< _ _ ITION NOIiniliSNI NVINOSHilWS SBiavaail libraries SMITHSONIAN INSTITUTIOr aan libraries Smithsonian institution NoiiniiiSNi nvinoshìiws saiavaar H , w ^ z . w z «2 €>< #^ en '" Z to ^ ITION NOIifllliSNI NVINOSHIIWS S3iyVaan libraries SMITHSONIAN INSTITUTIOr aan"^Li6RARiES Smithsonian institution NoiiniiiSNi nvinoshiiws S3iavaai r- z i~ Z r- z NI NVINOSHIIWS SBIbVaan libraries SMITHSONIAN INSTITUTION NOIIfliliSNI r- r- ' , Z z: 1^ 2 z> /*, W ' _ (/J ± c :S SMITHSONIAN INSTITUTION NOIiniliSNI NVINOSHilWS S3lbVHan LIBRARIES NI^NVINOSHilWs'^Sai dVHan_LIBRARIES SMITHS0NIAN_1NSTITUTI0N NOIiniliSNI_ ES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIifliliSNI NVINOSHilWS S3iavaan LIBRARIES -' ^ '''^'^ ^^ ' ES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIiriiliSNI NVINOSHIIWS S3 I a Va 3 n_ ;NI~'nV1N0SHÌIWS S3iavaan libraries SMITHSONIAN~'lNSTiTUTION^'^OIiniliSNI (- , z r- 2 r- z <_ — " M — C/J ^ to ^L I B R AR I E S ES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIinillSNI NVINOSHIIWS S3 I a V a a 11 „^o'-'-^-'-'-'-S'^' ;ni NVINOSHIIWS S3 1 ava an libraries Smithsonian institution, B R AR 1 ES ES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIiniliSNI NVINOSHilWS S3 I a Va 3 n_LI z r- ^ co *>^->!v;^^ U-t^. DEEL 115 1972 TIJDSCHRIFT VOOR ENTOMOLOGIE UITGEGEVEN DOOR DE NEDERLANDSE ENTOMOLOGISCHE VERENIGING .q^OLOq^ <r^ Tijdschrift voor Entomologie, deel 115, 1972 ''Aflevering 1 verscheen 10 maart 1972 Afleveringen 2 — 3 verschenen 21 april 1972 Afleveringen 4— 5 verschenen 28 juli 1972 Aflevering 6 verscheen 10 november 1972 Afleveringen 7—8 verschenen 12 december 1972 INHOUD VAN DEEL 115 Belle, — Further studies on South American Gomphidae (Odonata) . -

Phylogeny of European Butterflies V1.0
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/844175; this version posted November 16, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY 4.0 International license. A complete time-calibrated multi-gene phylogeny of the European butterflies Martin Wiemers1,2*, Nicolas Chazot3,4,5, Christopher W. Wheat6, Oliver Schweiger2, Niklas Wahlberg3 1Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut, Eberswalder Straße 90, 15374 Müncheberg, Germany 2UFZ – Helmholtz Centre for Environmental Research, Department of Community Ecology, Theodor- Lieser-Str. 4, 06120 Halle, Germany 3Department of Biology, Lund University, 22362 Lund, Sweden 4Department of Biological and Environmental Sciences, University of Gothenburg, Box 461, 405 30 Gothenburg, Sweden. 5Gothenburg Global Biodiversity Centre, Box 461, 405 30 Gothenburg, Sweden. 6Department of Zoology, Stockholm University, 10691 Stockholm, Sweden *corresponding author: e-mail: [email protected] Abstract With the aim of supporting ecological analyses in butterflies, the third most species-rich superfamily of Lepidoptera, this paper presents the first time-calibrated phylogeny of all 496 extant butterfly species in Europe, including 18 very localized endemics for which no public DNA sequences had been available previously. It is based on a concatenated alignment of the mitochondrial gene COI and up to 11 nuclear gene fragments, using Bayesian inference of phylogeny. To avoid analytical biases that could result from our region-focus sampling, our European tree was grafted upon a global genus- level backbone butterfly phylogeny for analyses. In addition to a consensus tree, we provide the posterior distribution of trees and the fully-concatenated alignment for future analyses.