Das Ende Der Konzerne
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
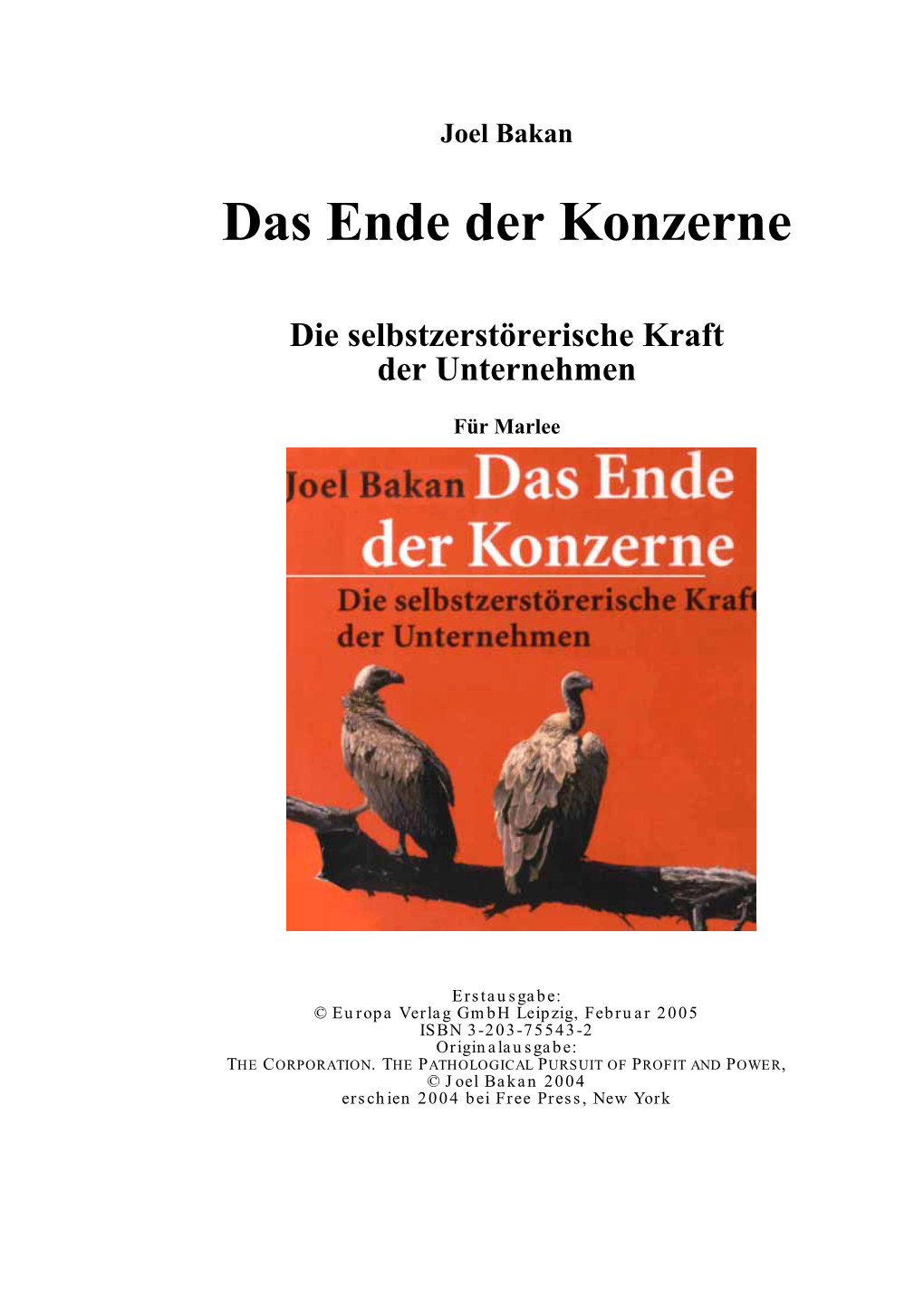
Load more
Recommended publications
-

UCLA Electronic Theses and Dissertations
UCLA UCLA Electronic Theses and Dissertations Title A Soldier at Heart: The Life of Smedley Butler, 1881-1940 Permalink https://escholarship.org/uc/item/6gn7b51j Author Myers, Eric Dennis Publication Date 2012 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles A Soldier at Heart: The Life of Smedley Butler, 1881 - 1940 A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History by Eric Dennis Myers 2013 ! ! ! ! ! ! ! ABSTRACT OF THE DISSERTATION A Soldier at Heart: The Life of Smedley Butler, 1881 - 1940 by Eric Dennis Myers Doctor of Philosophy in History University of California, Los Angeles, 2013 Professor Joan Waugh, Chair The dissertation is a historical biography of Smedley Darlington Butler (1881-1940), a decorated soldier and critic of war profiteering during the 1930s. A two-time Congressional Medal of Honor winner and son of a powerful congressman, Butler was one of the most prominent military figures of his era. He witnessed firsthand the American expansionism of the late nineteenth and early twentieth centuries, participating in all of the major conflicts and most of the minor ones. Following his retirement in 1931, Butler became an outspoken critic of American intervention, arguing in speeches and writings against war profiteering and the injustices of expansionism. His critiques represented a wide swath of public opinion at the time – the majority of Americans supported anti-interventionist policies through 1939. Yet unlike other members of the movement, Butler based his theories not on abstract principles, but on experiences culled from decades of soldiering: the terrors and wasted resources of the battlefield, ! ""! ! the use of the American military to bolster corrupt foreign governments, and the influence of powerful, domestic moneyed interests. -

Smedley D. Butler and Prohibition Enforcement in Philadelphia, 1924-1925
Smedley D. Butler and Prohibition Enforcement in Philadelphia, 1924-1925 ALL OBSERVERS agreed that Philadelphia was among the wettest / \ of many cities remaining ostentatiously wet after the pas- JL JL sage of the Volstead Act. In appealing for federal aid during the fall of 1923, the governor of Pennsylvania, Gifford Pinchot, wrote that more than thirteen hundred saloons were doing business more or less openly. Not to be outdone, Philadelphia police insisted that they had records of eight thousand places selling illegal liquor and speculated that there might be as many more. A New York newsman investigating these reports found that rents for promising corners had quadrupled, and that instead of gulping their liquor furtively according to approved prohibition etiquette, Philadelphians were having drinks mixed at their tables as in pre-Volstead days.1 Attempts to dry up the City of Brotherly Love had failed, and advocates of reform blamed a tight control of the police by the city ward leaders.2 Opponents of prohibition, however, argued that the most efficient police could not prevent the demand indicated by even thirteen hundred saloons from being supplied, and that the demand was not likely to cease in a traditionally wet city of two millions. In that same fall of 1923, Philadelphians elected a new mayor, W. Freeland Kendrick. He had been in politics since he was old enough to vote and had twice been city receiver of taxes. A tall man, seldom seen in public without a grin, he liked to slap his friends on the back and hear them call him "Bill" or "Freel." He possessed a sensitivity to public demands which included the political intuition that the public might prefer to get slightly less than it demanded. -

Us Marines, Manhood, and American Culture, 1914-1924
THE GLOBE AND ANCHOR MEN: U.S. MARINES, MANHOOD, AND AMERICAN CULTURE, 1914-1924 by MARK RYLAND FOLSE ANDREW J. HUEBNER, COMMITTEE CHAIR DANIEL RICHES LISA DORR JOHN BEELER BETH BAILEY A DISSERTATION Submitted in partial fulfillment of the requirements For the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History in the Graduate School of The University of Alabama TUSCALOOSA, ALABAMA 2018 Copyright Mark Ryland Folse 2018 ALL RIGHTS RESERVED ABSTRACT This dissertation argues that between 1914 and 1924, U.S. Marines made manhood central to the communication of their image and culture, a strategy that underpinned the Corps’ effort to attract recruits from society and acquire funding from Congress. White manhood informed much of the Marines’ collective identity, which they believed set them apart from the other services. Interest in World War I, the campaigns in Hispaniola, and the development of amphibious warfare doctrine have made the Marine Corps during this period the focus of traditional military history. These histories often neglect a vital component of the Marine historical narrative: the ways Marines used masculinity and race to form positive connections with American society. For the Great War-era Marine Corps, those connections came from their claims to make good men out of America’s white youngsters. This project, therefore, fits with and expands the broader scholarly movement to put matters of race and gender at the center of military history. It was along the lines of manhood that Marines were judged by society. In France, Marines came to represent all that was good and strong in American men. -

Executive Intelligence Review, Volume 29, Number 16, April 26
EIR Founder and Contributing Editor: Lyndon H. LaRouche, Jr. Editorial Board: Lyndon H. LaRouche, Jr., Muriel Mirak-Weissbach, Antony Papert, Gerald From the Associate Editor Rose, Dennis Small, Edward Spannaus, Nancy Spannaus, Jeffrey Steinberg, William Wertz Editor: Paul Gallagher Associate Editors: Ronald Kokinda, Susan Welsh recommend that you start reading this issue with Lyndon Managing Editor: John Sigerson I Science Editor: Marjorie Mazel Hecht LaRouche’s short statement to the address of President Bush (see Special Projects: Mark Burdman National), on the institutional responsibility of the U.S. Presidency, Book Editor: Katherine Notley Photo Editor: Stuart Lewis especially at a time of global breakdown crisis such as the present. Circulation Manager: Stanley Ezrol Counterposed to this, our Feature takes up the case of an earlier INTELLIGENCE DIRECTORS: President at a time of calamity, who exercised Executive authority Counterintelligence: Jeffrey Steinberg, Michele Steinberg from the standpoint, not of partisan politics, but of the General Wel- Economics: Marcia Merry Baker, fare: Franklin D. Roosevelt. As LaRouche pointed out in an article in Lothar Komp History: Anton Chaitkin last week’s issue (“Crocodile Economics”), you can always tell a Ibero-America: Dennis Small dyed-in-the-wool populist by his apoplectic reaction to the mere men- Law: Edward Spannaus Russia and Eastern Europe: tion of Roosevelt’s memory. In this first of a three-part series, econo- Rachel Douglas mist Richard Freeman presents the historical truth about FDR that is United States: Debra Freeman, Suzanne Rose almost universally blacked out by academia: his roots in the American INTERNATIONAL BUREAUS: Bogota´: Javier Almario System economics of Alexander Hamilton. -

The Historical Society of Pennsylvania ?
THE HISTORICAL SOCIETY OF PENNSYLVANIA President, Boyd Lee Spahr Vice-Presidents Boies Penrose William C. Tuttle Ernest C. Savage Roy F. Nichols Charles Stewart Wurts Isaac H. Clothier, Jr. Secretary, Richmond P. Miller Treasurer, Frederic R. Kirkland Councilors Thomas C. Cochran Henry S. Jeanes, Jr. Harold D. Saylor William Logan Fox A. Atwater Kent, Jr. Grant M. Simon J. Welles Henderson Sydney E. Martin Frederick B. Tolles Penrose R. Hoopes Henry R. Pemberton H. Justice Williams Counsel, R. Sturgis Ingersoll ? Director, R. N. Williams, 2nd DEPARTMENT HEADS: Nicholas B. Wainwright, Research; Lois V. Given, Publications; J. Harcourt Givens, Manuscripts; Raymond L. Sutcliffe, Library; Sara B. Pomerantz, Assistant to the Treasurer; Howard T. Mitchell, Photo-reproduction; David T. McKee, Building Superintendent. * ¥ ¥ <*> Founded in 1824, The Historical Society of Pennsylvania has long been a center of research in Pennsylvania and American history. It has accumulated an important historical collection, chiefly through contributions of family, political, and business manuscripts, as well as letters, diaries, newspapers, magazines, maps, prints, paintings, photographs, and rare books. Additional contributions of such a nature are urgently solicited for preservation in the Society's fireproof building where they may be consulted by scholars. Membership. There are various classes of membership: general, $10.00; associate, $25.00; patron, $100.00; life, $250.00; benefactor, $1,000. Members receive certain privileges in the use of books, are invited to the Society's historical addresses and receptions, and receive The Pennsylvania Magazine of History and Biography. Those interested in joining the Society are invited to submit their names. Hours. The Society is open to the public Monday, 1 P.M. -
Railroads of West Chester: 1831 to the Present James Jones West Chester University, [email protected]
West Chester University Digital Commons @ West Chester University History Faculty Publications History 2006 Railroads of West Chester: 1831 to the present James Jones West Chester University, [email protected] Follow this and additional works at: http://digitalcommons.wcupa.edu/hist_facpub Part of the History of Science, Technology, and Medicine Commons Recommended Citation Jones, J. (2006). Railroads of West Chester: 1831 to the present. , 1-147. Retrieved from http://digitalcommons.wcupa.edu/ hist_facpub/9 This Book is brought to you for free and open access by the History at Digital Commons @ West Chester University. It has been accepted for inclusion in History Faculty Publications by an authorized administrator of Digital Commons @ West Chester University. For more information, please contact [email protected]. Edition Commons Digital Railroads of West Chester 1831 to the present A history of the construction and consequences of the greatest invention of its age as viewed from a small town in southeastern Pennsylvania. Edition Written and designed by Jim Jones, Ph.D., Professor of History, West Chester University. Printed by Taggart Printing, 323 S. Matlack Street, West Chester, PA 19382. Front cover: 1960 American Locomotive Company DR3-18U of the West Chester Railroad. Photo by Jim Jones. Commons Copyright 2006, 2013 by Jim Jones Digital All rights reserved. Edition Dedicated toalternativesautomobiles, and toeveryonewhousesthem. Commons Digital TABLE OF CONTENTS List of Abbreviations iv Foreword vi Introduction 1 Part I: A local -

PDF from Year of Jubile.Pdf
0 1 GOVERNMENT BY AND FOR THE BANKERS To the Editor: A letter writer recently quoted the famous line from the Gettysburg Address: government of the people, by the people, for the people. And it makes me wonder. Is it really possible for a twenty-first century American to believe such things? We have a government of the bankers, for the bankers, and the multinational conglomerates they finance. It’s been that way all of our lives and long before. They regard us as revenue units to fund their operations. This is the way the world looks when it’s run by bankers. Imperial Washington is the source of a toxic and polluted river that has flowed through America; all of its states, cities, and towns. It has flooded this country with its dysfunction and corruption. The river is of sufficient strength to cross oceans and drown the residents of countries all over the world. American people may believe that they can look away and turn a blind eye. They may choose to think that they bear no responsibility for the lunatic arrogance, violence, and power-madness of U.S. leaders. They may be comfortable in the belief that no consequences will come to them personally. I assure you that that’s not the case. After far too many years of willful denial and silent consent, reality will catch up with us. The crises we’re facing are those we’ve brought on ourselves. It didn’t have to be this way, but it’s what we deserve. It’s been said before. -

Butler-Smedley--War-Is-A-Racket-1.Pdf
WAR IS A RACKET 2 Photo courtesy of the Butler family. Smedley Butler with the USMC mascot bulldogs at an Army-Navy game. 3 WAR IS A RACKET The Antiwar Classic by America’s Most Decorated Soldier Brigadier General Smedley Darlington Butler INTRODUCTION BY JESSE VENTURA SKYHORSE PUBLISHING 4 Additional material copyright © 2013 by Skyhorse Publishing, Inc. Introduction copyright © 2013 by Jesse Ventura Photographs and radio address courtesy of the Butler Family Other materials courtesy of the Marine Corps Archives % Special Collections No claim is made to material contained in this work that is derived from government documents. Nevertheless, Skyhorse Publishing claims copyright in all additional content, including, but not limited to, compilation copyright and the copyright in and to any additional material, elements, design, images, or layout of whatever kind included herein. All inquiries should be addressed to Skyhorse Publishing, 307 West 36th Street, 11th Floor, New York, NY 10018. Skyhorse Publishing books may be purchased in bulk at special discounts for sales promotion, corporate gifts, fund-raising, or educational purposes. Special editions can also be created to specifications. For details, contact the Special Sales Department, Skyhorse Publishing, 307 West 36th Street, 11th Floor, New York, NY 10018 or [email protected]. Skyhorse® and Skyhorse Publishing® are registered trademarks of Skyhorse Publishing, Inc.®, a Delaware corporation. Visit our website at www.skyhorsepublishing.com. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data is available on file. ISBN: 978-1-62873-565-9 Printed in the United States of America 6 Butler with his wife, Ethel Conway Peters Butler, circa 1901. -

October 2011 [email protected]
Scuttlebutt General Smedley D. Butler Detachment 1914 1915 P.O. Box 184 • Newtown Square, PA 19073 Website • www.gensdbutlerdet.org Commandant Dan Luty Email: [email protected] Volume XXI, Issue 10 Dan Luty, editor October 2011 [email protected] Commandant’s Report Any help you can give is greatly appreciated and every October 2011 Scuttlebutt issue includes a list of Officers and Committee Chairmen to contact if you can volunteer. There has been plenty of activity since our last general There have been two changes to our Chairmen. Bob meeting. Multiple 9/11 ceremonies, flag ceremonies, the Spano is taking over for Joe Conigliaro as the Honor Butler Display and Americanism presentations, just to Guard Chairman for now. Joe did a great job at the name a few. position for a long time and I would to thank you! Well, it’s about to get even busier. Jack McLeod’s Bob Cosgrove has taken on the responsibility of the HUHO warriors are back in action and have a full Toys for Tots Chairman. Please help support Bob in schedule, the Toys for Tots season is almost upon us, the this role; it is a lot of work! Americanism program is in full swing and there are Color Guard requests coming in. Don’t forget that our next meeting is the first of three meetings in which we will have nominations for our Fortunately, we have a lot of active members that are 2012 Detachment Officers. The December meeting more than willing to participate in these many events. will be the last of the three rounds of nominations and That being said, one area that more volunteers are always we will also conduct the vote. -

July-Aug.-Sept. 2018 in Memoriam
FEATURES As I See It / George Tedeschi ......... 2 Outlook / James Hoffa ............... 2 Managing Editor’s Note / Fred Bruning .... 3 Commentary / Jim Hightower ......... 3 Point of View / Robert Reich.......... 6 Bottom Line / Jerry Morgan .......... 7 Guest Spot / Meers-Williams .......... 7 Volume 36 Number 3 The Newspaper of the Graphic Communications Conference / IBT ❘ www.gciu.org ❘ July-Aug.-Sept. 2018 In Memoriam ................... 16 ‘Outrageous’ Sanders Act Montgomery Court Ruling Calls For Rights Museum Undercuts Workplace Confronts U.S. Labor Rights Democracy Racial History PAGE 4 PAGE 5 PAGE 14 EQUAL JUSTICE INITIATIVE TOP STORY Red State Uprising: Is the New Activism A Plus for Unions? By Zachary Dowdy Special to the Communicator GAGE SKIDMORE GCC/IBT LEADERS ARE CLOSELY WATCHING STATEWIDE STRIKES BY TEACHERS Carolina, all “red states,” and Colorado, which tends to vote Democrat. Teachers have in traditionally Republican states and say the action may represent growing disil- walked out and demonstrated en masse, wearing red T-shirts and carrying banners that lusionment with anti-labor GOP policies and another sign that organized labor is said “Red for Ed.” poised for a rebound. Teachers want better pay – often so low they need second jobs to get by – but also They said the new militancy in at least six states since February – all but one of a commitment from states to provide better materials and equipment for students which went for President Donald Trump in the 2016 election – could be good news and overall per-pupil spending. for unionized workers everywhere. The pay issue is a powerful motivator. Analysts at the Economic Policy Institute “I haven’t seen such a positive development for some time,” said Ralph Meers, president said that, on average, teachers in the United States earn 77 percent of what other college emeritus and secretary-treasurer of Atlanta-based Local 527-S. -

HOUSE of REPRESENTATIVES—Thursday, June 9, 2005
June 9, 2005 CONGRESSIONAL RECORD—HOUSE 12005 HOUSE OF REPRESENTATIVES—Thursday, June 9, 2005 The House met at 10 a.m. minute and to revise and extend his re- Combine the five educational tax The Chaplain, the Reverend Daniel P. marks.) breaks to one tax break for higher edu- Coughlin, offered the following prayer: Mr. PITTS. Mr. Speaker, a 10-year- cation for $3,000 for everybody going to Eternal Father of all and well-spring old Knoxville, Tennessee child, Luke college; unify the various child credits of youthful dreams, bless the young Whitson, and some of his friends chose and earned income tax credit to a sin- women and men who have served these to read the Bible to each other during gle simplified tax family credit; sim- past months as pages of the U.S. House recesses instead of playing on the jun- plify the 16 different versions of the of Representatives. As their term of gle gym or kickball. Luke’s principal Tax Code for savings to one universal service comes to an end, inspire each of was not amused. She put a stop on this 401(k) pension; and, finally, encourage them with expansive hopes and fill terrible practice at once and told the homeownership. We should create a them with great aspirations to create students not to bring their Bibles to universal mortgage deduction for all powerful futures both for themselves school again. taxpayers. and for this Nation. Now, we expect principals to protect Mr. Speaker, we need a tax system We praise You and we thank You for kids from bullying and ensure a that reflects the American values and their families and all of those who have healthy learning environment. -

Pennsylvania Magazine of HISTORY and BIOGRAPHY VOLUME CXXXII
THE Pennsylvania Magazine OF HISTORY AND BIOGRAPHY VOLUME CXXXII 1300 LOCUST STREET, PHILADELPHIA, PA 19107 2008 CONTENTS ARTICLES Page A Tale of Two Deists: John Fitch, Elihu Palmer, and the Boundary of Tolerable Religious Expression in Early National Philadelphia Eric Schlereth 5 Cornelia Bryce Pinchot and the Struggle for Protective Labor Legislation in Pennsylvania Nancy R. Miller 33 “Seditious Libel” on Trial, Political Dissent on the Record: An Account of the Trial of Thomas Cooper as Campaign Literature Forrest K. Lehman 117 From Anglophile to Nationalist: Robert Walsh’s An Appeal from the Judgments of Great Britain Joseph Eaton 141 The “Problem” of the Black Middle Class: Morris Milgram’s Concord Park and Residential Integration in Philadelphia’s Postwar Suburbs W. Benjamin Pigott 173 “Alive to the Cry of Distress”: Joseph and Jane Sill and Poor Relief in Antebellum Philadelphia Trisha Posey 215 Robert Hare: Politics, Science, and Spiritualism in the Early Republic Timothy W. Kneeland 245 Introduction Michael J. Birkner and Randall M. Miller 307 A Tale of Two Cities: Pittsburgh, Philadelphia, and the Elusive Quest for a New Deal Majority in the Keystone State Kenneth J. Heineman 311 Pennsylvania 1941: War, Race, Biography, and History David Goodman 341 Urban Politics and the Vision of a Modern City: Philadelphia and Lancaster after World War II John F. Bauman and David Schuyler 377 Pennsylvania and the Presidency: A Twain That Seldom Meets G. Terry Madonna and Michael Young 403 The Pennsylvania Prince: Political Wisdom from Benjamin Franklin to Arlen Specter Matthew Pinsker 417 NOTES AND DOCUMENTS Tales from the Chew Family Papers: The Charity Castle Story Phillip R.