The Lure of Modernism Written Component of the Master Thesis by Kilian Jörg
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
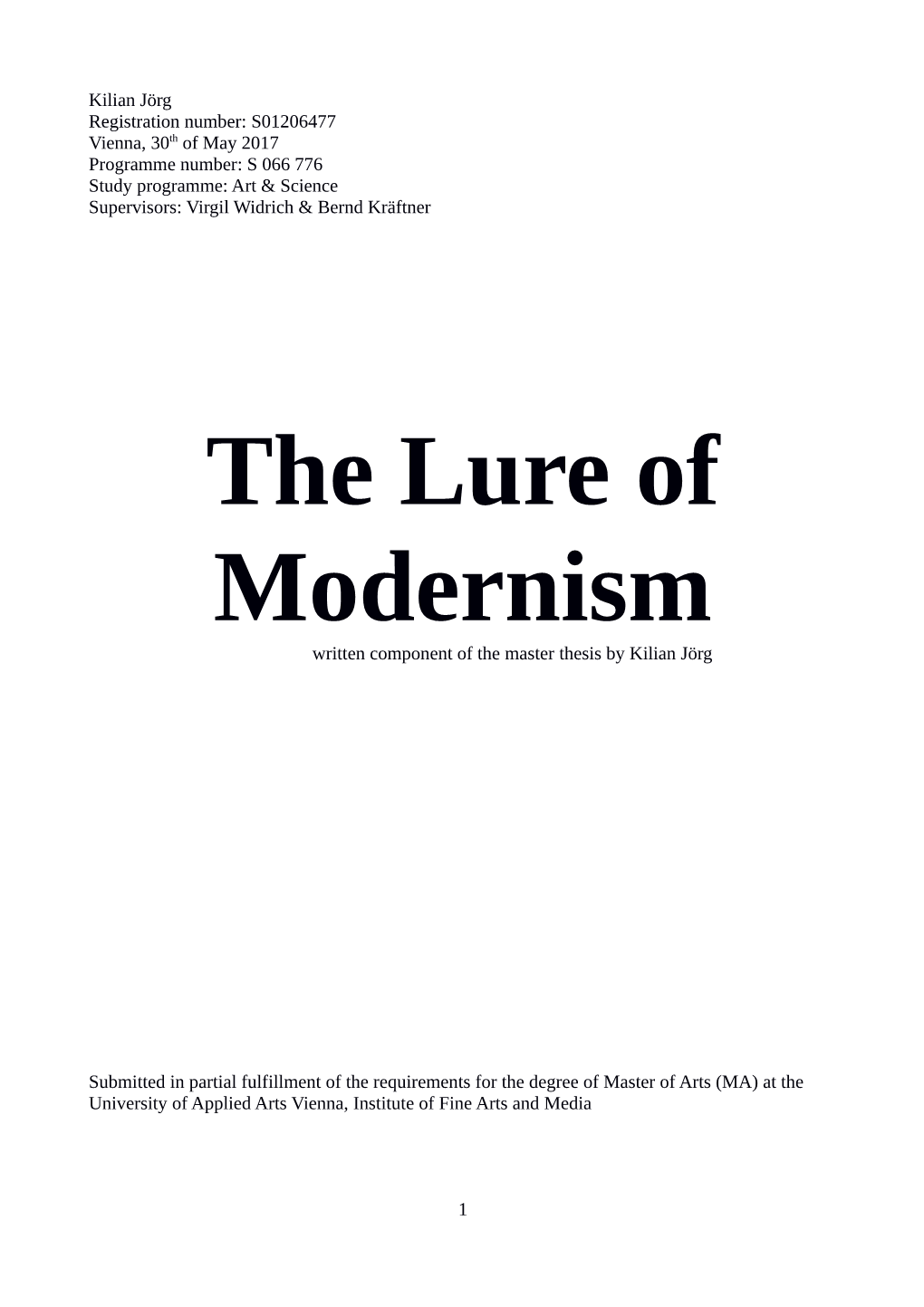
Load more
Recommended publications
-

Nanowrimo Pokémon X & Y What Is National Novel In-Depth Review of the New Pokémon Games Writing Month? 28-9 11
1 FRIDAY 25 OCT NaNoWriMo Pokémon X & Y What is National Novel In-depth review of the new Pokémon games Writing Month? 28-9 11 “Keep the Cat Free” 25/10/13 Issue 1557 felixonline.co.uk Imperial THIS ISSUE... names first Kelly-vision Regius Christy Kelly’s Professor opinions live on air in the Comment Nida Mahmud section 9 News Editor mperial conferred its fi rst Regius Professorship on Professor Chris Toumazou on Commemoration day for undergraduate students SCIENCE on 23 October. IImperial received the title of Regius Professor of Engineering in January during the Queen’s Diamond Jubilee celebrations; which was received for the work undertaken by Imperial’s IMPERIAL COLLEGE LONDON faculty of Engineering and the Every year the graduation ceremony is held on Commemoration Day in the Great Hall. technological breakthroughs it has achieved. Examples of breakthroughs range from the development of and future potential, as so many magnetic levitation to the invention of gifted students from all disciplines “Th e Regius Professorship recognises holography. mark their transition into their future the world-class quality and impact of This week, sleep Imperial conferred the recognition careers. When I think about what Engineering at Imperial College and on Professor Toumazou. He is an lies ahead in my research fi eld it’s Chris Toumazou is a very worthy fi rst science 7 internationally renowned engineer; incredibly exciting to be reminded of recipient of this prestigious title.” his achievements include the fi rst all of that talent and to consider what cochlear implants that allow deaf contributions today’s graduates will Sir Keith O’Nions, Imperial’s people to hear. -

Manifesto Per Una Politica Accelerazionista P. 20
P. 4 – MANIFESTO PER UNA POLITICA ACCELERAZIONISTA P. 20 – INVENTING THE FUTURE - CONCLUSIONS Alex Williams e Nick Srnicek P. 32 – RED STACK ATTACK! ALGORITMI, CAPITALE E AUTOMAZIONE DEL COMUNE Tiziana Terranova P. 46 – ABNORMAL ENCEPHALIZATION IN THE AGE OF MACHINE LEARNING Matteo Pasquinelli P. 62 – APPUNTI PER UNA DISCOGRAFIA ACCELERAZIONISTA October 2016 Valerio Mattioli L’invito a partecipare a DAMA ci ha posti di fronte alla Published by necessità di sviluppare un dispositivo che approfondisse un KABUL magazine preciso argomento, quello dell’Accelerazionismo e dei suoi www.kabulmagazine.com sviluppi teorici ed estetici, al di là del testo scritto. Per questo Edition of 25 motivo, la raccolta di testi qui presentata e una serie di video Turin, November 2016 proiettati sabato 5 novembre a Palazzo Saluzzo di Paesana Design and print by riusciranno forse, se non certamente a esaurire la notevole Fabrizio Cosenza portata dell’argomento, quantomeno a documentare parte delle maggiori riflessioni scaturite negli ultimi anni del dibattito Texts by Alex Williams e Nick Srnicek contemporaneo. Tiziana Terranova Teorizzato nel 2013 da Nick Srnicek e Alex Williams, Matteo Pasquinelli l’Accelerazionismo è stato immediatamente accolto dal Valerio Mattioli sentire comune non solo per le idee esposte nel suo Manifesto, ma soprattutto per la riconsiderazione del futuro, messo da parte negli ultimi da una spinta di diffusa Retromania. Criticando l’atteggiamento intellettuale di passiva analisi critica dell’accademismo odierno, tale pensiero ha spinto all’esigenza di ripensare, con una prospettiva rivolta al nuovo, alla possibilità di cambiare ciò che Adam Curtis ha chiamato hyper normalization. Ancor prima di parlare di tecnologia, l’Accelerazionismo apre gli occhi sull’attività che scandisce e definisce la nostra quotidianità: il lavoro. -

Silent Stage Qwartz (P.8-9) WART Z Live Set Privés Au Casque Pour 50 Personnes Max
Le QWARTZ PRIX DU GÉNIE MUSICAL PIERRE HENRY GrimaldiOrélie De l’autre côté de la musique Pour commencer, puisqu’il faut bien, on pourrait évoquer ce qu’est une rencontre et en particulier celle-ci. Qu’est-ce donc de rencontrer Pierre Henry et sa musique ? A n’en pas douter une émotion singulière pour ne pas dire rare que certains ont pu vivre au cœur de l’église Saint-Eustache ou ailleurs. Et là, on se rend compte que le verbe entendre ne suffit déjà plus pour fixer cet instant. Disons alors l’aventure que fut « La bête ». Mais s’exposer au travers de cet artiste ce n’est pas invoquer Pierre Henry et son génie. Oui, osons ce terme puisque le prix l’indique déjà. Et Pierre Henry fait partie de ces rares personnes où les détours sont proscrits. Ainsi, n’en prenons pas pour « dire » et honorer son geste. Puisqu’avant même la musique, l’œuvre de Pierre Henry fut une nouvelle syntaxe, une grammaire peut-être, et toujours une absolue modernité. Pierre Henry arpente depuis des décennies un silence et on imagine qu’il lui rend ses bruits. Il est en quelque sorte son hors champs et sa quête. On suppose que sa musique procède d’une insuffisance plus que d’une insatisfaction. Il manque toujours quelque chose et à ce quelque chose. A ce manque Pierre Henry lui peint ses mots. N’est-ce pas le signe des créateurs de génie de nous emporter dans un autre langage, de nous détourner de notre imaginaire et ainsi de transformer notre vision du monde ? Et, de cette lumière aux allures de foudre, ce monde en a besoin. -

Press Release
View this email in your browser Press Release Museum of Contemporary Art Detroit For Interviews and Images Contact: Mike Kulick [email protected] Elysia BorowyReeder [email protected] 313.832.6622 MOCAD 2014 WINTER SEASON This Weekend At MOCAD DEPE Resident Sameer Reddy Join MOCAD this weekend for a series of events with Department of Education and Public Engagement (DEPE) Resident Artist Sameer Reddy. Reddy's practice aims to catalyze spiritual catharsis through aesthetic encounter, drawing on his parallel professional practice as a healer. The Tabernacle, his installation at MOCAD, incarnates a sacred space within the secular walls of the museum, problematizing the physical and conceptual demarcation between holy and profane. PERFORMANCE: True East PERFORMANCE: The Sound of My Voice FAMILY DAY: Sandpainting and Mandala Making Video interview with the artist FINAL WEEKS CLOSING SOON James Lee Byars: I Cancel All My Works At Death On view through May 4, 2014 I Cancel All My Works at Death is the first comprehensive survey of the plays, actions, and performances of James Lee Byars (Detroit 1932 Cairo 1997). Spanning the period from 1960 (when he created his first action in Kyoto, Japan) to 1981 (when de Appel arts centre in Amsterdam presented a yearlong survey), the exhibition, which is titled after Byars' nowfamous speech act, adopts the premise that the artist and his work are better misremembered than reexperienced. I Cancel All My Works at Death therefore presents none of his actual performances; nor does it include objects made, owned, or used by him, nor vintage ephemerawith the exception of obituaries published in newspapers at the time of his death. -
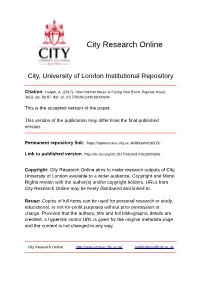
This Is More of a Headline Than a Title
City Research Online City, University of London Institutional Repository Citation: Harper, A. (2017). How Internet Music is Frying Your Brain. Popular Music, 36(1), pp. 86-97. doi: 10.1017/S0261143016000696 This is the accepted version of the paper. This version of the publication may differ from the final published version. Permanent repository link: https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/16515/ Link to published version: http://dx.doi.org/10.1017/S0261143016000696 Copyright: City Research Online aims to make research outputs of City, University of London available to a wider audience. Copyright and Moral Rights remain with the author(s) and/or copyright holders. URLs from City Research Online may be freely distributed and linked to. Reuse: Copies of full items can be used for personal research or study, educational, or not-for-profit purposes without prior permission or charge. Provided that the authors, title and full bibliographic details are credited, a hyperlink and/or URL is given for the original metadata page and the content is not changed in any way. City Research Online: http://openaccess.city.ac.uk/ [email protected] How Internet Music is Frying Your Brain* Author: Adam Harper Address: Department of Music City, University of London Northampton Square London EC1V 0HB Telephone: +44 (0) 7742 922137 Email: [email protected] How Internet Music is Frying Your Brain1 Abstract This article argues that the production and reception of certain recent electronic musics has resonated with criticisms of the perceived degenerative effects of digital technology on culture and 'humanity' -- such as the lack of attention it promotes or the 'information overload' it causes -- in an at least partially positive way. -

Dusken.No › Media › Publications › 2015 › UD-2015-16 Wbzxggr.Pdf Studentmediene Pines
STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 16 - 101.ÅRGANG. 17. NOVEMBER - 12. JANUAR STUDENTMEDIENE PINES: Av SiT, VT, Samfundet, og NTNU MESTRE MØRKETIDA: Skippertak, fargelegging, og yoga BREDDEÅRSDEBATTEN: Flerfaglighet er ikke tverrfaglighet! 2 NYHET 3 REDAKSJONEN REDAKTØR UNDER DUSKEN Martin Gundersen - Tlf: 47756515 [email protected] LEDER FRA ARKIVET NESTLEDER UNDER DUSKEN Miriam Finanger Nesbø - Tlf: 97647426 Første nummer av Under Dusken, desember 1914 [email protected] ANSVARLIG REDAKTØR STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM AS Synne Hammervik - Tlf: 95520352 [email protected] NYHETSREDAKTØR Martha Holmes [email protected] POLITISK REDAKTØR Kristian Aaser [email protected] REPORTASJEREDAKTØR Kristian Gisvold [email protected] KULTURREDAKTØR Mathias Kristiansen [email protected] SPORTSREDAKTØR Jahn Ivar Kjølseth MUSIKKREDAKTØR Eirik Angård FOTOREDAKTØR Anniken Larsen [email protected] GRAFISK ANSVARLIG Andrea Gjerde [email protected] deBattredaktør Ingrid Skogholt [email protected] DAGLIG LEDER Mikkel Bolstad Dæhli - Tlf: 92883089 [email protected] REDAKSJONSSJEF Torjus Lunde Bredvold - Tlf: 48217454 [email protected] DESK Finn Brynestad (sjef), Signe Karmhus, Linn Danielsen Evjemo, Anders Påsche, Jens Erik Vaaler, Jan Markus Johan- nessen, Sunniva Heim, Tora Olsen, Halvor Bjørntvedt Illustrasjon: Katrine Gunnulfsen JOURNALISTER Emma Rødli, Martha Holmes, Kaia Sørland, Olav Mydland, -

2018: Against Worldbuilding Fight the Snob Art of the Social Climbers!
2018: Against Worldbuilding Fight The Snob Art of the Social Climbers! tinymixtapes.com/features/2018-against-worldbuilding By Nick James Scavo · December 13, 2018 Tweet Tech evangelist Robert Scoble taking a shower while wearing now-defunct Google Glass. We celebrate the end of the year the only way we know how: through lists, essays, and mixes. Join us as we explore the music that helped define the year. More from this series In 2018, do we laud our creations enough to call them worlds? As we turn the knob of a Breville BOV650XL toaster oven and scrape strawberry jam over the 1,000 nooks and crannies of an english muffin, are we vain enough to proclaim a new world? Our special individuality suggests that our world is made up of billions of particular worlds. Our bizarre social ingenuity demonstrates that there is a world-network that compartmentalizes, associates, and connects them. All the while, there is an infinite amount of quantum worlds swirling in microcosm beneath the starry sky of an equally infinite macrocosm. Within this reflected infinity, exactly which worlds did we build? Or are we merely at war with an existing world in an effort to proclaim a more profound one — one distinctly of our making? Must we devour the multiplicity of worlds to build even one solitary one? Are we worldeaters or worldbuilders? 1/19 We look up from our world, the planet Earth, and our curiosity bores into the expanse of non- living worlds circling around us. Yet, even our centuries of research and recent astronautics can’t seem to reveal a single discovery other than a plentitude of dead worlds. -

1975, the the 1975 A$AP Ferg Trap Lord Aaron Neville My True Story
ARTIST ALBUM 1975, The The 1975 A$AP Ferg Trap Lord Aaron Neville My True Story Air Review Low Wishes Airhead For Years Akron/Family Sub Verses Alessi's Ark Still Life Alex Andwandter Rebeldes Aloonaluna A House Made Of Cloud & Bone Alpine A Is For Alpine Andrea Echeverri Ruisenora Andrew Cedermark Home Life Anna Calvi One Breath Anna Netrebko Verdi Anna Von Hausswolff Ceremony Antonio Pompa-Baldi The Rascal And The Sparrow Arcade Fire Reflektor Archie Pelago Sly Gazabo Arp More Asphodells Ruled by Passion, Destroyed by Lust Atoms For Peace Amok Fellow Traveler, The Complete String Quartets Of John Attacca Quartet Adams Au Revoir Simone Move In Spectrums Austra Olympia Avett Brothers, The Magpie And The Dandelion Bajofondo Presente Ballake Sissoko At Peace Bangladesh Ponzi Scheme Basia Bulat Tall Tall Shadow Baths Obsidian Beatles, The On Air: Live At The BBC, Vol. 2 Beautiful Swimmers Son Benjamin Britten Benjamin Britten's War Requiem Benoit Pioulard Hymnal Best Coast Fade Away Bilal A Love Surreal Bill Baird Spring Break Of The Soul Bill Bragg Tooth And Nail Bill Callahan Dream River Black Angels, The Indigo Meadow Blaudzun Heavy Flowers Blind Boys Of Alabama, The I'll Find A Way Blood Orange Cupid Deluxe Blow, The The Blow Boards of Canada Tomorrow's Harvest Boban & Marko Markovic Orchestra Gipsy Manifesto Bombino Nomad Bonobo The North Borders Bosnian Rainbows Bosnian Rainbows Bots, The Sincerely Sorry Boy Mutual Friends Brandt Brauer Frick Miami ARTIST ALBUM Brandy Clark 12 Stories Brass Bed The Secret Will Keep You Brendan Benson -

INTERACTIVE MUSIC WUNDERKAMMER a Master‟S
INTERACTIVE MUSIC WUNDERKAMMER A Master‟s Thesis By DOĞA USLU Department of Communication and Design Ġhsan Doğramacı Bilkent University Ankara January 2016 1 INTERACTIVE MUSIC WUNDERKAMMER Graduate School of Economics and Social Sciences of Ġhsan Doğramacı Bilkent University by DOĞA USLU In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF FINE ARTS in THE DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND DESIGN ĠHSAN DOĞRAMACI BĠLKENT UNIVERSITY ANKARA January 2016 I certify that I have read this thesis and have found that it is fully adequate, in scope and in quality, as a thesis for the degree of Master of Fine Arts in Media and Design. --------------------------------- Asst. Prof. Marek Brzozowski Supervisor I certify that I have read this thesis and have found that it is fully adequate, in scope and in quality, as a thesis for the degree of Master of Fine Arts in Media and Design. --------------------------------- Asst. Prof. Andreas Treske Co-Supervisor I certify that I have read this thesis and have found that it is fully adequate, in scope and in quality, as a thesis for the degree of Master of Fine Arts in Media and Design. --------------------------------- Ekin Kılıç, Examining Committee Member I certify that I have read this thesis and have found that it is fully adequate, in scope and in quality, as a thesis for the degree of Master of Fine Arts in Media and Design. --------------------------------- Asst. Prof. Bülent Bingöl, Examining Committee Member Approval of the Graduate School of Economics and Social Sciences --------------------------------- Prof. Halime Demirkan Director ABSTRACT INTERACTIVE MUSIC WUNDERKAMMER Uslu, Doğa M.F.A., in Media and Design Supervisor: Asst. -

Listen To: Symphony of the Planets 4 Rooms
Listen to: symphony of the planets 4 rooms Atlantean Monument At Filmore East Mekong morning glory Free Jazz (a collection) Ascension Streets Permutation Sunn 0))) Gone to Earth Voyager Golden Record Live at marty’s, new York city Viva I am singing to you from my room We Insist! Max Roaches Freedom Now Suite! Voice of Xtaby The Black Saint and the Sinner Lady Stepping Into the Dark Midori: Second The Sleepwalkers Society Mass Hysterism in Another Situation Angles of Darkness, Demons Of Light Melody Summer Nature Unveiled Antonio Vivaldi Four Seasons, and More Earthbound OST BADBADNOTGOOD Evangelion Soundtracks The End of Evangelion Evangelion 1.0 You Are (Not) Alone Shinsekai Angherr Shisspa Micro Mega Gossamer Banjo Crackerjax Head Hunters Come Midnight Songs About Leaving Iyov Jazz in Sillhouette Batztoutai with memorial gadgets Ite Maledicti Domkirke Zwei-Mann Orchester Branches Otavaiset Otsakkaha The Secret Eye of L.A.Y.L.A.H. Weasels Ripped My Flesh Burnt Weeny Sandwich Sheik Yeruboti Radiance of Shadows Unattainable Rollercoaster Her Corpse was Missing the Head Paprika OST Coral Compilation Gikyokuonsou What was Music 3 Feet High and Rising Walks Pulse Demon Seahorse All of artist: Uncertain (acquired discography so far) Outside Dead Serious Journal For People I Start To Believe You John Cage Meets Sun Ra Talking heads, (if land here, random album from discog and/or single) Home After Summer Earthbound Giygas returns Selected Ambient Works Vol. 2 The Gay Parade Hurtbreak Wonderland A Crimson Grail Les Discrets Millions Now Living -

The California Tech
The California Tech Volume CXViii number 7 Pasadena, California teCh.CalteCh.edu noVember 17, 2014 Matthew Elgart gives strong six-string performance ALEX BALL transform into beautifully performance. Elgart of grand performance. And who Contributing Writer sweet progressions, and would set up pieces wouldn’t want to watch that? An would do so extremely with a short anecdote unconventional concert by an Dabney Hall burned to the smoothly, thanks to or humorous comment, unconventional man, I would ground during an intentionally Elgart’s enlightened then have to adjust highly recommend any of Dr. fiery performance by classical sense of dynamics. This his seat and footrest Elgart’s future performances, guitarist Matthew Elgart last contributed to a strong to accommodate especially if you never considered Saturday evening, one of four sense of premeditation in the apparently-too- yourself a concert-goer. planned in the Los Angeles area. the performance, a sense stubborn-to-move In addition to performing, Elgart showcased his command that there was a specific instrument. The guitar, Elgart also teaches beginner, of the instrument to benefit the idea the audience was though, loved attention, intermediate, and advanced level Caltech performing and visual arts supposed to take away and so would quickly classical guitar classes at Caltech department. The concert featured from each passage. be coaxed into playing. each term. If you have any interest pieces by Villa Lobos, Krenek, The whole effect was From the audience’s in either learning how to play Satie, Scarlatti, Ponce, and Bach, as compounded by the point of view, Elgart guitar or how to be cooler than you well as two original compositions. -

R Plus Seven / Oneohtrix Point Never — September 12, 2013 at EMPAC, Troy, NY
UPCOMING PERFORMANCES OPEN CORE Julien Maire French artist Julien Maire revisits 16th century public demonstrations of anatomic dissections with a performance in which he deconstructs cameras. SEPTEMBER 20 7PM PERFORMANCE THE YOUNG-GIRL AND DEATH l’APA ONEOHTRIX Participate in a fantastical classroom—a performance complete with textbooks, a ballet instructor, sound POINT NEVER poetry, sculptures, and a string quartet. OCTOBER 12 7PM THURSDAY SEPTEMBER 12 2013 | 8PM TIMOTHY SACCENTI EMPAC PERFORMANCE ONHEOHTRIX POINT NEVER THURSDAY SEPTEMBER 12 2013 | 8PM Oneohtrix Point Never—aka Daniel Lopatin—is a Brooklyn-based composer who creates electronic music that is often described as “cinematic” and “orches- tral.” While broad in range, Lopatin does not ignore the small stuff; his sound engineering crafts and controls every detail and effect. Pulling from a wide range of influences—synth sounds, television commercials, classical minimalism, and high-end audio production—Lopatin condenses the disparate sounds to form music that slopes forward with self-contained narratives. Oneohtrix Point Never performs new music with visuals from his upcoming album. CAST + CREW Concept, Direction: Brian Rogers Director of Photography Madeline Best Performance Madeline Best, Brian Rogers Technology Design Mike Rugnetta Set Design Brad Kisicki Lighting Design Jon Harper Costumes Maggie Dick BIOGRAPHIES BIOGRAPHIES Oneohtrix Point Never (OPN) is Daniel Lopatin, a Boston-bred, Brooklyn-based Oneohtrix Point Never (OPN) is Daniel Lopatin, a Boston-bred, Brooklyn-based artist whose celebrated emergence has opened the general public’s ears to artist whose celebrated emergence has opened the general public’s ears to daring combinations of electronic sound in ways unheard of in recent cultural daring combinations of electronic sound in ways unheard of in recent cultural memory.