16185231.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Neue Quellen Zu Friedrich Spee Von Langenfeld Und Seiner Familie
RAINER DECKER Neue Quellen zu Friedrich Spee von Langenfeld und seiner Familie Deo duce virtute comite fortuna ministra Wahlspruch des Arnold v. Spee, 1623 Einfu¨hrung Zeit: April 1662. Ort: Kloster der Servitessen („Dienerinnen der seligen Jungfrau Maria“) in Linz am Rhein. Die Nonne Anna Margareta Spee ist wu¨ tend. Sie fu¨hlt sich von einer Ba¨uerin aus ihrem Heimatdorf Bruchhausen bei Linz verleumdet und erstattet Anzeige bei dem Ko¨ lner Domkapitel, zu dessen Herrschaft Erpel Bruchhausen geho¨rt.Darin fu¨hrt sie aus, dass die Frau eines ihrer Pa¨chter, „Herman Meußgen Hausfrau Sophia genant zu Brochhaußen in Euer Gnaden Jurisdic- tion Erpel wohnhaft mir ganz unverschulter weis hin und her hinderucklich nachgeredt, ich hette ihro in einem drunck angetan, daß sei [= sie] alles das ihrig versaufen muste ... Nun ist nicht ohne, daß die beklagtin sich darauf vertro¨ st, daß ahn ihro nichts zu erhoh- len, undt weilen an ihr nichts zu erhohlen, so ist billigh und rechtens, daß dieselbe, weilen sei mir meine Ehre abgestohlen und nicht wider restituiren kan, anderen zum Exempel bestraft wu¨ rde, in betrachtungh, daß nichts hochers in der weiten weltt als ein ehrlicher frommer Nahm, und wan [man] solche hoch-ehrenverletzliche Injurien ungeandet hin- gehen ließe, bevorab, weilen die Beklagtin selbige hin und her spargirt [= gestreut], [dass dann] mir allerhandt Verdacht aufwachsen ... mogte ... Derowegen glangt an Ew. Hoch- wohlgeborene Hochgra¨fliche Excellencen und Gnaden meine allerhochste diemutigste bitt, sei gerawen [= geruhen] gna¨digh, ihrem Scholtheißen oder Statthalteren zu Erpel, daß sei die Beklagtin vornehmen und nach befindenden Sachen ... mit ahnschließungh des haltzbandt anderen Ehrenschenderen zum Exempel bestraffen, ernstlich und gna¨- digh ahnzubefehlen. -

Und Menschenbild in Den Geistlichen Liedern Von Friedrich Spee
Das Gottes- und Menschenbild in den Geistlichen Liedern von Friedrich Spee Von der Philosophischen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zur Erlangung des Grades einer Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) genehmigte Dissertation von Annelore Butzmann geboren am 03.07.1927 in Köln 2010 1 Referent: Herr Prof. Dr. Dr. Peter Antes Korreferent: Herr Prof. Dr. Hans-Georg Aschoff Tag der mündlichen Prüfung: 12. 07. 2010 2 Meinem Vater 3 Dank Die vorgelegte Dissertation entstand nach meinem Zweitstudium als Seniorin an der Philosophischen Fakultät mit den Hauptfächern Religionswissenschaft und Geschichte zur Magistra Artium (M.A.). Ich möchte mich ausdrücklich bedanken für das selbstverständliche und ermutigende Miteinander von jungen und Seniorenstudenten während der Studienzeit, zu dem die Lehrenden in den Seminaren wesentlich beigetragen haben. Nach Abschluss der Dissertation danke ich nun ganz besonders meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Dr. Peter Antes. Bei aller professionellen Distanz und der steten Forderung nach wissenschaftlicher Exaktheit, fand er in den begleitenden Jahren in persönlicher Ansprache immer wieder Worte, die nicht nur Mut machten, sondern die Freude an meiner wissenschaftlichen Arbeit beflügelten. Dank sage ich auch Herrn Prof. Dr. Hans-Georg Aschoff der das Zweitgutachten für die Dissertation übernahm. Besonders danke ich ihm auch dafür, dass er meine Magisterarbeit annahm und betreute, die mir eine ergänzende Grundlage für die Dissertation wurde. Zu danken gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Sekretariaten der Seminare Religionswissenschaft und Geschichte und in den Bibliotheken der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek (Niedersächsische Landesbibliothek) und der Bibliothek des Landeskirchenamtes Hannover für die stets freundliche und hilfsbereite Unterstützung bei Fragen und Literatursuche. -

Proteus Rebound Reconsidering the “Torture of Nature” Author(S): Peter Pesic Source: Isis, Vol
Proteus Rebound Reconsidering the “Torture of Nature” Author(s): Peter Pesic Source: Isis, Vol. 99, No. 2 (June 2008), pp. 304-317 Published by: The University of Chicago Press on behalf of The History of Science Society Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1086/588627 Accessed: 24-03-2018 04:29 UTC JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://about.jstor.org/terms The History of Science Society, The University of Chicago Press are collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Isis This content downloaded from 142.58.129.109 on Sat, 24 Mar 2018 04:29:39 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms CRITIQUES AND CONTENTIONS Proteus Rebound Reconsidering the “Torture of Nature” By Peter Pesic* ABSTRACT Though Carolyn Merchant has agreed that Francis Bacon did not advocate the “torture of nature,” she still maintains that “the very essence of the experimental method arose out of human torture transferred onto nature.” Her arguments do not address serious problems of logic, context, and contrary evidence. Her particular insistence on the influence of the torture of witches ignores Bacon’s skepticism about witchcraft as superstitious or imag- inary. -

Friedrich Spee: El Primer Criminólogo Crítico*
Lecciones y Ensayos, Nro. 102, 2019 313 ZAFFARONI, Eugenio R. y CROXATTO, Guido L., “Friedrich Spee: el...”, pp. 313-354 FRIEDRICH SPEE: EL PRIMER CRIMINÓLOGO CRÍTICO* EUGENIO RAÚL ZAFFARONI** Y GUIDO LEONARDO CROXATTO*** I. EL PERSONAJE POLIFACÉTICO: SPEE No ocupa el lugar que merece entre los héroes históricos de la crimi- nología y del derecho penal, al que suele recordárselo solo como crítico de la persecución de brujas, pero se opacan otros aspectos de su riquísima personalidad.1 Es necesario advertirlo, porque centramos nuestro interés en su obra fundamental (Cautio criminalis seu de processibus contra sagas liber),2 por constituir el aporte más importante para nuestras disciplinas, pero no por ello subestimamos sus otras contribuciones a la humanidad, que nos limitaremos a referenciar someramente.3 * Recepción del original: 19/02/2019. Aceptación: 14/03/2019. Los autores agradecen muy especialmente los consejos de Tamar Pitch, Rosa Mavita León, Margarita Cabello Blanco, Sara Beatriz Guardia y Thomas Vormbaum, así como los aportes de los investigadores y directores del Max Planck en Derecho Penal y Derecho Penal Internacional de la ciudad de Friburgo, Alemania, Benjamin Vogel, Hans Kudlich, Ulrich Sieber y Hans-Jörg Albrecht. ** Profesor emérito de Derecho Penal (UBA) y Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). *** Abogado (UBA), Licenciado en Filosofía (UBA), LLM (FU), Máster en Derecho Constitucional (Universidad Católica de Chile), Doctor en Derecho Público (FU). Director del Tribunal Experimental en Derechos Humanos (UNLA). 1. Sin duda que le corresponde ese mérito, especialmente por haber dedicado al tema su obra específica y fundamental, pero hubo serias críticas anteriores en la misma Compañía de Jesús, en particular de los jesuitas tiroleses Adam Tanner (1572-1632) y Paul Laymann (1564-1635). -

ABC-CLIO Ebook Collection
ABC-CLIO eBook Collection Encyclopedia of Witchcraft: The Western Tradition By: Richard M. Golden, Editor Witch Hunts Rita Voltmer Witch hunts were an early modern phenomenon. Geographically, they occurred most often in some parts of the Holy Roman Empire that were extremely fragmented legally: Franconian ecclesiastical territories; the Saar and Mosel regions; the electorates of Trier and Cologne, including the duchy of Westphalia; the duchies of Luxembourg and Lorraine; the prince-bishopric of Münster; Schleswig- Holstein; and Mecklenburg. Elsewhere, they occurred on the peripheries of France (for example, Navarre and Languedoc), in the Swiss Confederation, the Spanish Netherlands, the Austrian Habsburg patrimonial lands, and western Poland. Witch hunting was generally less intense in both Mediterranean and northern Europe, with Catalonia from 1618 to 1620 as a notable exception in the former area and lowland Scotland, eastern England, in 1645, and northern Sweden from 1668 to 1674 as exceptions in the latter area. Even in areas affected by severe witch panics, trials occurred in unequal numbers everywhere. There was a great deal of regional variation in persecution; some areas experienced endemic, others epidemic, episodes of witch hunting. Witch hunts had many different causes: Current witchcraft scholarship acknowledges that no single factor explains all early modern witch hunts. Learned Witchcraft and the Chronology of Persecution Witch hunts were clearly not a medieval phenomenon, but ideas about witchcraft had roots in medieval belief systems. By 1400, it was generally accepted that individuals could work harm (but also effect cures) by means of magic. During the fifteenth century, a far more terrifying belief developed that a witch sect met secretly in order to plot harm to the rest of society. -

Witchcraft, Demonology and Magic
Witchcraft, Demonology and Magic • Marina Montesano Witchcraft, Demonology and Magic Edited by Marina Montesano Printed Edition of the Special Issue Published in Religions www.mdpi.com/journal/religions Witchcraft, Demonology and Magic Witchcraft, Demonology and Magic Special Issue Editor Marina Montesano MDPI • Basel • Beijing • Wuhan • Barcelona • Belgrade Special Issue Editor Marina Montesano Department of Ancient and Modern Civilizations, Universita` degli Studi di Messina Italy Editorial Office MDPI St. Alban-Anlage 66 4052 Basel, Switzerland This is a reprint of articles from the Special Issue published online in the open access journal Religions (ISSN 2077-1444) from 2019 to 2020 (available at: https://www.mdpi.com/journal/religions/special issues/witchcraft). For citation purposes, cite each article independently as indicated on the article page online and as indicated below: LastName, A.A.; LastName, B.B.; LastName, C.C. Article Title. Journal Name Year, Article Number, Page Range. ISBN 978-3-03928-959-2 (Pbk) ISBN 978-3-03928-960-8 (PDF) c 2020 by the authors. Articles in this book are Open Access and distributed under the Creative Commons Attribution (CC BY) license, which allows users to download, copy and build upon published articles, as long as the author and publisher are properly credited, which ensures maximum dissemination and a wider impact of our publications. The book as a whole is distributed by MDPI under the terms and conditions of the Creative Commons license CC BY-NC-ND. Contents About the Special Issue Editor ...................................... vii Marina Montesano Introduction to the Special Issue: Witchcraft, Demonology and Magic Reprinted from: Religions 2020, 11, 187, doi:10.3390/rel11040187 .................. -

Full Book PDF Download
ACKNOWLEDGEMENTS i Witchcraft narratives in Germany STUDIES IN EARLY MODERN EUROPEAN HISTORY This series aims to publish challenging and innovative research in all areas of early modern continental history. The editors are committed to encouraging work that engages with current historiographical debates, adopts an interdisciplinary approach, or makes an original contribution to our understanding of the period. SERIES EDITORS William G. Naphy and Penny Roberts EDITORIAL ADVISORY BOARD Professor N. Z. Davis, Professor Brian Pullan, Professor Joseph Bergin and Professor Robert Scribner Already published in the series The rise of Richelieu Joseph Bergin Sodomy in early modern Europe ed. Tom Betteridge Fear in early modern society eds William Naphy and Penny Roberts Religion and superstitition in Reformation Europe Helen Parish and William G. Naphy Religious choice in the Dutch Republic: the reformation of Arnoldus Buchelus (1565–1641) Judith Pollman A city in conflict: Troyes during the French wars of religion Penny Roberts ACKNOWLEDGEMENTS iii Witchcraft narratives in Germany Rothenburg, 1561–1652 ALISON ROWLANDS Manchester University Press Manchester and New York distributed exclusively in the USA by Palgrave Copyright © Alison Rowlands 2003 The right of Alison Rowlands to be identified as the author of this work has been asserted by her in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. Published by Manchester University Press Oxford Road, Manchester M13 9NR, UK and Room 400, 175 Fifth Avenue, New York, NY10010, USA www.manchesteruniversitypress.co.uk -
Making a Witch: the Triumph of Demonology Over Popular Magic Beliefs in Early Modern Europe
Making a Witch: The Triumph of Demonology Over Popular Magic Beliefs in Early Modern Europe By Rachel Pacini A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements of the University Honors Program University of South Florida St. Petersburg April 28, 2017 Thesis Director: Adrian O’Connor, Ph.D. Assistant Professor, College of Arts and Sciences University Honors Program University of South Florida St. Petersburg CERTIFICATE OF APPROVAL ___________________________ Honors Thesis ___________________________ This is to certify that the Honors Thesis of Rachel Pacini has been approved by the Examining Committee on April 28, 2017 as satisfying the thesis requirement of the University Honors Program Examining Committee: ___________________________ Thesis Director: Adrian O’Connor, Ph.D. Assistant Professor, College of Arts and Sciences ____________________________ Thesis Committee Member: J. Michael Francis, Ph.D. Professor, College of Arts and Sciences Table of Contents Introduction ..................................................................................................................................... 1 Chapter 1: Popular Magic and Maleficia ........................................................................................ 8 Chapter 2: Demonology ................................................................................................................ 25 Chapter 3: Witchcraft Trials ......................................................................................................... 53 Conclusion ................................................................................................................................... -

Witchcraft and Witch Trials in Early Modern Europe
WITCHCRAFT AND WITCH TRIALS IN EARLY MODERN EUROPE HISTORY 106 GENDER, SEXUALITY & WOMEN'S STUDIES 126 Tues, Thurs 11:05-12:20 Meliora Hall 221 Fall Semester, 2017 Instructor Prof Tom Devaney Email: [email protected] Office: Rush Rhees 452 Phone: 585.276.6861 Office Hours: Tuesday, Wednesday 1-2pm and by appointment Teaching Assistant Andrew Russo Email: [email protected] Office Hours: by appointment COURSE DESCRIPTION The age of the Renaissance and Reformation was also a time in which many people throughout Europe, both Catholics and Protestants, became convinced that society was threatened by conspiracies of witches. The resulting panics led to the execution of thousands of people, mostly lower-class women. The course delves into intellectual, cultural and social history to explain how this happened, and why. A general belief in witches and magic was part of this, but only part. Such beliefs had a long history in European society yet had not previously led to widespread attacks on suspected witches. As we will see, persecutions of witchcraft reflected major changes in European society, culture, and politics—including changing assumptions about the nature of gender; new relationships between popular and learned religion; the formation of centralized states and the rise of “social discipline;” and so on. These transformations lent new meanings to traditional ideas about women, possession, and magic, thus enabling the systematic condemnation of certain groups of people. The ways in which these ideas were mobilized within individual communities and the reasons for doing so varied widely, however, and we will therefore closely examine several specific examples of witch hunts in order to better understand why they were appealing to so many, why they flourished for a time, and why they ultimately faded. -
Jesuit Prison Ministry in the Witch Trials of the Holy Roman Empire
IV, 2021/1 Frank Sobiech Jesuit Prison Ministry in the Witch Trials of the Holy Roman Empire Review by: Hilmar Pabel Authors: Frank Sobiech Title: Jesuit Prison Ministry in the Witch Trials of the Holy Roman Empire. Friedrich Spee SJ and his Cautio Criminalis (1631) Place: Roma Publisher: Institutum Historicum Societatis Iesu Year: 2019 ISBN: 9788870413809 URL: link to the title REVIEWER Hilmar Pabel - Simon Fraser University, Burnaby BC (Canada) Citation H. Pabel, review of Frank Sobiech, Jesuit Prison Ministry in the Witch Trials of the Holy Roman Empire. Friedrich Spee SJ and his Cautio Criminalis (1631), Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, 2019, in: ARO, IV, 2021, 1, URL https://aro- isig.fbk.eu/issues/2021/1/jesuit-prison-ministry-in-the-witch-trials-of-the-holy-roman-empire-friedrich-spee-sj-and-his-cautio-criminalis- 1631-hilmar-pabel/ Can we thwart the hegemony of English as the language of scholarly publication? The book under review was originally conceived as the author’s Habilitationsschrift, written in German and presented in 2017 to the Faculty of Catholic Theology of the Julius-Maximilianus-Universität in Würzburg. It should have remained in German. The stilted English translation inconveniences readers who appreciate incisive academic prose. Awkward formulations abound. At times one can easily infer the original German. Communicating clearly must take priority over capturing a wide market of anglophone readers. German is an established language of scholarly communication. The large and growing scholarly audience for Jesuit history could have benefited from a German monograph. Friedrich Spee (1591-1635), a Jesuit priest, is best known for challenging the widespread persecution of witches in his book Cautio Criminalis (1631). -

Male Witches in Early Modern Europe
chapter4 21/12/04 12:17 pm Page 95 4 LITERALLY UNTHINKABLE? DEMONOLOGICAL DESCRIPTIONS OF MALE WITCHES The previous chapters presented challenges to generalisations about male witches. The next two chapters follow a similar approach to con- ventional perspectives on the demonological treatment of witchcraft and gender. Through the examination of witchcraft theorists’ descrip- tions of male witches, we aim to show that, just as with the ‘real life’ cases,modern scholars’views do not take sufficient account of the com- plexity of early modern learned theories about witches. The sources for this discussion are demonological treatises pub- lished in the fifteenth,sixteenth and seventeenth centuries.The body of witchcraft literature is much too large to permit a complete survey; there is, however, a smaller group of works that could be considered canoni- cal, at least from the perspective of contemporary scholarship. This ‘canon’includes Jean Bodin’s De la demonomanie des sorciers,Johannes Nider’s Formicarius, and the Malleus maleficarum, which occupies pride of place within the literature as possibly the most (in)famous trea- tise of them all. In this chapter, we present data compiled from ten of these canonical works, as well as a brief discussion of demonological illustrations. Demonological literature has received relatively little scholarly attention, especially compared with the number of published studies that focus on non-literary, archival materials such as court records and pamphlets. Although witchcraft scholars refer frequently to the Malleus [ 95 ] Lara Apps and Andrew Gow - 9781526137500 Downloaded from manchesterhive.com at 09/29/2021 07:19:38PM via free access chapter4 21/12/04 12:17 pm Page 96 MALE WITCHES IN EARLY MODERN EUROPE and its fellow witchcraft treatises, they rarely engage in sustained analy- ses of these works. -
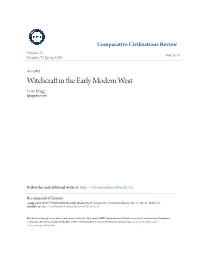
Witchcraft in the Early Modern West," Comparative Civilizations Review: Vol
Comparative Civilizations Review Volume 72 Article 11 Number 72 Spring 2015 4-1-2015 Witchcraft in the aE rly Modern West Larry Gragg [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/ccr Recommended Citation Gragg, Larry (2015) "Witchcraft in the Early Modern West," Comparative Civilizations Review: Vol. 72 : No. 72 , Article 11. Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/ccr/vol72/iss72/11 This Article is brought to you for free and open access by the All Journals at BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Comparative Civilizations Review by an authorized editor of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Gragg: Witchcraft in the Early Modern West Comparative Civilizations Review 137 Witchcraft in the Early Modern West Larry Gragg [email protected] In 1617, on the Channel Island of Guernsey just off the northern French coast, a woman named Collette Du Mont confessed to practicing witchcraft. She told a court: That the Devil having come to fetch her that she might go to the Sabbath, called for her without anyone perceiving it: and gave her a certain black ointment with which (after having stripped herself), she rubbed her back, belly and stomach: and then having again put on her clothes, she went out of her door, when she was immediately carried through the air at a great speed: and she found herself in an instant at the place of the Sabbath, which was sometimes near the parochial burial-ground: and at other times near the seashore in the neighbourhood of Rocquaine Castle: where, upon arrival, she met often fifteen or sixteen Wizards and Witches with the Devils who were there in the form of dogs, cats and hares: which Wizards and Witches she was unable to recognize, because they were all blackened and disfigured: it was true, however, that she had heard the Devil summon them by their names.1 Du Mont was only one of at least 100,000 people tried on charges of practicing witchcraft between 1500 and 1700 in Western Europe.