Masterarbeit / Master's Thesis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mitteilungsblatt 2013
RAVENSBRÜCK MITTEILUNGSBLATT der Österreichischen Lagergemeinschaft Ravensbrück & FreundInnen Dezember 2013 Die beiden Überlebenden Charlotte Kroll (ganz links) und Ilse Heinrich (ganz rechts) und ihre BegleiterInnen protestieren gegen die Änderung des Namens der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück in Gedenkstätte Ravensbrück. Foto: Deutsche Lagergemeinschaft Ravensbrück / Freundeskreis e.V. Österreichische Lagergemeinschaft Ravensbrück & FreundInnen Lassallestraße 40/2/6, A-1020 Wien, Tel.: 0650/48 00 636 E-Mail: [email protected] www.ravensbrueck.at Allen Kameradinnen und ihren Familien im In- und Ausland wünschen wir ein gesundes und friedliches Neues Jahr! Diesem Mitteilungsblatt legen wir einen Zahlschein zur Einzahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrages von 15 Euro bei. Wir bitten um baldige Überweisung! Auch Spenden werden dankend entgegengenommen. Der Vereinsvorstand INHALT 3 Befreiungsfeier 25 www.ravensbrueckerinnen.at in Ravensbrück 2013 26 Gedenken an den ersten 5 Ein ganz besonderes Jahr Dachau-Transport 6 „Wir wollen nicht nur gedenken, 27 Solidarität mit den Refugees! sondern auch mahnen“ 30 „Die Gedanken sind frei“ 7 Zerstörungen in der Gedenkstätte Uckermark 32 Feminismus und Antifaschismus 8 Das Treffen des Internationalen 32 Bewusstseinsregion Mauthausen Ravensbrück-Komitees – Gusen – St. Georgen 10 Neuwahl des Vorstands 33 Fritzi Furch (1924 – 2012) der ÖLGR/F: Blick zurück 34 Ceija Stojka (1933 – 2013) und nach vorn 35 Wilhelmine Riepan (1926 – 2013) 12 Aktivitäten der ÖLGR/F und ihrer Mitglieder 2013 36 Marija -

Historicalmaterialism Bookseries
Otto Bauer (1881–1938) Historical Materialism Book Series Editorial Board Sébastien Budgen (Paris) David Broder (Rome) Steve Edwards (London) Juan Grigera (London) Marcel van der Linden (Amsterdam) Peter Thomas (London) volume 121 The titles published in this series are listed at brill.com/hm Otto Bauer in 1931 Otto Bauer (1881–1938) Thinker and Politician By Ewa Czerwińska-Schupp Translated by Maciej Zurowski leiden | boston This is an open access title distributed under the terms of the cc-by-nc License, which permits any non-commercial use, and distribution, provided no alterations are made and the original author(s) and source are credited. Published with the support of Austrian Science Fund (fwf) First published in German by Peter Lang as Otto Bauer: Studien zur social-politischen Philosophie. © by Peter Lang GmbH. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2005. The Library of Congress Cataloging-in-Publication Data is available online at http://catalog.loc.gov LC record available at http://lccn.loc.gov/2016031159 Typeface for the Latin, Greek, and Cyrillic scripts: “Brill”. See and download: brill.com/brill-typeface. issn 1570-1522 isbn 978-90-04-31573-0 (hardback) isbn 978-90-04-32583-8 (e-book) Copyright 2017 by Koninklijke Brill nv, Leiden, The Netherlands. This work is published by Koninklijke Brill NV. Koninklijke Brill nv incorporates the imprints Brill, Brill Hes & De Graaf, Brill Nijhoff, Brill Rodopi and Hotei Publishing. Koninklijke Brill nv reserves the right to protect the publication against unauthorized use and to authorize dissemination by means of offprints, legitimate photocopies, microform editions, reprints, translations, and secondary information sources, such as abstracting and indexing services including databases. -

DIE VERBORGENE TUGEND Unbekannte Helden Und Diktatur In
DIE VERBORGENE TUGEND Unbekannte Helden und Diktatur in Österreich 1938-1945 LA VIRTÙ NASCOSTA Eroi sconosciuti e dittatura in Austria 1938-1945 herausgegeben von / a cura di Francesco Pistolato VerfasserInnen der Einführungstexte zu den einzelnen Teilen der Ausstellung sowie zu den Bildern sind (in Klammern die Seitennummern): I testi introduttivi alle singole sezioni della mostra e alle immagini sono stati scritti da (tra parentesi i numeri di pagina relativi): Dr. Ursula Schwarz Dr. Tina Bahovec Dr. Francesco Pistolato Ausstellungskonzept / Ideazione della mostra : Karl Stuhlpfarrer, Ursula Schwarz, Francesco Pistolato Redaktion / Revisione : Ursula Schwarz, Katharina Riesinger, Cinzia Cressatti, Gigliola Squerzoni, Patrizia Zin Titel / Copertina : Karl-Heinz Lehmann / Gedenkstätte Deutscher Widerstand Berlin Übersetzungen ins Italienische: Francesco Pistolato Traduzione italiana di Francesco Pistolato Frau Dr. Cinzia Cressatti hat an der Übersetzung mitgearbeitet La Dr.ssa Cinzia Cressatti ha collaborato alla traduzione Bilder aus dem DÖW, hier mit dessen freundlicher Genehmigung veröffentlicht Foto del DÖW, qui riprodotti per gentile concessione dello stesso Gedruckt mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Wien Stampato con il contributo del Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur di Vienna Unterstützt durch das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten in Wien Con il sostegno del Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten di Vienna Biblioteca di Studi Umanistici dell’Università di Udine Die Entstehung der Ausstellung Die verborgene Tugend – La virtù nascosta Das Jahr 2000 war schwierig für Österreich. Jörg Haider hatte mit Aussagen wie u. a. „der ordentlichen Beschäftigungspolitik im Nationalsozialismus“ in der Öffentlichkeit für Diskussionen gesorgt und erregte nun mit der Teilnahme der von ihm geleiteten FPÖ an der Regierung großes Aufsehen und öffentliche Proteste im In- und Ausland. -

Mahnwache Gegen Faschismus Und Krieg
ERSCHEINUNGSORT WIEN/P.B.B./VERLAGSPOSTÄMTER 1150 WIEN, 2700 WR. NEUSTADT/GZ 02Z03355M NUMMER 6-7-8-9/2009, 1,50 EURO 1934–1945 DER SOZIALDEMOKRATISCHE KÄMPFER BUND SOZIALDEMOKRATISCHER FREIHEITSKÄMPFER, OPFER DES FASCHISMUS UND AKTIVER ANTIFASCHISTEN Mahnwache gegen Faschismus und Krieg or 70 Jahren begann mit war ein gezielt geplanter Aggres- des, erinnerte an die schwierige ten Parteien als eine bleibende dem Angriffskrieg Hitler- sionskrieg.“ Weiters erinnerte sie Zeit des Neuanfangs. Er forderte Mahnung der Stadt Wien gegen VDeutschlands auf Po- in ihrer Rede auch an die längst auf zum „unermüdlichen Kampf Faschismus und Krieg durchge- len der Zweite Weltkrieg. Im erforderliche Rehabilitierung gegen Krieg und Faschismus, für setzt. Nedwed erinnerte auch Gedenken an die 55 Millionen der Deserteure und verwies als Frieden, soziale Demokratie und an das Wort Otto Bauers aus Menschen, die auf den Schlacht- ersten Schritt auf das Anerken- Gerechtigkeit“. dem Jahr 1933: „Hitler bedeutet feldern, in den Konzentrations- nungsgesetz 2005. Der Vorsitzende des Bundes Krieg.“ lagern und im Bombenkrieg ihr Bürgermeister Michael Häupl Sozialdemokratischer Freiheits- Zahlreiche Mandatare der Leben lassen mussten, haben die zeigte auf, wie die Stadt Wien kämpfer und Opfer des Faschis- SPÖ, aus dem Nationalrat und Sozialdemokratischen Freiheits- nach den Zerstörungen durch mus Ernst Nedwed erinnerte an aus dem Gemeinderat sowie kämpfer gemeinsam mit der SPÖ die Bombenangriffe auf die Fa- den Philipphof, der auf dem Staatssekretär Andreas Schie- Wiener Bildung und dem Pensi- briken und die Wohnungen mit heutigen Albertinaplatz gestan- der, Vizebürgermeister Michael onistenverband zu einer Mahn- den vielen Flüchtlingen sich zu den ist und der am 12. März Ludwig, Stadträtin Sonja Wehse- wache auf dem Albertinaplatz einer prosperierenden Stadt ent- 1945, genau sieben Jahre nach ly, der Erste Landtagspräsident aufgerufen. -
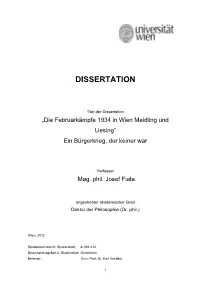
Dissertation
DISSERTATION Titel der Dissertation „Die Februarkämpfe 1934 in Wien Meidling und Liesing“ Ein Bürgerkrieg, der keiner war Verfasser Mag. phil. Josef Fiala angestrebter akademischer Grad Doktor der Philosophie (Dr. phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 092 312 Dissertationsgebiet lt. Studienblatt Geschichte Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Karl Vocelka 1 Isabell Gerhard und Heidi gewidmet 2 Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 8 Einleitung 10 A. Fragestellung 12 B. Forschungsstand 13 C. Methoden 15 1. Die Entwicklungen in der 1. Republik 18 1.1. Ende und Anfang 18 1.1.1. Das Ende der Monarchie 18 1.1.2. Die Entstehung und Ausrufung der Republik 19 1.1.3. Der Friede von St. Germain-en-Laye 1919 20 1.2. Die Gründung der Parteien und der bewaffneten Schutzverbände 22 1.2.1. Die Heimwehren 22 1.2.2. Der Republikanischer Schutzbund 24 1.3. Die Toten von Schattendorf und ihre Folgen 26 1.3.1. Der Feuerüberfall 26 1.3.2. Das Fehlurteil 27 1.3.3. Der Justizpalastbrand 27 1.3.4. Der Schießbefehl durch Polizeipräsident Dr. Johann Schober nach Rücksprache mit Bundeskanzler Dr. Ignaz Seipel 29 1.4. Die Ausschaltung des Parlaments 30 1.4.1. Die Abstimmung bzgl. Eisenbahnerstreik 30 1.4.2. Der formelle Rücktritt aller drei Parlamentspräsidenten – kein offizielles Ende der Parlamentssitzung 31 1.4.3. Die Neueinberufung durch den 3. Präsidenten Dr. Sepp Straffner 32 1.4.4. Der Beginn des Austrofaschismus 33 1.4.5. Die neue Verfassung 34 1.5. Der autoritäre Ständestaat 35 1.5.1. Das Verbot des Republikanischen Schutzbundes 35 1.5.2. -

Der Sozialdemokratische Kämpfer
ERSCHEINUNGSORT WIEN/P.B.B./VERLAGSPOSTÄMTER 1150 WIEN, 2700 WR. NEUSTADT/GZ 02Z033355M NUMMER 10-11-12/2012, 2,00 EURO 1934–1945 DER SOZIALDEMOKRATISCHE KÄMPFER Bund Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer/innen, Opfer des Faschismus und aktiver Antifaschist/inn/en Gedenkjahr 2013 Vor 75 Jahren: „Nacht über Österreich“ m März 1938 hat Österreich zu einem Staatsakt in der Hof- Kagran, des SS-Massakers in Ha- wicklung, die mit den klaren zu existieren aufgehört. Der burg einladen, um an die Opfer dersdorf am Kamp und des Kon- Worten des seinerzeitigen Bun- IWeg von Dollfuß zu Hitler des sieben Jahre währenden na- zentrationslagers Hinterbrühl deskanzlers Vranitzky beginnt, war nur kurz. Er begann mit tionalsozialistischen Regimes zu sind in der Gruppe 40 vergraben in denen er sagte: Österreicher dem Jahr 1933, als das Parla- erinnern. worden. 2.000 Namen sind bis waren sowohl Täter als auch ment ausgeschaltet wurde, und jetzt bekannt. Opfer, aber die Zweite Republik setzte sich fort in den Februar- Vor allem soll auch jener gedacht ist und bleibt die Antithese zum kämpfen 1934 und der austro- werden, die aktiven Widerstand Nun hat die Bundesregierung NS-Gewaltregime. faschistischen Diktatur bis 1938. gegen das Hitler-Regime leiste- über Initiative von Bundeskanz- Der stärkste Widerstand gegen ten. Sie haben bis jetzt im kol- ler Faymann gemeinsam mit den Aber die Forderung nach einem den Nazi-Faschismus, die orga- lektiven Gedächtnis einen Ni- Opferverbänden und dem DÖW Ehrenhain haben schon vorher nisierte Arbeiterschaft, war aus schenplatz eingenom- die Sozialdemokrati- dem staatlichen Leben ausge- men. Es handelt sich schen Freiheitskämp- schaltet. Verzweifelte Versuche um jene Kämpfer, die fer/innen durchge- im Februar 1938, noch eine ge- durch den sogenann- setzt. -

Ausgabe 4/2017
NUMMER 10-11-12/2017, 2 EURO Bundeskonferenz: Neues Statut und neuer Vorstand 100 Delegierte aus (fast) allen Bundesländern – in Vorarlberg haben wir keinen Landes- verband – trafen sich am 18. November im Veranstaltungszentrum Catamaran in Wien zu unserer alle vier Jahre tagenden Bundeskonferenz. Ein Bericht von Gerald Netzl. nossin Thekla Schwantner präsentierte unsere seit einem Jahr bestehende Facebook-Seite, die bereits 844 Follower zählt. Das zeigte Ihre politische Wirkung, besonders an unserer Mo- bilisierung gegen Rot-Blau (mehr als 11.000 Interaktionen!). Bewegend war ein Telefonat mit unserem Besonders erfreulich: Unter den Delegierten langjährigen Funktionär und Ehrenmitglied waren auch viele junge Genossinnen und des Bundesvorstands Peter Lhotzky. Peter ist Genossen. krankheitsbedingt nicht mobil. Das Gespräch Johannes Schwantner und der neue zwischen Johannes Schwantner und Peter Als letzter Redner fungierte beim Tagesord- Bundesvorstand wurden mit breiter Mehrheit war über den Lautsprecher für alle Delegier- nungspunkt „Allfälliges“ unser Gen. Rudi gewählt. Die Redaktion gratuliert herzlich! ten mitzuhören. Gelbard. Die Konferenz endete kurz vor 16:30 Uhr mit der „Internationale“. Einzig bedauer- strid Rompolt, stellvertretende Bezirks- Wahl und engagierte Diskussion lich war, dass viele Genossinnen und Genos- vorsteherin des zweiten Bezirkes, und sen wegen der Bundeskonferenz nicht an der Avida-Bundesgeschäftsführer Bernd Alle KandidatInnen wurden in geheimer am gleichen Tag stattfindenden Gedenkver- Brandstetter adressierten Grußworte an die Wahl mit breiter Mehrheit gewählt, die meis- anstaltung an die von den Nationalsozialisten Konferenz. Stadtrat Michael Ludwig dankte ten einstimmig. Ein Drittel der Mitglieder des ermordeten Roma und Sinti in Lackenbach wie seine VorrednerInnen für unseren Ein- Bundesvorstands bzw. der Rechnungsprü- teilnehmen konnten. satz. Er erinnerte an die Diskussionen An- fung sind neu. -

Sozialistische Jugend-Internationale Archives (1907-) 1923-19461923-1946
Sozialistische Jugend-Internationale Archives (1907-) 1923-19461923-1946 International Institute of Social History Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam The Netherlands hdl:10622/ARCH01370 © IISH Amsterdam 2020 Sozialistische Jugend-Internationale Archives (1907-) 1923-19461923-1946 Table of contents Sozialistische Jugend-Internationale Archives................................................................................. 8 Context............................................................................................................................................... 8 Content and Structure........................................................................................................................9 Access and Use...............................................................................................................................10 Allied Materials.................................................................................................................................10 Appendices.......................................................................................................................................10 INVENTAR...................................................................................................................................... 16 ARCHIV DER INTERNATIONALEN VERBINDUNG DER SOZIALISTISCHEN JUGENDORGANISATIONEN 1907 - 1915................................................................................16 A. Dokumente aus der Amtszeit Hendrik de Man's, 1907-1908.......................................16