Lucille Fletchers Sorry, Wrong Number (1943)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
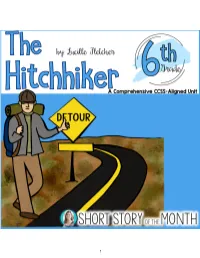
The-Hitchhiker-By-Lucille-Fletcher
1 Short Story of the Month Table of Contents "The Hitchhiker" by Lucille Fletcher Terms of Use 2 Table of Contents 3 List of Activities, Difficulty Levels, and Common Core Alignment 4 Digital Components/Google Classroom Guide 5 Teaching Guide, Rationale, Lesson Plans, and Procedures: EVERYTHING 6-11 Activity 1: Story Devices Interactive Notebook Lesson 12-14 Activity 2: Story Devices Practice w/Key 15-18 Activity 3: Hitchhiker Play Prep Instructions & Role Sheet 19-20 Activity 6: Annotation Guide (Story Devices) 21-23 Activity 7: Basic Comprehension Quiz (Recall Facts and Details) w Key 24-25 Activity 9: Audio Analysis Guide w/Key 26-27 Activity 10: Find Evidence That… Text-Dependent Questions Activity w/Key 28-29 Activity 11: Diagramming a Story Organizer w/Answer Key 30-31 Activity 12: Plot Diagram Quiz w/Key 32-33 Activity 13: Vocabulary Guide – Standardized Test Vocabulary Practice w/Key 34-37 Activity 14: Story Analysis: Plot Development Questions w/Key 38-39 Activity 15: The Hitchhiker Video Analysis w/Key 40-47 Activity 16: Comprehension Skills Test 48-53 Activity 17: Write a Narrative Ending Prewriting Organizer & Rubric 54-55 Activity 18: Nonfiction Paired Text: “Why Is Fear Fun?” 56 Activity 19: Nonfiction Skills Analysis Activity 57-60 Activity 20: Essential Question (Putting It All Together) 61-62 TEKS Alignment 63 3 ©2017 erin cobb imlovinlit.com Short Story of the Month Teacher’s Guide "The Hitchhiker" by Lucille Fletcher Activities, Difficulty Levels, and Common Core Alignment List of Activities & Standards Difficulty Level: *Easy **Moderate ***Challenge Activity 1: Story Devices Lesson** RL.6.3, RL.6.5 Activity 2: Story Devices Practice** RL.6.3, RL.6.5 Activity 3: Hitchhiker Play Prep* SL.6.1, SL.6.2 Activity 4: Journal Activity* SL.6.1 Activity 5: First Read: Play Performance** SL.6.1, SL.6.2, SL.6.5 Activity 6: Annotation Guide (Story Devices)** RL.6.1, RL.6.3, RL.6.5 Activity 7: Comprehension Quiz* RL.6.1 Activity 8: Radio Play Audio Performance* SL.6.2, RL.6.1, RL.6.3 Activity 9: Audio Analysis Guide** RL.6.7. -

The Hitchhiker by Lucille Fletcher.Pdf
The Hitchhiker By Lucille Fletcher ORSON WELLES: Personally, I've never met anybody who didn't like a good ghost story. But I know a lot of people who think there are a lot of people who don't like a good ghost story. For the benefit of these, at least, I go on record at the outset of this evening's entertainment with a sober assurance that, although blood may be curdled on this program, none will be spilt. There's no shooting, knifing, throttling, axing or poisoning here. No clanking chains, no cobwebs, no bony and/or hairy hands appearing from secret panels or, better yet, bedroom curtains. If it's any part of that dear old phosphorescent foolishness that people who don't like ghost stories don't like ... MUSIC: GENTLY OUT WELLES: ... then, again I promise you, we haven't got it. Not tonight. What we DO have is a thriller. If it's half as good as we think it is, you can call it a shocker. It's already been called "a real Orson Welles story." Now, frankly, I don't know what this means. I've been on the air, directing and acting in my own shows for quite a while now and I don't suppose I've done more than half a dozen thrillers in all that time. Honestly, I don't think even THAT many. But it seems I do have a reputation for the uncanny. Quite possibly, a little escapade of mine, involving a couple of planets which shall be nameless, is responsible. -

Suspense Radio Series, Gothic Literature, and the American Family
Utah State University DigitalCommons@USU All Graduate Plan B and other Reports Graduate Studies 5-4-2018 Suspense Radio Series, Gothic Literature, and the American Family Kelly Kirkham Utah State University Follow this and additional works at: https://digitalcommons.usu.edu/gradreports Part of the American Popular Culture Commons Recommended Citation Kirkham, Kelly, "Suspense Radio Series, Gothic Literature, and the American Family" (2018). All Graduate Plan B and other Reports. 1213. https://digitalcommons.usu.edu/gradreports/1213 This Report is brought to you for free and open access by the Graduate Studies at DigitalCommons@USU. It has been accepted for inclusion in All Graduate Plan B and other Reports by an authorized administrator of DigitalCommons@USU. For more information, please contact [email protected]. 1 SUSPENSE RADIO SERIES, GOTHIC LITERATURE, AND THE AMERICAN FAMILY by Kelly D. Kirkham A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF SCIENCE in American Studies Approved: ______________________ ____________________ Dr. Steve Shively Dr. Brian McCuskey Thesis Chair Committee Member ______________________ Peg Arnold Committee Member UTAH STATE UNIVERSITY Logan, Utah 2018 ii Copyright © Kelly Kirkham 2018 All Rights Reserved iii ABSTRACT Suspense Radio Series, Gothic Literature, and the American Family by Kelly D. Kirkham, Master of Science Utah State University, 2018 Major Professor: Dr. Steve Shively Department: English My plan B thesis argues that the Suspense radio series, which aired from 1942- 1963, served as a cathartic release for Americans during the Golden Age of Radio; the program accomplished catharsis by borrowing characteristics originating in 19th century gothic literature: sound effects, domestic space as setting, and the uncanny. -
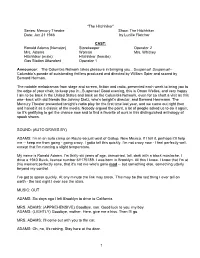
The Hitchhiker” Series: Mercury Theatre Show: the Hitchhiker Date: Jun 21 1946 by Lucille Fletcher
“The Hitchhiker” Series: Mercury Theatre Show: The Hitchhiker Date: Jun 21 1946 by Lucille Fletcher CAST: Ronald Adams (Narrator) Storekeeper Operator 2 Mrs. Adams Woman Mrs. Whitney Hitchhiker (male) Hitchhiker (female) Gas Station Attendant Operator 1 Announcer: The Columbia Network takes pleasure in bringing you...Suspense! Suspense!-- Columbia’s parade of outstanding thrillers produced and directed by William Spier and scored by Bernard Herman. The notable melodramas from stage and screen, fiction and radio, presented each week to bring you to the edge of your chair, to keep you in...Suspense! Good evening, this is Orson Welles, and very happy I am to be back in the United States and back on the Columbia Network, even for so short a visit as this one--back with old friends like Johnny Dietz, who’s tonight’s director, and Bernard Herrmann. The Mercury Theater presented tonight’s radio play for the first time last year, and we came out right then and hailed it as a classic of the media. Nobody argued the point, a lot of people asked us to do it again, so it’s gratifying to get the chance now and to find a favorite of ours in this distinguished anthology of spook shows. SOUND: (AUTO DRIVES BY) ADAMS: I'm in an auto camp on Route 66 just west of Gallup, New Mexico. If I tell it, perhaps it'll help me -- keep me from going - going crazy. I gotta tell this quickly. I'm not crazy now - I feel perfectly well, except that I'm running a slight temperature. -

Lucille Fletcher
Before Reading Video link at The Hitchhiker thinkcentral.com Radio Play by Lucille Fletcher Is seeing BELIEVING? Occasionally, something happens so quickly or unexpectedly, you can’t be sure what you’ve seen. Was that a rabbit racing through the field, or RL 3 Analyze how particular was it just wind in the grass? Did you see a man hiding in the alley, or lines of dialogue or incidents in a story propel the action, reveal did you see only a shadow? To be convinced that something is real, you aspects of a character, or provoke need proof, or solid evidence. In The Hitchhiker, a man is desperate for a decision. proof that what he’s seeing can be explained. DISCUSS Think of something you’ve seen that you can’t explain. Maybe it was oddly shaped footprints in an empty lot, or a bright shape flying through the sky. Share your experience with a small group, and together brainstorm possible explanations. Then tell what proof you’d need to determine which explanation is the right one. 90 090-091_NA_L08PE-u01s05-brHit.indd 90 12/25/10 3:50:53 AM Meet the Author text analysis: foreshadowing When a writer provides hints that suggest future events in a Lucille Fletcher story, the writer is foreshadowing. For example, if a character 1912–2000 says, “Whatever you do, don’t open that door,” you might Suspenseful Stories suspect that the door will eventually be opened to create a As a young adult, Lucille Fletcher wanted dramatic effect. Anticipating that event can add to the story’s to become a novelist. -

A Juggler on the Moon: How Sounds Think in Tom Stoppard's Darkside Neil Verma
Document generated on 09/27/2021 10:47 p.m. Recherches sémiotiques Semiotic Inquiry A Juggler on the Moon: How Sounds Think in Tom Stoppard's Darkside Neil Verma La sémiotique du son : vers une architecture de l’acoustique et de Article abstract l’auralité dans le théâtre post-dramatique. Tome II This essay explores Tom Stoppard’s 2013 radio play Darkside, which Semiotics of Sound: Toward an Architecture of Acoustics and incorporates elements of Pink Floyd’s 1973 album TheDark Side of the Moon, Aurality in Post-Dramatic Theatre. Tome II and dramatizes a series of thought experiments. I show how the combination Volume 36, Number 1-2, 2016 of these three forms necessitates a rethinking of how sounds operate in radio drama, chart the play’s habits of diversion and evasion, and discuss how these URI: https://id.erudit.org/iderudit/1051184ar tendencies are brought to bear on the central theme of climate change. At the heart of this essay is a proposal that the idea of the “sound of thought” DOI: https://doi.org/10.7202/1051184ar embodied in Darkside may prompt a new approach to the theory of radio, one that begins not with what sounds mean, but with how sounds “think”. See table of contents Publisher(s) Association canadienne de sémiotique / Canadian Semiotic Association ISSN 0229-8651 (print) 1923-9920 (digital) Explore this journal Cite this article Verma, N. (2016). A Juggler on the Moon: How Sounds Think in Tom Stoppard's Darkside. Recherches sémiotiques / Semiotic Inquiry, 36(1-2), 181–197. https://doi.org/10.7202/1051184ar Tous droits réservés © Association canadienne de sémiotique / Canadian This document is protected by copyright law. -

Catalog, with Annotated Index of Names & Genealogical Addendum Prepared by Anthony Shafton, 2018–21
Richard Guy Walton Collection, MS/NC 732 1 Catalog, with Annotated Index of Names & Genealogical Addendum prepared by Anthony Shafton, 2018–21 Catalog Introduction Richard Guy Walton (1914–2005) was an artist, photographer and writer. He experimented with many styles of painting over a long career, and is considered Nevada’s preeminent abstract artist of the twentieth century. Walton was born in San Francisco, grew up in Fresno and Stockton, and came to Reno in 1929 to live with his briefly remarried mother. He gained the better part of his art education at Chouinard Art Institute in Los Angeles before returning to Reno to join the Federal Art Project (FAP) of the Works Progress Administration (WPA) under Robert Cole Caples, who became a friend. In 1938 he married Marie Jeanne Etcheberry, daughter of John P. Etcheberry, Basque sheepman, and Louise Larralde Etcheberry, proprietors of Reno’s Santa Fe Hotel. When Walton and Marie Jeanne separated in 1958, Walton moved to Virginia City. He married his second wife Vivian Diane Washburn, daughter of his friend Mary VanderHoeven, in 1963. They lived in Virginia City until 2003 when they were forced by his illnesses to move down the “hill.” The Nevada Historical Society’s Richard Guy Walton Collection, MS/NC 732, comprises 30 boxes of materials plus 2 artworks. The first 12 boxes and the artworks were gifted by the artist to the NHS by a deed dated December 22, 2000. Of these boxes, Boxes 1 through 3 hold voice recordings by Walton, while Boxes 4 through 12 hold documents, letters, manuscripts (typescripts), clippings, photographs, catalogs, magazines, books and miscellaneous objects. -

Emily Brontë's Musical Appropriations
E Emmiillyy BBrroonnttëë’’ss MMuussiiccaall AApppprroopprriiaattiioonnss:: FFrroomm LLiitteerraarryy Ensaio IInnssppiirraattiioonn ttoo PPeerrffoorrmmaattiivvee AAddaappttaattiioonn Paula Guimarães | Universidade do Minho Abstract In comparison with the visual arts, the Brontës’ interactions with and depictions of music have received little critical attention. Besides their well-known skills in drawing and painting, all the Brontë children were competent and knowledgeable musicians; music played an important part both in their family life and in the Victorian public culture. Emily Brontë, in particular, not only possessed a collection of annotated sheet music but was also a virtuoso pianist, exhibiting a taste in both baroque and romantic styles of composition and a fondness for orchestral works. Her preferred composers included Handel, Mozart, Bach, Gluck, Schubert, Rossini, Mendelssohn and Beethoven. Critics such as Robert Wallace (1986) and Meg Williams (2008) have referred to Brontë’s ‘musical matrix’, not only her music-making but also the influence of musical ideas on her writing. The sounds of music release her imagination and she sees a transformative power in them; the music of the wind in her poems runs like a piece of organ-music between the registers of air and earth. Similarly, Wuthering Heights’s mesh of repetitions and variations and its overall rhythmic patterning recalls a ‘cosmic polyphony’. It is therefore no surprise that Emily Brontë’s work has been a source of inspiration for many musicians. As both Patsy Stoneman (1996) and Linda Lister (2008) have documented, Brontë’s only novel has inspired two major operatic realizations, several musical-theatre adaptations, and numerous songs settings by composers in the realms of both classical and popular music. -

Moby Dick Sinfonietta
BERNARD HERRMANN MOBY DICK SINFONIETTA Richard Edgar-Wilson tenor David Wilson-Johnson baritone Danish National Choir Danish National Symphony Orchestra Michael Schønwandt Bernard Herrmann and John Barbirolli, 1940 John Barbirolli, Bernard Herrmannand Courtesy of The Bernard Herrmann Estate Bernard Herrmann (1911 – 1975) Moby Dick (1936 – 38)* 46:20 A Cantata for Male Chorus, Soloists, and Orchestra Text selected and arranged by W. Clark Harrington from the novel by Herman Melville Poul Emborg tenor (Harpooner / Sailor / Voice) Rasmus Gravers tenor (Pip) Uffe Henriksen bass (Drunken Sailor) 1 Chorus: ‘“And God created great whales”’. Maestoso – Più mosso – 1:07 2 Ishmael: ‘Call me Ishmael’. Andante tranquillo – Ishmael: ‘And in the wild conceits’. Agitato – Tempo I – 3:24 3 Hymn. Chorus: ‘The ribs and terrors in the whale’. Slowly and sombrely – Chorus: ‘With speed he flew to my relief‘. Faster – Chorus: ‘My song for ever shall record‘. Allegro moderato – Maestoso – Molto allargando, Pesante – Adagio – 5:57 4 Ishmael: ‘At last anchor was up, the sails were set’. Moderato assai – 1:19 5 Ahab: ‘Send everyone aft; mastheads there! Come down!’ Allegro pesante – Pesante – 3:29 3 6 Ahab: ‘Yonder, by the ever-brimming goblet’s rim’. Lento – Tranquillo – Ahab: ‘I, the wearer, see not its far flashings’. Agitato – Allargando – Tempo I – Accelerando – Allegro – Allargando – Agitato – Ahab: ‘Dry heat upon my brow?’ Slowly – Ahab: ‘Gifted with the high perception’. Agitato – A tempo (Lento) – Ahab: ‘Good night – … good night’. Tempo I – 7:56 7 Voice: ‘Hist, boys! Let’s have a jig!’ Allegro marcato – Allegro (Hornpipe tempo) – Drunken Sailor: ‘Oh! Jolly is the gale’. Meno mosso – Tempo I – Slow – Pip: ‘Oh! Thou big white God aloft there‘. -

Sorry, Wrong Number by Lucille Fletcher
Sorry, Wrong Number By Lucille Fletcher As Lucille once explained in an interview, Sorry, Wrong Number was partially inspired by an incident from someone else's life. While Herrmann was sick at home, Lucille went down to the corner drug store for medicine. Innocently striking up a conversation with her pharmacist, a longtime friend, she raised the ire of an elderly woman who had apparently been waiting first. The woman interrupted and approached the druggist, complaining about poor service and demanding to "know who this interloper is!", referring to Fletcher. Ms. Fletcher, finding the woman's shrill voice and demeanor particularly irritating, went home with the intention of writing a script based around a character with those traits who becomes embroiled in a precarious situation. The radio drama premiered in 1943 and became one of the most legendary radio plays of all time. Agnes Moorehead created the role in the first performance and again in several later radio productions. Barbara Stanwyck starred in the 1948 film version and, in 1952, performed the original radio play over the airwaves. A 1959 version produced for the CBS radio series Suspense received a 1960 Edgar Award for Best Radio Drama. [Sorry, Wrong Number, REV 040707] Page 1 A Brief Note About Radio Play Scripts While it may seem obvious that a script for radio might be formatted differently since there’s no need for the divisions, indentations and annotations required for a reader to highlight visuals, yet, when a reader expects to see a play in a familiar format, there appears to be something missing. -

Lucille Fletcher Biography RACE Response
Name ________________________________ Period _____ Points Possible: Lucille Fletcher Biography RACE Response on Canvas +28 “The Hitchhiker” Comprehension Questions____/136 (4 points for each question) Essay Rough Draft ____/14 Essay +38 (on Canvas) Violet Lucille Fletcher was born March 28, 1912, in Brooklyn, New York. She attended Bay Ridge High School where she was president of the honor society and editor of the school newspaper. Fletcher dreamed of becoming a famous author and created goals that included leadership and earning a college degree. Because she loved public speaking, she joined the debate team where she learned grace under pressure, and critical thinking skills. In 1929, as an eleventh grader, she was declared the champion student orator (speaker) at the regional competition sponsored by The New York Times at The Town Hall in Washington, D.C.. Fletcher was the only female finalist in the entire state of New York and received an all-expense paid trip to South America, a gold medal, a cash prize of $1,000 (about $13,000 today) and an opportunity to compete for the national championship. She placed third in the national competition where she was judged by five justices of the United States Supreme Court. After Fletcher graduated high school, she used her prize money to attend Vassar College. She earned a Bachelor of Arts with honors in 1933 and took her first job at CBS typing scripts for plays as well as reading them with other writers. She loved it and decided she wanted to write plays as well. Though television was invented in the 1920’s, most American households did not have TVs until the late 1950’s. -

TCM Presents ... There's NO Place Like Hollywood
THERE’S NO PLACE LIKE HOLLYWOOD The Definitive Classic Movie Memorabilia Auction MONDAY NOVEMBER 24, 2014 at 1pm NEW YORK TCM PRESENTS ... There’s NO PLACE LIKE HOLLYWOOD Monday November 24, 2014 at 1pm New York BONHAMS INQUIRIES Automated Results Service 580 Madison Avenue Catherine Williamson, Ph.D. +1 (800) 223 2854 New York, New York 10022 Director, Fine Books & Manuscripts/ bonhams.com Entertainment Memorabilia Online bidding will be available for +1 (323) 436 5442 this auction. For further information PREVIEW [email protected] please visit: Los Angeles www.bonhams.com/22196 Thursday November 6, 12pm to 5pm Lucy Carr, Associate Specialist Friday November 7, 12pm to 5pm Entertainment Memorabilia Please see pages 2 to 7 Saturday November 8, 12pm to 5pm +1 (323) 436 5467 for bidder information including Sunday November 9, 12pm to 5pm [email protected] Conditions of Sale, after-sale collection and shipment. New York Dana Hawkes, Consultant Thursday November 20, 12pm to 5pm Entertainment Memorabilia ILLUSTRATIONS Friday November 21, 10am to 5pm +1 (978) 283 1518 Front cover: Lots 83 (Photograph Saturday November 22, 12pm to 5pm [email protected] © Turner Entertainment Co.) and 251 Sunday November 23, 12pm to 5pm Inside front covers: Lots 291 and 347 Monday November 24, 10am to 1pm Katherine Schofield Session page: Lot 48 Head of Department, UK Inside back cover: Lot 244 BIDS Entertainment Memorabilia Back cover: Lot 128 +1 (212) 644 9001 +44 (0) 20 7393 3871 +1 (212) 644 9009 fax [email protected] To bid via the internet please Lisa Charlesworth visit www.bonhams.com Business Administrator +1 (323) 436 5410 SALE NUMBER: 22196 [email protected] Lots 1 - 376 CATALOG: Softcover $45 Limited edition hardcover $100 © 2014, Bonhams & Butterfields Auctioneers Corp.; All rights reserved.