ANDREAS ASCHARIN: Schach-Humoresken
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

David Copperfield: Victorian Hero
David Copperfield: Victorian Hero by James A. Hamby A Dissertation Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of English in the College of Graduate Studies of Middle Tennessee State University Murfreesboro, Tennessee August 2012 UMI Number: 3528680 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. OiSi«Wior» Ftattlisttlfl UMI 3528680 Published by ProQuest LLC 2012. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 Submitted by James A. Hamby in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, specializing in English. Accepted on behalf of the Faculty of the College of Graduate Studies by the dissertation committee: Date: Quaul 3-1.9J310. Rebecca King, Ph.D. ^ Chairperson Date:0ruu^ IX .2.612^ Elvira Casal^Ph.D. N * Second Reader f ./1 >dimmie E. Cain, Ph.D. Af / / / y # Third Reader / diPUt Date:J Tom Strawman, Ph.D. Chair, Department of English (lULa.lh Qtt^bate: 7 SI '! X Michael D.)'. Xllen, Ph.D. Dean of the College of Graduate Studies © 2012 James A. Hamby ALL RIGHTS RESERVED ii For my family. -

David Copperfield Charles Dickens
TEACHER GUIDE GRADES 9-12 COMPREHENSIVE CURRICULUM BASED LESSON PLANS David Copperfield Charles Dickens READ, WRITE, THINK, DISCUSS AND CONNECT David Copperfield Charles Dickens TEACHER GUIDE NOTE: The trade book edition of the novel used to prepare this guide is found in the Novel Units catalog and on the Novel Units website. Using other editions may have varied page references. Please note: We have assigned Interest Levels based on our knowledge of the themes and ideas of the books included in the Novel Units sets, however, please assess the appropriateness of this novel or trade book for the age level and maturity of your students prior to reading with them. You know your students best! ISBN 978-1-50203-727-5 Copyright infringement is a violation of Federal Law. © 2020 by Novel Units, Inc., St. Louis, MO. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or To order, contact your transmitted in any way or by any means (electronic, mechanical, photocopying, local school supply store, or: recording, or otherwise) without prior written permission from Novel Units, Inc. Toll-Free Fax: 877.716.7272 Reproduction of any part of this publication for an entire school or for a school Phone: 888.650.4224 system, by for-profit institutions and tutoring centers, or for commercial sale is 3901 Union Blvd., Suite 155 strictly prohibited. St. Louis, MO 63115 Novel Units is a registered trademark of Conn Education. [email protected] Printed in the United States of America. novelunits.com -

David Copperfield
THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD 30 min Schools Script THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD Play by David Schneider, Armando Iannucci and Simon Blackwell Based on the screenplay by Armando Iannucci and Simon Blackwell and the novel by Charles Dickens All our performers mingle on stage, chatting in character. There’s a lectern to one side of the stage. A few wooden chairs and a table are set out to suggest a living room. NARRATOR DAVID enters, smartly dressed, holding an old- fashioned manuscript book. The performers applaud him and take seats at the sides of the stage where they remain watching except when performing in a scene. The heavily pregnant CLARA takes a seat on one of the chairs in the “living room”. Narrator David goes to the lectern, opens his book and starts to read. NARRATOR DAVID To begin my life with the beginning of my life. Clara lets out a really loud moan. She’s in labour. CLARA AAAAAAAAAAAARGH! PEGGOTTY!!! PEGGOTTY gets up from the seats at the side and rushes around looking for something, including in the audience. PEGGOTTY Peggotty’s coming! As promised! Peggotty promisey. With you in 13 seconds!.. Aha! She finds what she’s looking for: some towels, hidden under one of the seats in the front row. Clara lets out another moan and Peggotty joins her with the towels. CLARA AAAAAAARGH! PEGGOTTY Try to pretend it doesn’t hurt. CLARA But it do-AAAAAAAAAAAAAAGH-es! BETSEY TROTWOOD gets up from her seat, knocks at an imaginary door and opens it. One of the other performers makes the knocking noise with a percussion instrument. -

The Personal History and Experience of David Copperfield the Younger Charles Dickens
The Personal History and Experience of David Copperfield the Younger Charles Dickens The Harvard Classics Shelf of Fiction, Vols. VII & VIII. Selected by Charles William Eliot Copyright © 2001 Bartleby.com, Inc. Bibliographic Record Contents Biographical Note Criticisms and Interpretations I. By Andrew Lang II. By John Forster III. By Adolphus William Ward IV. By Gilbert K. Chesterton V. By W. Teignmouth Shore VI. By George Gissing List of Characters Preface to the First Edition Preface to the “Charles Dickens” Edition I. I Am Born II. I Observe III. I Have a Change IV. I Fall Into Disgrace V. I Am Sent Away from Home VI. Enlarge My Circle of Acquaintance VII. My “First Half” at Salem House VIII. My Holidays. Especially One Happy Afternoon IX. I Have a Memorable Birthday X. I Become Neglected, and Am Provided For XI. I Begin Life on My Own Account, and Don’t Like It XII. Liking Life on My Own Account No Better, I Form a Great Resolution XIII. The Sequel of My Resolution XIV. My Aunt Makes up Her Mind about Me XV. I Make Another Beginning XVI. I Am a New Boy in More Senses Than One XVII. Somebody Turns Up XVIII. A Retrospect XIX. I Look about Me, and Make a Discovery XX. Steerforth’s Home XXI. Little Em’ly XXII. Some Old Scenes, and Some New People XXIII. I Corroborate Mr. Dick and Choose a Profession XXIV. My First Dissipation XXV. Good and Bad Angels XXVI. I Fall into Captivity XXVII. Tommy Traddles XXVIII. Mr. Micawber’s Gauntlet XXIX. -
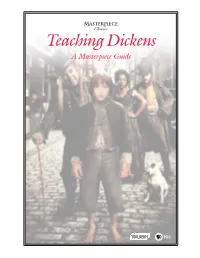
Teaching Dickens a Masterpiece Guide Contents
Teaching Dickens A Masterpiece Guide Contents 2 Introduction 3 General Questions & Activities 7 Oliver Twist 10 David Copperfield 14 Little Dorrit 17 The Old Curiosity Shop 21 Stay Tuned: The Rise of the Killer Serial 26 Resources 29 Credits page 1 Introduction CHARLES DICKENS was the best-known novelist of his time, and is considered by many to be the greatest writer of the Victorian era. A social reformer, Dickens wrote sprawling serial novels that chronicled and condemned the injustices of Victorian society. Yet he was also a deft entertainer and satirist, creating vivid characters, such as Scrooge, Miss Havisham, and Uriah Heep, who are still a part of our culture today. As David Lodge, who adapted the 1995 MASTERPIECE THEATRE production of Martin Chuzzlewit, says in Norrie Epstein’s The Friendly Dickens (Penguin, 2001), “Dickens’ observation of folly, affectation, hypocrisy, self-deception, deception of others, and the way in which people manipulate language to these ends just tickles one. Dickens does what comedy has always done: it both exposes imperfections in the world and reconciles us to it by making something entertaining out of it.” Does Dickens still have something to say to us today? Use the activities and questions in this guide as you watch and read The Tales of Charles Dickens— the all-new 2009 MASTERPIECE adaptations of Oliver Twist, Little Dorrit, and The Old Curiosity Shop, as well as an encore presentation of David Copperfield, which originally aired in 2000. Whether through characters who have counterparts in current pop culture, plot twists that eerily echo stories in our own newspapers, or the universal questions Dickens raises about the mysteries of the human heart, this guide is designed to help readers see Dickens’ relevance to our world today. -

Colby V. Umbrella, Inc. (2006-088)
Colby v. Umbrella, Inc. (2006-088) 2008 VT 20 [Filed 07-Mar-2008] NOTICE: This opinion is subject to motions for reargument under V.R.A.P. 40 as well as formal revision before publication in the Vermont Reports. Readers are requested to notify the Reporter of Decisions, Vermont Supreme Court, 109 State Street, Montpelier, Vermont 05609-0801 of any errors in order that corrections may be made before this opinion goes to press. 2008 VT 20 No. 2006-088 Kerri L. Colby Supreme Court On Appeal from v. Essex Superior Court Umbrella, Inc., Jennifer (Townsend) Grant, February Term, 2007 Michelle Fay, and State of Vermont, Agency of Human Services, Department for Children and Families, Child Development Division Brian J. Grearson, J. Deborah T. Bucknam and Jennifer Bucknam Black of Deborah Bucknam Associates, St. Johnsbury, for Plaintiff-Appellant. William H. Sorrell, Attorney General, Montpelier, and David R. Groff, Assistant Attorney General, Waterbury, for Defendants-Appellees. PRESENT: Reiber, C.J., Dooley, Johnson, Skoglund and Burgess, JJ. ¶ 1. JOHNSON, J. In this suit for wrongful termination, plaintiff Kerri Colby appeals the superior court order denying her motion to amend the complaint and dismissing her claims against defendant State of Vermont. We reverse and remand. ¶ 2. Defendant Umbrella, Inc. is a Vermont corporation that provides support services to domestic violence victims and operates a state-sponsored childcare resource center. Plaintiff was employed by Umbrella’s child-care-resource center from February 2000 to October 2002. In October 2002, her employment with the center was terminated. Plaintiff alleges that she was wrongfully terminated as a result of: (1) expressing concerns about what she considered to be a discriminatory new mission statement, and (2) her qualifiying disability under the Vermont Fair Employment Practices Act (FEPA). -

David Copperfield by Charles Dickens
David Copperfield by Charles Dickens David Copperfield is Dickens eighth novel. First published as a serial by Bradbury & Evans of London from May 1849 to November 1850 and then as a book in 1850. Dickens was 38 years old. To better understand Copperfield, it helps to know something about Dickens life. He was born on a Friday, same as Copperfield (and Saleem Sinai for that matter). Creative, driven, idealistic, passionate, intelligent, conflicted, and temperamental: Dickens said in a letter about himself “I was a great writer at 8 years old or so – was an actor and speaker from a baby… [and I] worked many [of my] childish experiences and … struggles into Copperfield.” Like Micawber, his father was sent to debtors prison accompanied by his wife and 4 youngest children. Similar to young David’s neglect, the 12-year-old Charles, no longer able to attend school, lived in a boarding house and worked in factory putting labels on bottles of shoe polish. As a young man, Dickens quickly mastered court reporting and made a living reporting on parliamentary debates before the success of his own writing took off. In his literary career, Dickens created over 2,000 characters and if the list were read aloud it would be shocking how many of them are recollected. To name just a few: Pecksniff, Scrooge, Oliver Twist, the Artful Dodger, Wackford Squeers, Sydney Carton, Fagin, Tiny Tim, Uriah Heep and Wilkins Micawber. In a speech commemorating Shakespeare’s birthday Dickens’s remarked “We meet on this day to celebrate the birthday of a vast army of living men and women who will live forever with an actuality greater than that of the men and women whose external forms we see around us…” Elsewhere Dickens wrote “Of all my books, … I like [Copperfield] the best. -

Original Complete Edition Price One Penny
DVE RTISEMEN T A S . ’ D I C K S B R I T I S H D R A M A . D ILLUSTRATE . Co risin the W ks o f the mo s c el eb a d mp g or t r te dramatists. o l in T el e Vo lume s ice OneShi lli each er o s o C mp ete w v , pr ng p p t, F urp ence e x tra. V — — ” a - — 1 conta i ns : Th e G a e e J ne S h re Th e Man th e . W L ve in a Vi a Pi a , m st r o of orld o ll e z rro — — — — g Th e Mayor of Garratt The Ro a d to Ruin The In con sta nt The Reve n e The Jealous Wife — — — g— }h e S t00ps to Conquer Dougla s The Devil to Pay Th e Adopte d Child Th e C a stle Spectre Bivals— i a —The S a n e —Ve ni e e e ve —G an ne in —Fa a i i M d s tr g r c Pr s r d uy M r g t l Cur os ty . V' l N e Wa to Pa Deb —Th e e ian Da —Th i — . 2 co ntai ns : A w y y Old ts Gr c ughter e M lle r a nd hi s Men Th e , — — Hon eymoon—Th e F air Pen iten t The Prov ok ed Husb and ATale of Myste ry—Th e Wonder—The — — — — C a stle of S oren to The S chool fo r S can d a l Th e l ro n Che s t George Barn well Ro b Ro y Ma cgre gor — — — ab a the a ta a ia —Th f — C ato Th e Pilot Is ell or. -

Dickens and Shakespeare's Household Words
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by DigitalCommons@Linfield Linfield College DigitalCommons@Linfield Faculty Publications Faculty Scholarship & Creative Works 2011 Dickens and Shakespeare’s Household Words Daniel Pollack-Pelzner Linfield College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.linfield.edu/englfac_pubs Part of the Dramatic Literature, Criticism and Theory Commons, and the Literature in English, British Isles Commons DigitalCommons@Linfield Citation Pollack-Pelzner, Daniel, "Dickens and Shakespeare’s Household Words" (2011). Faculty Publications. Accepted Version. Submission 58. https://digitalcommons.linfield.edu/englfac_pubs/58 This Accepted Version is protected by copyright and/or related rights. It is brought to you for free via open access, courtesy of DigitalCommons@Linfield, with permission from the rights-holder(s). Your use of this Accepted Version must comply with the Terms of Use for material posted in DigitalCommons@Linfield, or with other stated terms (such as a Creative Commons license) indicated in the record and/or on the work itself. For more information, or if you have questions about permitted uses, please contact [email protected]. Dickens and Shakespeare’s Household Words Daniel Pollack-Pelzner “‘Familiar in their Mouths as HOUSEHOLD WORDS.’—SHAKESPEARE.” —Epigraph to Charles Dickens’s weekly periodical, Household Words In the nineteenth century, perhaps no writer earned more comparisons to Shakespeare than Dickens, and the comparison has endured to the present. We are familiar with the qualities they share: a remarkable range of memorable characterization, flights of verbal invention, the ability to mix tragedy and comedy, reinvigorating traditional genres and plots, and a highly performative, even meta-theatrical sensibility. -
Ch 4 Problems 5Th Edition.Pdf
Problems | 111 R e f e r e n c e s 1. M. Gerken, G. J. Schrobilgen, Inorg. Chem. , 2002 , 2. J. A. Boatz, K. O. Christe, D. A. Dixon, B. A. Fir, 41 , 198. M. Gerken, R. Z. Gnann, H. P. A. Mercier, G. J. Schrobilgen, Inorg. Chem ., 2003 , 42 , 5282. General References There are several helpful books on molecular symmetry and Symmetry Through the Eyes of a Chemist , 2nd ed., Plenum Press, its applications. Good examples are D. J. Willock, Molecular New York, 1995. The last two also provide information on space S y m m e t r y , John Wiley & Sons, Chichester, UK, 2009; F. A. groups used in solid state symmetry, and all give relatively gentle Cotton, Chemical Applications of Group Theory, 3 r d e d . , J o h n introductions to the mathematics of the subject. For an explana- Wiley & Sons, New York, 1990; S. F. A. Kettle, Symmetry and tion of situations involving complex numbers in character tables, Structure: Readable Group Theory for Chemists , 2 n d e d . , J o h n see S. F. A. Kettle, J. Chem. Educ. , 2009 , 86 , 6 3 4 . Wiley & Sons, New York, 1995; and I. Hargittai and M. Hargittai, Problems 4.1 Determine the point groups for 4.5 Determine the point groups for Cl a. Ethane (staggered conformation) a. 1,1Ј - Dichloroferrocene b. Ethane (eclipsed conformation) c. Chloroethane (staggered conformation) d. 1,2-Dichloroethane (staggered anti conformation) b. Dibenzenechromium Fe 4.2 Determine the point groups for (eclipsed conformation) a. Ethylene H H b. -

Dickens's Hyperrealism
Dickens’s Hyperrealism CD Dickens’s Hyperrealism JOHN R. REED CDTHE OHIO STATE UNIVERSITY PRESS • COLUMBUS Copyright © 2010 by The Ohio State University. All rights reserved. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Reed, John Robert, 1938– Dickens’s hyperrealism / John R. Reed. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-8142-1138-0 (cloth : alk. paper)—ISBN 978-0-8142-9237-2 (cd) 1. Dickens, Charles, 1812–1870—Criticism and interpretation. 2. Realism in literature. I. Title. PR4592.R37R44 2010 823’.8—dc22 2010028505 This book is available in the following editions: Cloth (ISBN 978-0-8142-1138-0) CD-ROM (ISBN 978-0-8142-9237-2) Cover design by Jennifer Shoffey Forsythe Text design by Jennifer Shoffey Forsythe Type set in Adobe Minion Pro Printed by Thomson-Shore, Inc. The paper used in this publication meets the minimum requirements of the Amer- ican National Standard for Information Sciences—Permanence of Paper for Printed Library Materials. ANSI Z39.48–1992. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 CONTENTS Acknowledgments vii Introduction 1 Chapter 1 Description 11 Chapter 2 Present Tense 25 Chapter 3 Naming 42 Chapter 4 The Gentleman in the White Waistcoat: Dickens and Metonymy 54 Chapter 5 Dickens and Personification 71 Chapter 6 The Riches of Redundancy: Our Mutual Friend 85 Conclusion 105 Notes 107 Bibliography 121 Index 129 ACKNOWLEDGMENTS The chapters in this book have appeared elsewhere as individual essays in shorter forms with somewhat different purposes: • “Dickens on Jacob’s Island and the Functions of Literary Descriptions.” Narrative 7, no. 1 (January 1999): 22–36. -
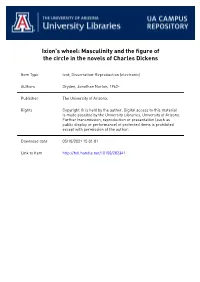
Proquest Dissertations
Ixion's wheel: Masculinity and the figure of the circle in the novels of Charles Dickens Item Type text; Dissertation-Reproduction (electronic) Authors Dryden, Jonathan Norton, 1962- Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 05/10/2021 15:01:01 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/282341 INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfihn master. UMI fihns the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter &ce, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book.