Schriftenreihe „Studium Generale“
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Was Heißt Bürokratischer Sozialismus? Versuch Einer Würdigung Von Rudolf Baltros ,,Anatomie Des Real Existierenden Sozialismu
Gert Schäfer Was heißt bürokratischer Sozialismus? Versuch einer Würdigung von Rudolf Baltros ,,Anatomie des real existierenden So- zialismus" ( 1) · ,,Ich bin mit absoluter Ernsthaftig keit herangegangen, mit aller Auf richtigkeit und Konsequenz. Ich habe nicht nur meinen Verstand, sondern meine staatsbürgerliche Existenz in die Waagschale gewor fen." Rudolf Bahro 1. Plädoyer, sich Rudolf Bahros Argumentation wirklich.auszusetzen Bahros Umrisse „zur Kritik des real existierenden Sozialismus" (2) sind mit gutem Recht als das wichtigste theoretische Werk aus den sozialistisch genannten Ländern seit Leo Trotzkis ,Die verratene Revolution' gerühmt worden (3). Der moralische, intellektuelle und politische Mut Bahros läßt sich kaum besser als mit seinen eige nen, oben zitierten Worten würdigen. Daß er dabei von sich selber sagen kann, ,,ich bin in meiner gesamten Entwicklung sozusagen ein DDR-Produkt, durch und durch" (4), mag einmal - um an das.alte Gleichnis zu.erinnern - auch die Schande jener tilgen, die ihn der „nachrichtendienstlichen Tätigkeit" bezichtigt und „aus dem Ver kehr gezog~n "_ haben. So lautet der II. Teil des Buches J)ie Alternative. Zur Kritik des real existierenden Sozia lismus', EVA, Köln - Frankfurt/M. 1977 2 Bahro benutzt die „defensive Formel" (Alternative, S. 20) vom real existierenden Sozia lismus in einem ironischen Sinn, der Bekanntheit halber (vgl. ebda, S. 25). Seine eigene Charakterisierung dieser Ordnung als „protosozialistisch" zielt auf die tatsächlich wesent liche Tatsache, daß die „Vergesellschaftung als entscheidendes Formationsmerkmal des So_zialismus noch vollständig etatistisch verlarvt ist" ( ebda). Übrigens verwendete Trotzki an einer Stelle seiner , Verratenen Revolution' ebenfalls das Bild von der Larve: ,,Um ge sellschaftliches Eigentum zu werden, muß das Privateigentum unvermeidlich das staatli che Stadium durchlaufen, so wie die Raupe durch das Stadium der Larve gehen muß, um Schmetterling zu werden. -

Unireport 04-19 Goethe-Universität Frankfurt
UniReport 4.19 UniReport | Nr. 4 | 11. Juli 2019 | Jahrgang 52 | Goethe-Universität Frankfurt am Main Beiträge zum 90. Geburtstag von Jürgen Habermas Suspended Life – Von Birgitta Wolff, Rainer Forst, Klaus Günther und Rolf Wiggershaus 2ff »eingefrorenes« Leben Gesunde Führungskräfte – ein Gewinn Ein Projekt zu Chancen und Risiken für Mitarbeiter und Organisation? der Kryotechnologie Die Sozialpsychologin Antonia Kaluza erforscht den Zusammenhang von Seite 9 Wohlbefinden und Führungsstil. 7 Grenzen überschreiten mit »Imara« Der Wirtschaftsingenieur Baraa Abu El-Khair entwickelt Empfehlungen für Moscheegemeinden. 10 Kunstwerke aus Wachs Die Moulagensammlung des Universitäts klinikums vermittelt einen lebensechten Eindruck von Hautkrank- heiten aller Art. 14 Philanthropie und Macht Der Politische Philosoph Theodore M. Lechterman erforscht, wie Stifterkultur und Demokratie zusammenpassen. Foto: CI Photos, Shutterstock 16 Editorial Philosoph, Aufklärer und Intellektueller Liebe Leserinnen und Leser, nach einem für Sie hoffentlich erfolg Jürgen Habermas an der Goethe-Universität reichen Sommersemester startet die GoetheUni bald in die vorlesungsfreie ie GoetheUniversität stand an drei europäischen Zusammenarbeit. In einer per Zeit. Viele werden dann Frankfurt erst Tagen ganz im Zeichen von Jürgen sönlichen Bemerkung zum Schluss seines mal verlassen; viele von uns werden sich Habermas, der aus Anlass seines Vortrags ließ Habermas seine Erfahrungen in um Arbeiten kümmern, die in der Hektik 90. Geburtstages an seine ehemalige Frankfurt Revue passieren, wo er nach eige des Semesters liegen geblieben sind oder DWirkungsstätte zurückgekehrt war. Dem viel ner Aussage insbesondere in den frühen 80er erst jetzt anstehen: Prüfungen oder beachteten Vortrag des wichtigsten deutschen Jahren „die befriedigendste Zeit“ seines aka Praktika zum Beispiel, oder der Job für Philosophen der Gegenwart, zu dem rund demischen Lebens verbracht hat. -

Reformen Und Reformer Im Kommunismus
Wladislaw Hedeler / Mario Keßler (Hrsg.) Reformen und Reformer im Kommunismus Für Theodor Bergmann Eine Würdigung V VS Wladislaw Hedeler / Mario Keßler (Hrsg.) Reformen und Reformer im Kommunismus Wladislaw Hedeler / Mario Keßler (Hrsg.) Reformen und Reformer im Kommunismus Für Theodor Bergmann. Eine Würdigung Eine Veröffentlichung der Rosa-Luxemburg-Stiftung VSA: Verlag Hamburg www.vsa-verlag.de Dieses Buch wird unter den Bedingungen einer Creative Commons License veröffentlicht: Creative Commons Attribution-NonCom- mercial-NoDerivs 3.0 Germany License (abrufbar unter www.cre- ativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode). Nach dieser Lizenz dürfen Sie die Texte für nichtkommerzielle Zwecke vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zu- gänglich machen unter der Bedingung, dass die Namen der Autoren und der Buchtitel inkl. Verlag genannt werden, der Inhalt nicht bearbeitet, abgewandelt oder in anderer Weise verändert wird und Sie ihn unter vollständigem Abdruck dieses Lizenzhinweises weitergeben. Alle anderen Nutzungsformen, die nicht durch diese Creative Commons Lizenz oder das Urheberrecht gestattet sind, bleiben vorbehalten. © VSA: Verlag 2015, St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg Die Umschlagfotos zeigen (v.l.n.r.): obere Reihe: Robert Havemann, Liu Shaoqi, Rosa Luxemburg; untere Reihe: Fritz Behrens, Che Guevara, Nikolai Bucharin Druck und Buchbindearbeiten: CPI books GmbH, Leck ISBN 978-3-89965-635-0 Inhalt Wladislaw Hedeler / Mario Keßler Reformen und Reformer im Kommunismus – zur Einführung .......................... 9 SBZ -
Herz, John H.; Papers
Herz, John H.; Papers This finding aid was produced using ArchivesSpace on September 28, 2021. M.E. Grenander Department of Special Collections & Archives Herz, John H.; Papers Table of Contents Summary Information .................................................................................................................................... 3 Biographical Sketch ....................................................................................................................................... 3 Scope and Contents ........................................................................................................................................ 7 Arrangement of the Collection ...................................................................................................................... 7 Administrative Information ............................................................................................................................ 8 Controlled Access Headings .......................................................................................................................... 9 Collection Inventory ....................................................................................................................................... 9 Biographical & autobiographical materials ................................................................................................ 9 General correspondence ........................................................................................................................... -

Egbert Jahn• Neue Fronten Nach Dem Krieg
Egbert Jahn • Neue Fronten nach dem Krieg Russland, der Westen und die Zukunft im Südkaukasus Der Krieg zwischen Georgien und Russland im August 2008 hat die Lage im Kaukasus drastisch verändert und die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen belastet. Russlands militärischer Erfolg könnte sich als Pyrrhussieg erweisen. Georgiens Westorientierung dürfte endgültig sein. Durch die neue strategische Lage ist Armenien geopolitisch isoliert. Es muss sich außenpolitisch neu orientieren. Dies bringt Bewegung in den Konflikt um Bergkarabach. Sollte Georgien in die NATO aufgenommen werden und der Westen auf der territorialen Integrität Georgiens beharren, müsste von einer rechtswidrigen Präsenz russländischer Truppen auf NA- TO-Gebiet gesprochen werden. Eine Entschärfung der Lage ist nur da- durch zu erreichen, dass Russland die Unabhängigkeit des Kosovo und der Westen jene Südossetiens und Abchasiens anerkennen. Russland hatte schon lange vor der absehbaren Anerkennung der Unabhängigkeit Kosovos durch die meisten westlichen Staaten, die sogleich nach der förmlichen Un- abhängigkeitserklärung des kosovarischen Parlaments am 17. Februar 2008 erfolgte, davor gewarnt, dass es seinerseits mit einer Anerkennung Südossetiens und Abchasi- ens reagieren könne. Während die westliche Anerkennung der Separation Kosovos völkerrechtswidrig sei, sei hingegen eine Anerkennung Südossetiens und Abchasiens mit dem Völkerrecht vereinbar. Dennoch zögerte Russland in den folgenden Mona- ten, diesen Schritt zu gehen. Erst nach dem Angriff Georgiens auf Südossetien am 7. August ging Russland zum militärischen Gegenangriff über, erkannte die Unabhängigkeit Südossetiens und Ab- chasiens an und ließ sich von ihnen zu einer stärkeren Truppenpräsenz in beiden Ge- bieten einladen, nachdem die EU einen Waffenstillstand zwischen Russland und Ge- orgien vermittelt hatte. Nun stellen sich fünf Fragen. -
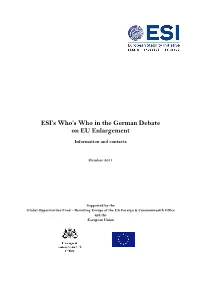
ESI's Who's Who in the German Debate on EU Enlargement
ESI’s Who’s Who in the German Debate on EU Enlargement Information and contacts October 2011 Supported by the Global Opportunities Fund – Reuniting Europe of the UK Foreign & Commonwealth Office and the European Union ~ Contents ~ ABOUT THIS MANUAL ............................................................................................................................................ 3 A. CORE FACTS – GERMANY AND ENLARGEMENT .............................................................................. 4 GERMAN POLICY MAKING ......................................................................................................................................................... 4 THE GERMAN MILITARY AND THE BALKANS ...................................................................................................................... 5 GERMAN POPULATION AND MIGRATION .............................................................................................................................. 5 BUSINESS INTERESTS: EXPORTS TO SOUTH EAST EUROPE .............................................................................................. 7 FOREIGNERS AND CRIME IN GERMANY ................................................................................................................................. 7 GERMAN TOURISM TO THE BALKANS .................................................................................................................................... 8 B. MEDIA ................................................................................................................................................................. -

MZES Annual Report 2006
Annual Report 2006 Annual Report 2006 Mannheim 2007 Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) Universität Mannheim D-68161 Mannheim Phone ++49 (0)621-181 2868 Fax ++49 (0)621-181 2866 E-mail [email protected] WWW http://www.mzes.uni-mannheim.de This report was produced by Wolfgang C. Müller, Bernhard Ebbinghaus and Franz Urban Pappi, with the support of the research area coordinators and the department secretaries Layout: Christian Melbeck Editing: Sibylle Eberle, Reinhart Schneider Contents 1 Director's Annual Report 2006.......................................................................................... 3 1.1 Introduction ................................................................................................................. 3 1.2 Organisation of the MZES and its major research areas................................. 4 1.3 Personnel development............................................................................................. 8 1.4 Other resources and project grants.....................................................................11 1.5 The MZES infrastructure.........................................................................................14 1.6 Cooperation and exchange....................................................................................15 1.7 The MZES – a place for young scholars .............................................................18 1.8 Publications and rewards.......................................................................................20 -

Annual Report 2008 Mannheim 2009
Annual Report 2008 Annual Report 2008 Mannheim 2009 Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) Universität Mannheim D-68131 Mannheim Phone ++49 (0)621-181 2868 Fax ++49 (0)621-181 2866 E-mail [email protected] WWW http://www.mzes.uni-mannheim.de This report was produced by: Bernhard Ebbinghaus, Josef Brüderl, Thomas König, with the support of the research area coordinators, project directors and researchers From the infrastructure Franz Kraus, Christian Melbeck, Hermann Schmitt and Hermann Schwenger assisted the production; the secretaries of the departments – Constanze Nickel, Beate Rossi, Marianne Schneider, Christine Stegmann – and the directorate – Sibylle Eberle, Josiane Hess – as well as Nikolaus Hollermeier were essential assets. Layout and editing: Marlene Alle, Christian Melbeck, Reinhart Schneider Photos: Nikolaus Hollermeier, Bernhard Ebbinghaus, Reinhart Schneider Contents 1 Director's Introduction.......................................................................................................... 3 1.1 The MZES ...................................................................................................................... 3 1.2 Organisation of the MZES and its major research areas................................. 4 1.3 Personnel development...........................................................................................10 1.4 Resources and project grants................................................................................16 1.5 MZES service units: from infrastructure -

9783658251987.Pdf
Studien des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung Azer Babayev · Bruno Schoch Hans-Joachim Spanger Editors The Nagorno- Karabakh deadlock Insights from successful conflict settlements Studien des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfiktforschung In der Schriftenreihe werden grundlegende Forschungsergebnisse aus dem Institut, Beiträge zum friedens- und sicherheitspolitischen Diskurs sowie Begleitpublika- tionen zu den wissenschaftlichen Tagungen der HSFK veröffentlicht. Die Studien unterliegen einem externen Gutachterverfahren. Die Reihe wird herausgegeben vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfiktforschung (HSFK/ PRIF), Frankfurt am Main. Weitere Bände in der Reihe http://www.springer.com/series/15640 Azer Babayev · Bruno Schoch · Hans-Joachim Spanger Editors The Nagorno-Karabakh deadlock Insights from successful confict settlements Editors Azer Babayev Bruno Schoch ADA University PRIF – Peace and Research Institute Baku, Azerbaijan Frankfurt Frankfurt am Main, Germany Hans-Joachim Spanger PRIF – Peace and Research Institute Frankfurt Frankfurt am Main, Germany Studien des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfiktforschung ISBN 978-3-658-25198-7 ISBN 978-3-658-25199-4 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-658-25199-4 Library of Congress Control Number: 2019933162 Springer VS © Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, part of Springer Nature 2020 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifcally the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microflms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. -

Geopolitik – Was Ist Das?
Geopolitik – was ist das? Vortrag beim 16. Schlangenbader Gespräch „Krise: Der globale Wandel und seine bilateralen Folgen“ der Friedrich-Ebert-Stiftung, Moskau und der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Kooperation mit dem Institut für Weltwirtschaft und Internationale Be- ziehungen, Moskau und der Konrad-Adenauer-Stiftung, Moskau in Schlangenbad vom 25.-27. April 2013 Egbert Jahn April 2013 Adresse des Autors: Prof. em. Dr. Egbert Jahn Universität Mannheim Lehrstuhl für Politische Wissenschaft und Zeitgeschichte Seminargebäude A 5 D-68131 Mannheim Tel.: +49-621 181 2088 Fax: +49-621-181 2087 Email: [email protected] Homepage: http://fkks/uni-mannheim.de 2 Egbert Jahn Geopolitik – was ist das?1 1 Das Verständnis von Geopolitik als Wissenschaft, nicht als Politik Geopolitik „ist“ nicht etwas, sondern bedeutet das, was man darunter verstehen will und andere darunter verstanden haben. Und das war in der Vergangenheit, in den einzelnen Ländern und bei den einzelnen Benutzern des Wortes, zum Teil recht Unterschiedliches. So existieren vor allem auch heute in Deutschland und Rußland gänzlich unterschiedliche Auf- fassungen von und Einstellungen zur Geopolitik. Zu rußländischen Ansichten über Geopolitik möchte ich hier nicht viel sagen, da sich nachher Sergej Karaganov und Andrej Zubov dazu äußern werden. Vermutlich ist die Popularität der Geopolitik im gegenwärtigen Rußland eine Folge der Verunsicherung durch die Auflösung der Sowjetunion und der Versuche, zumindest Elemente des politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Zusammenhalts im post- sowjetischen oder gar im postkommunistischen Raum (Beispiel Serbien- und Kosovo-Politik Rußlands) zu erhalten und den eigenen Großmachtstatus zu stärken. In Deutschland ist seit Mai 1945 Geopolitik ein weithin geächtetes Wort, da viele unter Geo- politik eine Legitimationswissenschaft2 oder auch nur eine Pseudowissenschaft und Ideologie3 im Dienste der nationalsozialistischen Eroberungs- und Vernichtungspolitik ver- stehen. -

Successful Prevention of War and Civil War in 16 Examples
SUCCESSFUL PREVENTION OF WAR AND CIVIL WAR IN 16 EXAMPLES ASPR REPORT NO. 4/2020 TABLE OF CONTENTS The Realization of the Promise of Prevention Namibia – South Africa 1989: Kofi Annan.. .......................................................................... 3 The April Crisis and how the Transition Process in Namibia was Rescued Preface Reinhart Kößler ................................................................... 22 Reiner Steinweg, Frieder Schöbel ...................................... 4 Northern Ireland 1976-2007: The Åland Islands 1918: How the Civil War was Brought to an End The Conflict between Finland and Sweden Angela Mickley, Frieder Schöbel, Reiner Steinweg .......... 24 Saskia Thorbecke, Reiner Steinweg ................................... 5 Peru – Ecuador 1998: Argentina – Chile 1978-1984: A Creative Peace Treaty for a Centuries-Old Conflict A Century of Conflict over the Beagle Channel Therese Bachmann .............................................................. 26 Markus Weingardt ............................................................... 7 Romania – Hungary 1990-2007: Bosnia and Herzegovina 1995: Appropriate Treatment of Minorities The Provisions of the Dayton Agreement Helmolt Rademacher .......................................................... 29 Saskia Thorbecke, Reiner Steinweg ................................... 9 Tunisia 2011-2014: Denmark – Germany 1920-1955: A „Quartet“ Prevents a Civil War and Gets How to Pacify a Minority Conflict the Nobel Peace Prize Jørgen Kühl ......................................................................... -

Bulletin of the GHI Washington
Bulletin of the GHI Washington Issue 3 Fall 1988 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. II. Research and Teaching of American History and Politics in Departments of History and Political Science in the Federal Republic of Germany In this issue of the Bulletin, we shall present an overview of the research and teaching of American history and politics in the Federal Republic of Germany. We do not, however, claim this overview to be complete. The report is based on the information provided us by the institutions referred to below. For lack of space, the lists of publications which some had sent us have been omitted. In contrast to the tradition of research and teaching of East European history, American history in German universities has been and still is sorely neglected. With the few exceptions of institutes which specialize in this subject, (John F. Kennedy Institute, Berlin; Center for North American Studies and Research, Frankfurt; Chair for "Ueberseegeschichte" in the History Department of Hamburg University; American Studies Institute, Munich; Anglo-Amerikanische Abteilung of the History Department at the University of Cologne), the teaching of American history remains to a large extent only a part of the general tasks allotted to chairs in Modern History.