Die Sukkulenten Senecio-Arten
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
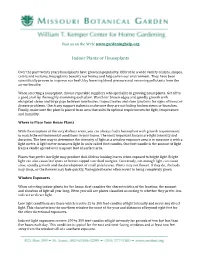
Indoor Plants Or Houseplants
Visit us on the Web: www.gardeninghelp.org Indoor Plants or Houseplants Over the past twenty years houseplants have grown in popularity. Offered in a wide variety of sizes, shapes, colors and textures, houseplants beautify our homes and help soften our environment. They have been scientifically proven to improve our health by lowering blood pressure and removing pollutants from the air we breathe. When selecting a houseplant, choose reputable suppliers who specialize in growing houseplants. Get off to a good start by thoroughly examining each plant. Watch for brown edges and spindly growth with elongated stems and large gaps between new leaves. Inspect leaves and stem junctions for signs of insect or disease problems. Check any support stakes to make sure they are not hiding broken stems or branches. Finally, make sure the plant is placed in an area that suits its optimal requirements for light, temperature and humidity. Where to Place Your House Plants With the exception of the very darkest areas, you can always find a houseplant with growth requirements to match the environmental conditions in your home. The most important factors are light intensity and duration. The best way to determine the intensity of light at a window exposure area is to measure it with a light meter. A light meter measures light in units called foot-candles. One foot-candle is the amount of light from a candle spread over a square foot of surface area. Plants that prefer low light may produce dull, lifeless-looking leaves when exposed to bright light. Bright light can also cause leaf spots or brown-tipped scorched margins. -

Field Release of the Leaf-Feeding Moth, Hypena Opulenta (Christoph)
United States Department of Field release of the leaf-feeding Agriculture moth, Hypena opulenta Marketing and Regulatory (Christoph) (Lepidoptera: Programs Noctuidae), for classical Animal and Plant Health Inspection biological control of swallow- Service worts, Vincetoxicum nigrum (L.) Moench and V. rossicum (Kleopow) Barbarich (Gentianales: Apocynaceae), in the contiguous United States. Final Environmental Assessment, August 2017 Field release of the leaf-feeding moth, Hypena opulenta (Christoph) (Lepidoptera: Noctuidae), for classical biological control of swallow-worts, Vincetoxicum nigrum (L.) Moench and V. rossicum (Kleopow) Barbarich (Gentianales: Apocynaceae), in the contiguous United States. Final Environmental Assessment, August 2017 Agency Contact: Colin D. Stewart, Assistant Director Pests, Pathogens, and Biocontrol Permits Plant Protection and Quarantine Animal and Plant Health Inspection Service U.S. Department of Agriculture 4700 River Rd., Unit 133 Riverdale, MD 20737 Non-Discrimination Policy The U.S. Department of Agriculture (USDA) prohibits discrimination against its customers, employees, and applicants for employment on the bases of race, color, national origin, age, disability, sex, gender identity, religion, reprisal, and where applicable, political beliefs, marital status, familial or parental status, sexual orientation, or all or part of an individual's income is derived from any public assistance program, or protected genetic information in employment or in any program or activity conducted or funded by the Department. (Not all prohibited bases will apply to all programs and/or employment activities.) To File an Employment Complaint If you wish to file an employment complaint, you must contact your agency's EEO Counselor (PDF) within 45 days of the date of the alleged discriminatory act, event, or in the case of a personnel action. -

Ceropegia Woodii (Rosarhy Vine, String of Hearts ) Ceropegia Can Be Evergreen Or Semi-Evergreen Climbing Plants Usually Succulent, Perennials with Opposite Leaves
Ceropegia woodii (Rosarhy Vine, String of Hearts ) Ceropegia can be evergreen or semi-evergreen climbing plants usually succulent, perennials with opposite leaves. The plant can reach 10 cm in height and 1.5-2 m in spread. Ceropegia is originated from south Africa. The minimum temperature is can handle is 15 C. Used as house plants. Landscape Information French Name: Ceropegia, Céropégie ou Chaîne des coeurs Pronounciation: seer-oh-PEEJ-ee-uh WOOD- ee-eye Plant Type: Vine Origin: South Africa Heat Zones: 8, 9, 10, 11, 13 Hardiness Zones: 10, 11, 12, 13 Uses: Indoor, Container Size/Shape Growth Rate: Slow Tree Shape: Height at Maturity: Less than 0.5 m Spread at Maturity: 1.5 to 3 meters Time to Ultimate Height: 2 to 5 Years Plant Image Ceropegia woodii (Rosarhy Vine, String of Hearts ) Botanical Description Foliage Leaf Arrangement: Opposite Leaf Venation: Parallel Leaf Persistance: Evergreen Leaf Type: Simple Leaf Blade: Less than 5 Leaf Shape: Obovate Leaf Margins: Entire Leaf Textures: Waxy Leaf Scent: No Fragance Color(growing season): Green Color(changing season): Green Flower Flower Showiness: True Flower Size Range: 0 - 1.5 Flower Scent: No Fragance Flower Color: Yellow, White Seasons: Year Round Fruit Seasons: Year Round Flower Image Ceropegia woodii (Rosarhy Vine, String of Hearts ) Horticulture Management Tolerance Frost Tolerant: No Heat Tolerant: No Drought Tolerant: Yes Salt Tolerance: Poor Requirements Soil Requirements: Clay, Loam Soil Ph Requirements: Acidic, Neutral Water Requirements: Moderate Light Requirements: Part, Shade Management Life Span: Less than 25 Edible Parts: None Pests: Mealy-Bug Plant Propagations: Division, Rhizomes Leaf Image MORE IMAGES Fruit Image Other Image. -

Pflanzen Liste 24. 02. 2020
Uhlig Kakteen Tel ++49-(0)7151/41891 Postfach 1107 Fax ++49-(0)7151/46728 D-71385 Kernen i.R E-mail: [email protected] Germany shop: www.uhlig-kakteen.de Pflanzen Liste 24. 02. 2020 Es gelten die Geschäftsbedingungen veröffentlicht unter www.uhlig-kakteen.de We refer to our General Terms and Conditions, see www.uhlig-kakteen.de Größenangaben in cm beziehen sich i.d.R. auf den Durchmesser des Pflanzenkörpers, ohne Dornen gemessen; h gefolgt von einer Zentimeterangabe gibt die ca. Höhe der Pflanzen an / plantsize diam. without spines; h meaning the approximate height oft he plant. Öffnungszeiten / Opening hours Ý: frosthart bis zur angegebenen Temperatur, wenn diese kurzfrisig einwirkt / frostresistend up to this minimum temperature. : z.B. Ý <=- auch während der Ferienzeit / 20 °C = verträgt kälter als minus 20 Grad Celsius / >=-5 °C = verträgt gut abgehärtet kurzfristig höchstens minus 5 Grad Celsius all through vacation time gepfr.: gepfropft, veredelt / grafted der Gärtnerei in der Hegnacherstr. 31 Kernen-Rommelshausen: (dw): dauerhaft frosthart: diese Pflanzen wurden bei uns im unbeheizten Frühbeet, mit Schutz vor Nässe, kultiviert / frostresistant in Southern Germany - shelter from wetness Montag - Freitag: 9.00 - 18.00 Uhr #: durch das Washingtoner Artenschutzabkommen besonders streng geschützt; in manche Länder Versand nur mit CITES- Samstag 9.00 - 16.00 Uhr Ausfuhrdokument und Ihrer Einfuhrgenehmigung möglich. Bitte beachten Sie die Importbestimmungen Ihres Landes / plants AppendixI Washington Convention, please note import regulations of your country. d h VKMin VKMax Acanthocalycium glaucum P 394 südlich Hualfin Epidermis blauer, Dornen derber als P 143 3 cm 6,00 € Acanthocalycium munitum DH 010 Cerro Zorrito vermutlich Schreibfehler für minutum, Blüte gelb, orange, rot, Sproß blaugrün 6 cm 9,00 € Acanthocalycium violaceum P 110A Salsacate Dornen im Neutrieb intensiv rot gefärbt 4-5 cm 4,00 € Aporocactus flagelliformis-Hybr. -

GROWING INDOOR PLANTS with Success
GROWING INDOOR PLANTS with Success Table of Contents Introduction............................................................................................................................ 3 Factors Affecting Plant Growth............................................................................................ 3 Light..................................................................................................................................... 3 Temperature........................................................................................................................ 5 Relative Humidity................................................................................................................. 6 Water................................................................................................................................... 7 Water Quantity ................................................................................................................. 7 Water Quality.................................................................................................................... 7 Nutrition ............................................................................................................................... 8 Soil/Growing Medium .......................................................................................................... 9 Growing Mix for Flowering House Plants.......................................................................... 9 Growing Mixes for Foliage Plants.................................................................................... -

Ceropegia Woodii
Ceropegia woodii Ceropegia woodii Botanical Name: Ceropegia woodii Common Names: String of Hearts, Rosary Vine, Native: No Foliage Type: Evergreen Plant Type: Climbers, Groundcovers Plant Habit: Pendulous, Spreading Description: Attractive succulent-like trailing vine with small heart-shaped grey, green and pink leaves and tiny trumpet-like mauve flowers towards the end of summer. Perfect choice for hanging baskets. Grows approx. 10cm tall x 200cm wide. Mature Height: <15cm Position: Semi Shade, Shade Mature Width: 2-4m Soil Type: Loam, Sandy, Well Drained Family Name: Asclepiadaceae Landscape Use(s): Courtyard, Feature, Foliage Feature / Colour, Indoor Plant, Shady Garden, Tropical Garden, Container / Pot Origin: Africa Characteristics: Pest & Diseases: Generally trouble free Foliage Colours: Green, Grey, Pink, Variegated Flower Colours: Pink Flower Fragrant: No Cultural Notes: Prefers a sheltered position with access to some bright indirect sunlight. Plant in a Flowering Season: Summer suitable container using a good quality potting mix. Fertilise twice a year with a Fruit: No liquid feed as required. Requirements: Growth Rate: Moderate Plant Care: Keep moist during dry periods, Liquid feed Maintenance Level: Low Water Usage: Medium / Moderate Tolerances: Drought: Medium / Moderate Frost: Tender Wind: Tender Disclaimer: Information and images provided is to be used as a guide only. While every reasonable effort is made to ensure accuracy and relevancy of all information, any decisions based on this information are the sole responsibility of the viewer. Call 1300 787 401 plantmark.com.au. -

Chemical Ecology of Pollination in Deceptive Ceropegia
Chemical Ecology of Pollination in Deceptive Ceropegia CHEMICAL ECOLOGY OF POLLINATION IN DECEPTIVE CEROPEGIA DISSERTATION zur Erlangung des Doktorgrades Dr. rer. nat. an der Bayreuther Graduiertenschule für Mathematik und Naturwissenschaften (BayNAT) der Universität Bayreuth vorgelegt von Annemarie Heiduk Bayreuth, Januar 2017 Die vorliegende Arbeit wurde in der Zeit von Februar 2012 bis Dezember 2016 in Bayreuth am Lehrstuhl Pflanzensystematik unter der Betreuung von Herrn Univ.-Prof. Dr. Stefan Dötterl (Erst-Mentor) und Herrn PD Dr. Ulrich Meve (Zweit-Mentor) angefertigt. Gefördert wurde die Arbeit von Februar bis April 2012 durch den ‛Feuerwehrfond’ zur Doktorandenförderung der Universität Bayreuth, von Mai 2012 bis April 2015 durch ein Stipendium nach dem Bayerischen Eliteförderungsgesetzt (BayEFG), und von Mai bis Juli 2015 durch ein Stipendium des Bayerischen Programms zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre. Vollständiger Abdruck der von der Bayreuther Graduiertenschule für Mathematik und Naturwissenschaften (BayNAT) der Universität Bayreuth genehmigten Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.). Dissertation eingereicht am: 02.02.2017 Zulassung durch das Leitungsgremium: 10.02.2017 Wissenschaftliches Kolloquium: 31.05.2017 Amtierender Direktor: Prof. Dr. Stephan Kümmel Prüfungsausschuss: Prof. Dr. Stefan Dötterl (Erstgutachter) Prof. Dr. Konrad Dettner (Zweitgutachter) Prof. Dr. Heike Feldhaar (Vorsitz) Prof. Dr. Bettina Engelbrecht Declaration of self-contribution This dissertation is submitted as a “Cumulative Thesis“ and contains a general synopsis (Part I) and three manuscripts (Part II) about the chemical ecology and pollination biology of Ceropegia . The major part of the research presented here was accomplished by myself under supervision of Univ.-Prof. Dr. Stefan Dötterl (Universities of Bayreuth and Salzburg) and PD Dr. -

Ceropegia Woodii: String of Hearts
A Horticulture Information article from the Wisconsin Master Gardener website, posted 12 Feb 2010 Ceropegia woodii: String of Hearts String of Hearts, Ceropegia woodii, is just one of many species in the genus Ceropegia that are grown as ornamental houseplants. Native to southern Africa, from Zimbabwe to eastern South Africa, this tender perennial plant in the milkweed subfamily (Asclepiadoideae) of the dogbane family (Apocynaceae) is sometimes classifi ed as C. linearis subsp. woodii. The genus name was given by Linneaus to describe his interpretation of the appearance of the fl owers as fountains of wax from the words keros, meaning wax, and pege meaning fountain. The species name honors John Medley Wood (1827-1915), who collected native African plants after he retired from the East Indian Merchant Service. Plants in this genus have many other colorful common names including bushman’s pipevine, lantern fl ower, necklace vine, parachute fl ower, and wine-glass vine. Rosary vine is another commonly used name for C. woodii, along with chain of hearts, collar of hearts, and hearts entangled (because the stems easily enmesh). C. woodii, like many A string of hearts plant. other species in this genus, is a straggly evergreen climber that in its native habitat would scramble up through other vegetation. The stringy, purplish stems are vining or trailing, making this best grown as a hanging plant. But the stems can also be trained up a small trellis or topiary frame. The simple, opposite heart- shaped leaves are 1-2 cm wide and long. They are dark green marbled with silver on the upper surface and green to purple on The pink or purple stems bear many heart-shaped the underside. -

At Home with Succulents Ken Altman
At Home with Succulents Ken Altman 1 Succulents are Plants that Solve Problems Succulent foliage comes in red, pink, lavender, yellow and blue as well as stripes, blends and speckles. The plants also produce lovely flowers. 2 Succulents are Plants that Solve Problems S ucculents look great with minimal spines that create starburst patterns. care, won’t wilt if you forget to water Collectible cacti include those covered them, and are delightful to collect and with what appears to be white hair. Such use in gardens and containers. The more filaments serve as a frost blanket in winter you know about these intriguing plants, and shade the plants the more you’ll enjoy growing them. in summer. Chances are you’re familiar with jade Nearly all succulents do well in pots, and big agaves (century plants), but did terraces and planter boxes. Some you know that nearly 20,000 varieties of varieties (such as jade), when confined, succulents exist? Many of those currently will naturally bonsai, maintaining the available in nurseries and garden centers same size for years. Even those with the were introduced to the marketplace potential to become quite large stay during the last few decades. smaller longer in containers. Succulent leaves, which typically Most succulents need protection from are thicker than those of other plants, below-freezing temperatures, but frost- range in size from dainty beads to 6-foot tolerant succulents do exist. Among swords. Some succulents, notably cacti, them are yuccas, sempervivums (hens are as round as balls. and chicks), many A few, particularly sedums (stonecrops), euphorbias, A plant is a succulent if and some agaves resemble undersea and cacti. -

LAB 10- PLANTS for INTERIORS Scientific Name Family Common Name 1. Beloperone Guttata Acanthaceae Shrimp Plant 2. Dracaena Margi
LAB 10- PLANTS FOR INTERIORS Scientific Name Family Common Name 1.Beloperone guttata Acanthaceae Shrimp Plant 2.Dracaena marginata Agavaceae DragonTree of Madagascar 3.Sansevieria trifasciata Agavaceae Snake Plant 4.Dieffenbachia amoena Araceae Giant Dumbcane 5.Philodendron scandens oxycardiumAraceae Heart-leaf Philodendron 6.Epipremnum aureum Araceae Golden Pothos 7.Spathyphyllum clevelandii Araceae Peace Lily or White Flag 8.Brassaia arboricola Araliaceae Hawaiian Schefflera 9.Hedera helix Araliaceae English Ivy 10.Araucaria heterophylla Araucariaceae Norfolk Island Pine 11.Begonia masoniana Begoniaceae Iron Cross Begonia 12.Aechmea fasciata Bromeliaceae Silver Vase 13.Mammillaria albilanata Cactaceae Mammillaria Cactus 14.Crassula argentea Crassulaceae Jade Plant 15.Euphorbia splendens Euphorbiaceae Crown-of-Thorns 16.Euphorbia trigona Euphorbiaceae African Milktree 17.Saintpaulia ionantha Gesneriaceae African Violet 18.Plectranthus australis Lamiaceae Swedish Ivy 19.Chlorophytum comosum 'Vittatum' Liliaceae Variegated Spider Plant 20.Asparagus densifloris ‘Sprengeri’ Liliaceae Sprenger Asparagus 21.Ficus benjamina Moraceae Weeping Fig 22.Ficus elastica Moraceae Rubber Plant 23.Cattleya spp. Orchidaceae Cattleya Orchid 24.Peperomia obtusifolia variegata Piperaceae Variegated Peperomia 25.Nephrolepis exaltata 'Dallas' Polypodiaceae Dallas Fern 26.Platycerium bifurcatum Polypodiaceae Staghorn Fern 1.SHRIMP PLANT Beloperone guttata - Justicia brandegeana FAMILY - Acanthaceae 250 Genera of dicots-herbs or shrubs-perfect flowers Temp. Medium Light High Moist. Dry Pests-Dis Prop. Cutting Notes Keep plants in dry side. Cut back 1/3 of plants in the spring. 2. DRAGON TREE OF MADAGASCAR Dracaena marginata FAMILY - Agavaceae 20 Genera of monocots - leaves mostly narrow Temp. Med Light Medium Moist Moist Pests-Dis Prop. Tip cutting Notes Pointed leaves, sensitive to fluoride 3. SNAKE PLANT Sansevieria trifasciata FAMILY - Agavaceae (also found it listed in Liliaceae family in two references) Temp. -

Flora Ornamental Española, VI. Araliaceae
Flora Ornamental Flora Ornamental Española Española Tomo I Magnoliaceae • Casuarinaceae Tomo II Cactaceae • Cucurbitaceae Tomo III Salicaceae • Chrysobalanaceae Tomo IV Papilionaceae • Proteaceae Tomo V Flora Ornamental Española Santalaceae • Polygalaceae Tomo VI VI Araliaceae • Boraginaceae Tomo VII Verbenaceae • Rubiaceae Tomo VIII Caprifoliaceae • Asteraceae Tomo IX Limnocharitaceae • Pandanaceae Tomo X Lemnaceae • Orchidaceae Tomo XI Selaginellaceae • Ephedraceae Araliaceae • Boraginaceae Tomo XII VI Clave de familias adenda e índices generales Araliaceae • Boraginaceae ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y Mundi-Prensa Libros, s.a. JARDINES PÚBLICOS flora 6_fam_1_2.qxp 27/4/10 08:56 Página 2 flora 6_fam_1_2.qxp 27/4/10 08:56 Página 3 FLORA ORNAMENTAL ESPAÑOLA Las plantas cultivadas en la España peninsular e insular Tomo VI Araliaceae • Boraginaceae Coordinador José Manuel Sánchez de Lorenzo Cáceres Coedición Junta de Andalucía Consejería de Agricultura y Pesca Ediciones Mundi-Prensa Madrid - Barcelona - México Asociación Española de Parques y Jardines Públicos flora 6_fam_1_2.qxp 27/4/10 08:56 Página 4 JUNTA DE ANDALUCÍA Consejería de Agricultura y Pesca Viceconsejería Servicio de Publicaciones y Divulgación C/ Tabladilla, s/n. 41071 SEVILLA Tlf.: 955 032 081 - Fax: 955 032 528 GRUPO MUNDI-PRENSA Mundi-Prensa Libros, S.A. Castelló, 37 - 28001 MADRID Tlf.: +34 914 363 700 - Fax: +34 915 753 998 E-mail: [email protected] Internet: www.mundiprensa.com Mundi-Prensa Barcelona Editorial Aedos, S.A. Aptdo. de Correos 33388 - 08009 BARCELONA Tlf.: +34 629 262 328 - Fax: +34 933 116 881 E-mail: [email protected] Mundi-Prensa México, S.A. de C.V. Río Pánuco, 141 - Col. Cuauhtémoc 06500 MÉXICO, D.F. Tlf.: 00 525 55 533 56 58 - Fax: 00 525 55 514 67 99 E-mail: [email protected] ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS C/ Madrid s/n, esquina c/ Río Humera 28223 Pozuelo de Alarcón, MADRID Tlf.: 917 990 394 - Fax: 917 990 362 www.aepjp.es © Textos y fotografías de los autores. -

Environmental and Biogeographic Influences on the Distribution and Composition of the Southern Cape Forests (Veld Type 4)
' ' I ENVIRONMENTAL AND BIOGEOGRAPHIC INFLUENCES ON THE DISTRIBUTION AND COMPOSITION OF THE SOUTHERN CAPE FORESTS (VELD TYPE 4) by Coert Johannes Geldenhuys A thesis presented for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in the Department of Botany Faculty of Science University of Cape Town Rondebosch UniversityAugust of 1989Cape Town The copyright of this thesis vests in the author. No quotation from it or information derived from it is to be published without full acknowledgement of the source. The thesis is to be used for private study or non- commercial research purposes only. Published by the University of Cape Town (UCT) in terms of the non-exclusive license granted to UCT by the author. University of Cape Town i CONTENTS Page Abstract i i Acknowledgements vi Preamble 1 Chapter I DISTRIBUTION, SIZE AND OWNERSHIP OF FORESTS IN THE SOUTHERN CAPE 10 Chapter 2 BERGWIND FIRES AS DETERMINANTS OF FOREST PATCH PATTERN IN THE SOUTHERN CAPE LANDSCAPE, SOUTH AFRICA 46 Chapter 3 COMPOSITION OF THE SOUTHERN CAPE FOREST FLORA, WITH ANNOTATED CHECKLIST 74 Chapter 4 RICHNESS, COMPOSITION AND RELATIONSHIPS OF THE FLORAS OF SELECTED FORESTS IN SOUTHERN AFRICA 138 Chapter 5 COMPOSITION AND BIOGEOGRAPHY OF FOREST PATCHES IN THE INLAND MOUNTAINS OF THE SOUTHERN CAPE 209 Chapter 6 DISJUNCTIONS AND DISTRIBUTION LIMITS OF FOREST SPECIES 'IN THE SOUTHERN CAPE 247 Chapter 7 PHYTOGEOGRAPHY OF THE SOUTHERN CAPE FOREST FLORA 276 Chapter 8 ENVIRONMENTAL AND BIOGEOGRAPHIC INFLUENCES ON THE DISTRIBUTION AND COMPOSITION OF THE SOUTHERN CAPE FORESTS: A SYNTHESIS 310 ii ABSTRACT This study aims at explaining the distribution and composition of the southern Cape forests, the largest forest complex in southern Africa.