Manuskript Treffpunkt Klassik
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Seattle Opera's 2003/04 Season
FOR RELEASE: July 17, 2014 Press Contact: Gabrielle Nomura, 206.676.5559, [email protected]. Seattle Opera Projects Budget Surplus for 2013/14 Season Kate Lindsey and Asher Fisch Named Seattle Opera Artists of the Year Maryanne Tagney Elected as Board President Seattle – Seattle Opera is projecting a surplus for the 2013/14 season, to be confirmed with published audited financials in December 2014. The surplus will be used to replenish its operating reserves for future seasons, which were significantly lowered during the recent recession. On an operating budget of nearly $28 million, the company saw significant growth in contributions and ticket sales that both exceeded expectations for the year. This announcement comes following the company’s Annual Meeting at McCaw Hall on Tuesday, July 15. Seattle Opera Board President, Dr. William T. Weyerhaeuser thanked his fellow board members and donors for their generosity and support during his tenure as president. Contributing to Seattle Opera’s surplus this season were a variety of factors, including successful fundraising and ticket sales operations thanks to generous donors and subscribers, a slightly increased overall attendance of 95,000, and the economic impact of Wagner’s Ring cycle in August, 2013. Opera lovers from all 50 states and 22 foreign countries flocked to Seattle for this unforgettable experience of story, music, spectacle, and community. Seattle Opera Annual Meeting Page 2 of 6 “Speight’s single-minded focus on the art of opera has been an inspiration to us all,” said Board Chairman John Nesholm. “When Seattle Opera staff was tasked with creating its list of core values, ‘art matters’ is what came to the forefront; this is because of Speight. -

A Season of Thrilling Intrigue and Grand Spectacle –
A Season of Thrilling Intrigue and Grand Spectacle – Angel Blue as MimÌ in La bohème Fidelio Rigoletto Love fuels a revolution in Beethoven’s The revenger becomes the revenged in Verdi’s monumental masterpiece. captivating drama. Greetings and welcome to our 2020–2021 season, which we are so excited to present. We always begin our planning process with our dreams, which you might say is a uniquely American Nixon in China Così fan tutte way of thinking. This season, our dreams have come true in Step behind “the week that changed the world” in Fidelity is frivolous—or is it?—in Mozart’s what we’re able to offer: John Adams’s opera ripped from the headlines. rom-com. Fidelio, to celebrate the 250th anniversary of Beethoven’s birth. Nixon in China by John Adams—the first time WNO is producing an opera by one of America’s foremost composers. A return to Russian music with Musorgsky’s epic, sweeping, spectacular Boris Godunov. Mozart’s gorgeous, complex, and Boris Godunov La bohème spiky view of love with Così fan tutte. Verdi’s masterpiece of The tapestry of Russia's history unfurls in Puccini’s tribute to young love soars with joy a family drama and revenge gone wrong in Rigoletto. And an Musorgsky’s tale of a tsar plagued by guilt. and heartbreak. audience favorite in our lavish production of La bohème, with two tremendous casts. Alongside all of this will continue our American Opera Initiative 20-minute operas in its 9th year. Our lineup of artists includes major stars, some of whom SPECIAL PRESENTATIONS we’re thrilled to bring to Washington for the first time, as well as emerging talents. -

Concert Program for October 22 and 23, 2009
Concert Program for October 22 and 23, 2009 David Robertson, conductor Measha Brueggergosman, soprano Kate Lindsey, mezzo-soprano Paul Groves, tenor Jubilant Sykes, baritone Saint Louis Symphony Chorus Amy Kaiser, director Saint Louis Symphony IN UNISON® Chorus Robert Ray, director IVES The Unanswered Question (c. 1908) (1874-1954) BARBER Adagio for Strings (1936) (1910-1981) ROLLO DILWORTH Freedom’s Plow (2009) World Premiere (b. 1970) Saint Louis Symphony IN UNISON® Chorus Robert Ray, director Intermission TIPPETT A Child of Our Time (1939-41) (1905-1998) Part I Chorus: The world turns on its dark side The Argument: Man has measured the heavens Scena: Is evil then good? Now in each nation Chorus of the Oppressed: When shall the usurers’ city cease I have no money for my bread How can I cherish my man in such days A Spiritual: Steal away Part II Chorus: A star rises in mid-winter And a time came Double Chorus of Persecutors and Persecuted: Away with them! Where they could, they fled Chorus of the Self-righteous: We cannot have them in our Empire And the boy’s mother wrote a letter Scena: O my son! A Spiritual: Nobody knows the trouble I see Scena: The boy becomes desperate in his agony They took a terrible vengeance. The Terror: Burn down their houses! Men were ashamed of what was done A Spiritual of Anger: Go down, Moses The Boy sings in his Prison: My dreams are all shattered What have I done to you, my son? The dark forces rise like a flood A Spiritual: O, by and by Part III Chorus: The cold deepens The soul of man Scena: The words of wisdom are these General Ensemble: I would know my shadow and my light A Spiritual: Deep river Measha Brueggergosman, soprano Kate Lindsey, mezzo-soprano Paul Groves, tenor Jubilant Sykes, baritone Saint Louis Symphony Chorus Amy Kaiser, director Saint Louis Symphony IN UNISON® Chorus Robert Ray, director David Robertson is the Beofor Music Director and Conductor. -

Christine Brewer, Soprano and Craig Terry, Piano
Old Dominion University 2018-2019 F. Ludwig Diehn Concert Series Christine Brewer, soprano Craig Terry, piano Concert: October 15, 7:30 p.m. Master Class: October 16, 12:30 p.m. Wilson G. Chandler Recital Hall F. Ludwig Diehn Center for the Performing Arts arts@odu Program Dich, teure Halle Richard Wagner (1813 – 1883) from Tannhäuser Wesendonck Lieder Richard Wagner Der Engel Stehe Still Im Treibhaus Schmerzen Träume September Richard Strauss (1864 – 1949) from Vier Letzte Lieder Ich liebe dich Allerseelen Breit über mein Haupt Zueignung INTERMISSION With a Song in My Heart Richard Rodgers (1902 – 1979) from Spring is Here Sing to Me, Sing Sidney Homer (1864 – 1953) Review Celius Dougherty (1902 – 1986) Hickory Hill Paul Sargent (1910 – 1987) Come Rain or Come Shine Harold Arlen (1905 – 1986) I Had Myself a True Love from St. Louis Woman Happiness is Just a Thing Called Joe Harold Arlen from Cabin in the Sky When I Have Sung My Songs Ernest Charles (1895 – 1984) Love Went A-Riding Frank Bridge (1879 – 1941) An endowment established at the Hampton Roads Community Foundation, made possible by a generous gift from F. Ludwig Diehn, funds this program. Translations Dich, teure Halle – Tannhäuser Be Still! – Stehe Still! by Richard Wagner Hurrying, scurrying wheel of time Marking out eternity; You, dear hall, I greet again... Glowing spheres in distant space I gladly greet you, beloved room! Circling us with gravity; All sempiternal generation, cease! In you, I still hear his songs Enough of that – let me know peace! Which waken me from my gloomy dream When he departed from you Desist, now, creative powers; How desolate you appeared to me. -

Utah Symphony | Utah Opera
Media Contact: Renée Huang | Public Relations Director [email protected] | (801) 869-9027 FOR IMMEDIATE RELEASE: UTAH SYMPHONY PRESENTS BERLIOZ’S DAMNATION OF FAUST WITH ACCLAIMED GUEST OPERA SOLOISTS KATE LINDSEY AND MICHAEL SPYRES SALT LAKE CITY, Utah (Sept.12, 2013) – Mezzo Soprano Kate Lindsey, a veteran of the Metropolitan Opera, and Michael Spyres, called “one of today’s finest tenors” by French Opera magazine join the Utah Symphony on September 27 and 28 at Abravanel Hall in Hector Berlioz’s dramatic interpretation of Goethe’s tale of Faust and his fateful deal with the devil, The Damnation of Faust. The Utah Symphony Chorus and Utah Opera Chorus lend their voices to the work, which is an ingenious combination of opera and oratorio that ranks among Berlioz’s finest creations. In addition to the star power of Lindsey and Spyres who sings the role of Marguerite and Faust, three other operatic guest artists will join the cast, including Baritone Roderick Williams, whose talents have included appearances with all BBC orchestras, London Sinfonietta and the Philharmonia, performing Mephistopheles; and Bass- baritone Adam Cioffari, a former member of the Houston Grand Opera Studio. Newcomer Tara Stafford Spyres, a young coloratura soprano, just sang her first Mimi in Springfield Missouri’s Regional Opera production of La Bohème. La Damnation de Faust was last performed on the Utah Symphony Masterworks Series in 2003 as part of the company’s Faust Festival. TICKET INFORMATION Single tickets for the performance range from $18 to $69 and can be purchased by phone at (801) 355- 2787, in person at the Abravanel Hall ticket office (123 W. -
Lawrence Brownlee and Eric Owens Craig Terry, Piano Friday, March 8, 2019 7:30 Pm Photo: © Dario Acosta © Dario Photo
Photo: Shervin Lainez Photo: Lawrence Brownlee and Eric Owens Craig Terry, Piano Friday, March 8, 2019 7:30 pm Photo: © Dario Acosta © Dario Photo: 2018/2019 SEASON Great Artists. Great Audiences. Hancher Performances. LAWRENCE BROWNLEE, TENOR ERIC OWENS, BASS-BARITONE CRAIG TERRY, PIANO Friday, March 8, 2019, at 7:30 pm Hancher Auditorium, The University of Iowa PROGRAM “Se vuol ballare,” from Le Nozze di Figaro Wolfgang Amadeus Mozart Eric Owens “Il mio tesoro,” from Don Giovanni Wolfgang Amadeus Mozart Lawrence Brownlee “Infelice! E tuo credevi,” from Ernani Giuseppe Verdi Eric Owens “Voglio dire, lo stupendo elisir,” from L'elisir d'amore Gaetano Donizetti Lawrence Brownlee, Eric Owens “Una furtiva lagrima,” from L'elisir d'amore Gaetano Donizetti Lawrence Brownlee “Le veau d'or,” from Faust Charles Gounod Eric Owens “Ah! mes amis, quel jour de fête!,” from La fille du regiment Gaetano Donizetti Lawrence Brownlee “Au fond du temple saint,” from Les Pêcheurs de Perles Georges Bizet Lawrence Brownlee, Eric Owens INTERMISSION Traditional Spirituals “All Night, All Day” arr. Damien Sneed Lawrence Brownlee “Deep River” arr. Hall Johnson Eric Owens “Come By Here, Good Lord” arr. Damien Sneed Lawrence Brownlee “Give Me Jesus” Traditional Eric Owens “He's Got the Whole World In His Hand” arr. Margaret Bonds / Craig Terry Lawrence Brownlee, Eric Owens American Popular Songs “Song of Songs” Harold Vicars and Clarence Lucas Lawrence Brownlee, Eric Owens arr. Craig Terry “Lulu's Back In Town” Harry Warren and Al Dubin Lawrence Brownlee arr. Craig Terry “Dolores” Frank Loesser and Louis Alter Lawrence Brownlee, Eric Owens arr. Craig Terry “Some Enchanted Evening,” from South Pacific Richard Rodgers Eric Owens & Oscar Hammerstein II “Through the Years” Vincent Youmans and Edward Heyman Lawrence Brownlee, Eric Owens arr. -
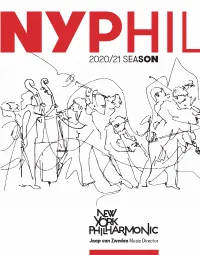
2020/21 Season Join Music Director Jaap Van Zweden and Your Orchestra for the 2020/21 Season
2020/21 SEASON JOIN MUSIC DIRECTOR JAAP VAN ZWEDEN AND YOUR ORCHESTRA FOR THE 2020/21 SEASON. 04 08 10 14 16 18 20 21 22 23 Season Special Curated Curated Curated Curated Matinees Young Membership Subscribe Highlights Events Weekday Thursday Friday Saturday People’s Sampler Series Evening Series Evening Series Evening Series Concerts® GYÖRGY KURTÁG | SAMUEL BECKETT FIN DE PARTIE “Nothing is funnier than unhappiness.” In the dystopian world of Beckett’s Fin de partie (Endgame), we see a blind man, his helpless parents, and his hapless servant bumble and bicker as they wait for an end to their suffering — like four final pieces on a chessboard, waiting for the game to end. Kurtág’s music provides the timeless continuum for the eternal question, one that concerns us in the 21st century now more than ever: how will this universal game play out? The New York Philharmonic presents the US Premiere of Kurtág’s opera based on Beckett’s SEASON TWO tragicomedy in a fully staged production directed by Claire van Kampen (Farinelli and the King) PROJECT 19 and conducted by Jaap van Zweden. 19 Commissions To Celebrate the Centennial of the 19th Amendment nyphil.org/findepartie American women gained the right to vote with the ratification of the 19th Amendment in 1920. The New York Philharmonic is marking the centennial with Project 19, a multi-season initiative to commission and premiere 19 new works by ARTIST-IN-RESIDENCE women, launched last season. The single largest women-only commissioning initiative in history, Project 19 continues in 2020–21. CHICK COREA TAKEOVER Like Mozart, Chick Corea improvises the Unsuk Chin Ellen Reid cadenzas whenever he plays a Mozart piano Mary Kouyoumdjian Maria Schneider ROOMFUL OF TEETH concerto. -

SALZBURG FESTIVAL 20 July – 30 August 2018
SALZBURG FESTIVAL 20 July – 30 August 2018 Final Report on the 2018 Salzburg Festival (SF, 28 August 2018) The Festival summer began 40 days ago with Penderecki’s St. Luke Passion – and there are two days yet ahead of us. The 2018 programme of the Salzburg Festival included 206 performances at 18 performance venues. Now the time has come to draw a summary of this summer, which was marked by works of passion, rapture and ecstasy. “To me, happiness means seeing productions grow, instead of being merely manufactured. It is possible to enter into a pact with the audience: by meeting it with the respect it deserves, by honestly challenging it, intellectually and emotionally. I am particularly glad that the audience also greeted the works of the 20th century with great empathy,” says Artistic Director Markus Hinterhäuser. “100 years after the constitutive meeting of the association to promote the building of a festival theatre on 15 August 1918, our programme has done justice to our political mission. Naturally, art cannot offer solutions for the problems of our time. Nor do we wish to issue cheap political statements along party lines. However, using our productions to inspire questions in these times of premature answers – that we have managed quite well. The fact that our audience received these questions with enormous interest only encourages us to continue our line of programming,” says Festival President Helga Rabl-Stadler. “We proudly look back on a season that was highly successful, both in artistic and economic terms. With a 97% ratio of occupied seats and 260,875 tickets issued, the festival was able to repeat the successful results of the previous year. -

JAAP VAN ZWEDEN and the NEW YORK PHILHARMONIC 2019–20 SEASON
JAAP VAN ZWEDEN and the NEW YORK PHILHARMONIC 2019–20 SEASON THE OPENING WEEKS World Premiere by Philip Glass Fully Staged Production of Bartók’s Bluebeard’s Castle, with Nina Stemme, and Schoenberg’s Erwartung ___________ PROJECT 19: 19 Commissions by Women Composers, Celebrating the Centennial of the 19th Amendment Unsuk Chin, Mary Kouyoumdjian, Joan La Barbara, Tania León, Nicole Lizée, Caroline Mallonee, Jessie Montgomery, Angélica Negrón, Olga Neuwirth, Paola Prestini, Ellen Reid, Maria Schneider, Caroline Shaw, Sarah Kirkland Snider, Anna Thorvaldsdottir, Joan Tower, Melinda Wagner, Nina C. Young, Du Yun HOTSPOTS 3-Week Spotlight on Global Hotbeds of Musical Innovation BERLIN: Olga Neuwirth World Premiere REYKJAVÍK: Nico Muhly World Premiere NEW YORK: Sarah Kirkland Snider World Premiere MAHLER’S NEW YORK Celebrating Mahler’s Time in New York as Composer and Philharmonic Music Director In New York and on 2020 European Tour, Opening Concertgebouw’s Mahler Festival as First American Orchestra in Its 100-Year History ___________ Artist-in-Residence Daniil Trifonov Two Concertos, 2020 European Tour, Recital, Chamber Music ___________ Björk Songs with Renée Fleming Phil the Hall 2020 Other Premieres and Commissions: Bryce Dessner, Steve Reich, Brett Dean Nightcap and Sound ON with Creative Partner Nadia Sirota as Host The New York Philharmonic’s 2019–20 season, Jaap van Zweden’s second as Music Director, will fuse past and present, representing today’s composers and the new-music landscape while reflecting on relevant historic achievements. As in van Zweden’s inaugural season, the Philharmonic reaffirms its vital commitments to serving as New York’s Orchestra and to championing new music. -

Les Contes D'hoffmann
Jacques Offenbach Les Contes d’Hoffmann CONDUCTOR Opera in three acts, a prologue, James Levine and an epilogue PRODUCTION Libretto by Jules Barbier and Michel Carré Bartlett Sher based on stories by E.T.A. Hoffmann SET DESIGNER Michael Yeargan Saturday, December 19, 2009, 1:00–4:40 pm COSTUME DESIGNER Catherine Zuber New Production LIGHTING DESIGNER James F. Ingalls CHOREOGRAPHER Dou Dou Huang The production of Les Contes d’Hoffmann was made possible by generous gifts from the Hermione Foundation and the Gramma Fisher Foundation, Marshalltown, Iowa. Additional funding was received from the Estate of Helen F. Kelbert and Mr. and Mrs. William R. Miller. GENERAL MANAGER Peter Gelb MUSIC DIRECTOR James Levine 2009–10 Season The 245th Metropolitan Opera performance of This performance is being Jacques Offenbach’s broadcast live over The Toll Brothers– Metropolitan Les Contes Opera International Radio Network, d’Hoffmann sponsored by Toll Brothers, America’s luxury c o n d u c t o r homebuilder®, James Levine with generous long-term support from Hoffmann, a poet Olympia, a doll The Annenberg Joseph Calleja Kathleen Kim Foundation, the The Muse of Poetry Antonia, a young singer Vincent A. Stabile Nicklausse, Hoffmann’s friend Stella, a prima donna Endowment for Kate Lindsey * Anna Netrebko Broadcast Media, and contributions Lindorf Giulietta, a courtesan from listeners Coppélius, an optician Ekaterina Gubanova worldwide. Dr. Miracle Dapertutto This performance Alan Held is also being broadcast live on Metropolitan Andrès Nathanaël, a student Opera Radio Cochenille Rodell Rosel on SIRIUS Frantz channel 78 and Pitichinaccio Spalanzani, a physicist XM channel 79. -

Magic Flute, Tamino and Pamina Survive These Final Trials
The Pescadero Opera Society presents The Magic Flute Music by Wolfgang Amadeus Mozart Libretto in English by J. D. McClatchy Opera in Two Acts Setting: Near the Temple of Isis, Memphis Time: Egypt, about the reign of Rameses I Characters Sarastro, High Priest of Isis (bass) ................................................................................................................. Réne Pape Queen of the Night (soprano) .................................................................................................................. Erika Miklósa Pamina, Queen of the Night’s daughter (soprano) ...................................................................................... Ying Huang Tamino, an Egyptian Prince (tenor) ................................................................................................. Matthew Polenzani Papageno, a bird-catcher (baritone) ...........................................................................................................Nathan Gunn Papagena, an old hag (soprano) ............................................................................................................ Jennifer Aylmer Speaker, an old priest (speaking voice) ................................................................................................ David Pittsinger First Priest (bass) ......................................................................................................................................... Brian Davis Second Priest (tenor) ........................................................................................................................... -

Mezzo Ágúst (2) 2020.Doxc
Óperur á mezzo ágúst (2) 2020 L'Incoronazione di Poppea by Allar tímasetningar miðast við Ísland Monteverdi at the Salzburg Festival (án ábyrgðar BS). Duration: 03:15 Nýjar sýningar eru merktar með * Recording: August 2018 https://www.mezzo.tv/en/opera Les Arts Florissants William Christie (Conductor) Don Giovanni by Mozart Jan Lauwers (Stage Direction) at the Festival d'Aix-en-Provence Sonya Yoncheva (Soprano): Poppea Duration: 02:50 Kate Lindsey: Nerone Recording: July 10 2017 Su 16/08 07:30 on MezzoLiveHD Le Cercle de l'Harmonie Fr 21/08 19:00 on MezzoLiveHD Jérémie Rhorer (Conductor) We 26/08 04:00 on MezzoLiveHD Jean-François Sivadier Th 27/08 11:00 on MezzoLiveHD (Stage Direction) Fr 28/08 00:00 on MezzoLiveHD Philippe Sly (Baritone): Don Giovanni Isabel Leonard (Mezzo): Donna Elvira Puccini's Tosca Mo 17/08 10:30 on Mezzo at the Salzburg Easter Festival Mo 24/08 11:35 on Mezzo Duration: 02:01 Tu 25/08 06:30 on Mezzo Recording: April 2 2018 Staatskapelle Dresden Orlando Furioso Christian Thielemann (Conductor) by Vivaldi in Venice Michael Sturminger (Stage Direction) Duration: 02:35 Anja Harteros (Soprano): Floria Tosca Recording: April 17 2018 Aleksandrs Antonenko: Cavaradossi Orchestra del Teatro La Fenice Ludovic Tézier (Baritone): Scarpia Diego Fasolis (Conductor) Andrea Mastroni: Cesare Angelotti Fabio Ceresa (Stage Direction) Su 16/08 00:00 on MezzoLiveHD Sonia Prina: Orlando Mo 17/08 03:35 on MezzoLiveHD Mo 17/08 15:50 on Mezzo We 19/08 11:00 on MezzoLiveHD Fr 21/08 11:30 on Mezzo Su 23/08 19:00 on MezzoLiveHD Tu 25/08 14:30