Des Steirischen Vulkanlandes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Vulkanland Steiermark“, Fassung Vom 03.03.2019
Bundesrecht konsolidiert Gesamte Rechtsvorschrift für DAC Verordnung „Vulkanland Steiermark“, Fassung vom 03.03.2019 Langtitel Verordnung der Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus zur Festsetzung von Bedingungen für regionaltypische Qualitätsweine mit Herkunftsprofilen für das Weinbaugebiet Vulkanland Steiermark (DAC-Verordnung „Vulkanland Steiermark“) StF: BGBl. II Nr. 299/2018 Präambel/Promulgationsklausel Auf Grund des § 34 Abs. 1 des Weingesetzes 2009, BGBl. I Nr. 111/2009, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 32/2018, wird verordnet: Text § 1. Das Weinbaugebiet Vulkanland Steiermark entspricht den politischen Bezirken Südoststeiermark, Hartberg/Fürstenfeld, Weiz, sowie den Gemeinden des Bezirkes Leibnitz links der Mur. § 2. Wein darf unter der Bezeichnung „DAC“ in Verbindung mit der Angabe des Weinbaugebietes Vulkanland Steiermark („Gebietswein“) in Verkehr gebracht werden, wenn er den Anforderungen für Qualitätswein sowie folgenden Anforderungen entspricht: 1. Der Wein muss ausschließlich aus handgelesenen Trauben bereitet worden sein, die im Weinbaugebiet Vulkanland Steiermark geerntet wurden. 2. Die kommissionelle Verkostung im Rahmen des Verfahrens zur Vergabe der staatlichen Prüfnummer für Wein mit der Verkehrsbezeichnung „Vulkanland Steiermark DAC“ hat in der Außenstelle des Bundesamtes für Weinbau in Silberberg zu erfolgen. 3. Die für Wein mit der Verkehrsbezeichnung „Vulkanland Steiermark DAC“ erteilte staatliche Prüfnummer darf ausschließlich für das Inverkehrbringen des geprüften Weines und der -

Baurecht Datenquelle: GIS-Steiermark, BEV Erstellung: Amt Der Stmk
Baurecht Datenquelle: GIS-Steiermark, BEV Erstellung: Amt der Stmk. LR. Abteilung 13, Umwelt und Raumordnung Referat Bau- und Raumordnung GIS-Digitalisierung: Michael Hierzmann Stand: 11.02.2015 Altenmarkt bei Sankt Gallen Mariazell Neuberg an der Mürz Altaussee Wildalpen Sankt Gallen Grundlsee Landl Spital am Semmering Ardning Turnau Mürzzuschlag Bad Aussee Liezen Sankt Barbara im Mürztal Admont Bad Mitterndorf Aflenz Wörschach Thörl Stainach-Pürgg Selzthal Langenwang Eisenerz Tragöß-Sankt Katharein Krieglach Rettenegg Lassing Radmer Ratten Sankt Lorenzen im Mürztal Aigen im Ennstal Vordernberg Kindberg St. Kathrein am Hauenstein Gröbming Mitterberg-Sankt Martin Trieben Gaishorn am See Waldbach-Mönichwald Sankt Jakob im Walde Pinggau Schäffern Rottenmann Sankt Lorenzen am Wechsel Kapfenberg Trofaiach Stanz im Mürztal Öblarn Kalwang Fischbach Ramsau am Dachstein Sankt Marein im Mürztal DechantskirchenFriedberg Hohentauern Wald am Schoberpaß Wenigzell Proleb Strallegg Aich Kammern im Liesingtal Vorau Bruck an der Mur Haus Michaelerberg-Pruggern Sankt Peter-Freienstein Rohrbach an der Lafnitz Irdning-Donnersbachtal Mautern in Steiermark Breitenau am Hochlantsch Niklasdorf Gasen Miesenbach bei Birkfeld Pölstal Traboch Pernegg an der Mur Birkfeld Grafendorf bei Hartberg Schladming Leoben Lafnitz Sölk Sankt Kathrein am Offenegg Pöllauberg Kraubath an der Mur Greinbach Pusterwald Fladnitz an der Teichalm Gaal Sankt Marein-Feistritz Sankt Michael in Obersteiermark Pöllau Seckau Sankt Stefan ob Leoben Frohnleiten Hartberg Anger Sankt Johann in -

Bekanntgabe Der Maßnahmen Zur Bekämpfung Der Amerikanischen Rebzikade Für Das Jahr 2020 in Den Weinbaugebieten Vulkanland Steiermark, Südsteiermark Und Weststeiermark
Bekanntgabe der Maßnahmen zur Bekämpfung der Amerikanischen Rebzikade für das Jahr 2020 in den Weinbaugebieten Vulkanland Steiermark, Südsteiermark und Weststeiermark gemäß SS 5 (2) und 9 (2) der Verordnung zur Bekämpfung der Amerikanischen Rebzikade und der Goldgelben Vergilbung der Rebe, LGB|.Nr. 3512010 idF LGB|.Nr.3212020 Amerikanische Rebzikade Die Amerikanische Rebzikade (ARZ), Überträger der gefährlichen Phytoplasmose ,,Grapevine flavescence dor6e" (GFD, Goldgelbe Vergilbung der Rebe), wurde 2004 erstmals im Raum Klöch und St. Anna am Aigen gefunden. ln den ersten Jahren wurden nur enrvachsene Zikaden (Adulte) beobachtet, zwischenzeitig ist die ARZ in großen Teilen der Weinbaugebiete Vulkan- land Steiermark und Südsteiermark und im Süden der Weststeiermark heimisch geworden, d.h. sie übenruintert als Ei und durchlebt alle fünf Larvenstadien bis zur adulten Zikade. Der österreichweit erste Ausbruch von Grapevine flavescence doröe wurde im Herbst 2009 in der Gemeinde Tieschen festgestellt. lm Jahr 2019 wurden an drei Standorten einzelne Rebstöcke positiv auf GFD getestet und diese in weiterer Folge gerodet. Lebenszyklus Die in Borkenritzen übenarinternden Eier sind immer frei von der Krankheit. Damit es zu einer Verbreitung der Goldgelben Vergilbung kommen kann, müssen entweder befallene Rebstöcke (Meldepflicht!) innerhalb eines Weinbaugebietes vorhanden sein oder infektiöse Zikaden aus anderen Gebieten im Sommer zufliegen. Daher ist es wichtig, befallene Reben so rasch wie möglich zu entfernen und die Population der ARZ durch geeignete Maßnahmen zu verringern. Der Larvenschlupf beginnt je nach Witterung Ende Mai bis Anfang Juni. Die Larven bleiben meist auf derselben Rebe und halten sich voniviegend auf den Blattunterseiten auf. Von der Aufnahme des Krankheitserregers Flavescence dor6e bis zur Fähigkeit, die Vergilbungskrank- heit weiterzugeben, vergehen ca. -

St. Anna Revisited
ST. ANNA REVISITED By SANDOR & RON VANDOR Ventura & Malibu, CA. 2009 Copyright © 2005, 2009 by Sandor Vandor and Ron Vandor All rights reserved. This publication is protected by copyright. Any reproductions, storage in a retrieval system, or transmission in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopy, recording, or otherwise are prohibited. To increase the student’s learning experiences, part or the complete text can be copied and transmitted between students and teachers or tutors to exchange ideas and obtain comments on the student’s work. English translation of the original German text of Foreword 1, 2 and 3 also the glass tablet of Memorial for Peace by Elisabeth Weinhandl. Photo credits: Archives: Front cover and number 3. Gerda Somer: numbers 2, 6 and 7. Elisabeth Weinhandl: numbers 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Sandor Vandor: numbers 4, 5, 8, 16, 17 and 18. TABLE OF CONTENTS. Foreword 1 Page 4 Foreword 2 5 Foreword 3 6 Introduction 7 Action 1 7 Fly to Vienna 10 First stop; The old schoolhouse 10 Middle school 11 Tuesday, June 14th 18 Backstory: An egg sandwich 19 Tuesday June 14th continued 19 The formal meeting 20 Wednesday, June 15th 25 The Lippe house 26 Thursday, June 16th 27 A Blade of Grass 29 Sixty – Years Later 33 Friday, June 17th 35 Saturday, June 18th 34 Special relationship 37 Summary 38 Gyuri 41 Liberation 42 Parallel 44 Neuhaus am Klausenbach 44 Action 2 45 Epilogue 50 Additional photos 55 Index 65 Foreword 1 „I’ve never seen the sun“ In St. -

Landesprämierung Steirisches Kürbiskernöl G.G.A. 2019 Bezirk
Landesprämierung Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. 2019 Bezirk Deutschlandsberg Deutschlandsberg Deutsch Barbara Furth 1 8524 Bad Gams Eberhardt Margaretha Dorfstraße 29 8530 Deutschlandsberg Farmer-Rabensteiner Furth 8 8524 Bad Gams Ganster Rudolf Niedergams 31 8524 Bad Gams Hamlitsch GmbH & Co KG Wirtschaftspark 28 8530 Deutschlandsberg Leopold - Mühle - KG Frauentalerstraße 120 8530 Deutschlandsberg Mandl Manfred Niedergams 22 8524 Bad Gams Reiterer Josef Bösenbacherstraße 94 8530 Deutschlandsberg Schmuck Isabella Blumauweg 77 8530 Deutschlandsberg Eibiswald Grubelnik Martin "Aibler Ölpresse" Aibl 201 8552 Eibiswald Kainacher Inge und Anton Haselbach 8 8552 Eibiswald Kremser Gudrun Hörmsdorf 23 8552 Eibiswald Moser Peter Hörmsdorf 133 8552 Eibiswald Wechtitsch Erich u. Angelika Oberlatein 32 8552 Eibiswald Frauental an der Laßnitz Hainzl-Jauk Gottfried u. Barbara Grazerstraße 231 8523 Frauental Groß Sankt Florian Floriani-Ölmühle Marktring 17 a 8522 Groß St. Florian Jauk Josef u. Aloisia Petzelsdorfstraße 31 8522 Groß St. Florian Jauk Gregor Petzelsdorfstraße 31 8522 Groß St. Florian Lamprecht Stefan Kraubathstrasse 34 8522 Groß St. Florian Mandl jun. Anton Nassau 8 8522 Groß St. Florian Schmitt Margret Kelzen 14 8522 Groß St. Florian Stelzer Manfred u. Gertrude Florianerstraße 61 8522 Groß St. Florian Wieser Johann u. Waltraud Grazerstraße 118 8522 Groß St. Florian Zeck Markus Hasreith 17 8522 Groß St. Florian Lannach Jöbstl Karl Teiplbergstraße 64 8502 Lannach Niggas Theresia Radlpaßstraße 13 8502 Lannach Rumpf Herta Kaiserweg 4 8502 Lannach Pölfing-Brunn Gaisch Udo-Markus Jagernigg 15 8544 Pölfing Brunn Jauk Christian Brunn 45 8544 Pölfing Brunn Orthaber Annemarie Pölfing 8 8544 Pölfing Brunn Preding Bauer Erwin Wieselsdorfer Straße 51 8504 Preding Sankt Johann im Saggautal Wrolli Gottfried Untergreith 131 8443 Gleinstätten Sankt Josef Neumann Christian St. -

Gewässer Gemeinde Projektant Jahr Dörflabach Zerlach DEPISCH 1999 Drauchenbach St
Gewässer Gemeinde Projektant Jahr Dörflabach Zerlach DEPISCH 1999 Drauchenbach St. Anna am Aigen DEPISCH 2008 Eichgrabenbach Bad Gleichenberg LUGITSCH 1998 Faule Sulz Bad Gleichenberg LUGITSCH 1998 Faule Sulz Trautmannsdorf in Oststmk. LUGITSCH 1998 Gnasbach Gnas ZACH 1998 Gnasbach Grabersdorf ZACH 1998 Gnasbach Raning ZACH 1998 Jammbach St. Anna am Aigen LUGITSCH 1994 Klausenbach Bad Gleichenberg LUGITSCH 1998 Kölldorfer Bach Bad Gleichenberg LUGITSCH 1998 Kölldorfer Bach Bairisch Kölldorf LUGITSCH 1998 Kölldorfer Bach Merkendorf LUGITSCH 1998 Krennachbach Riegersburg LUGITSCH 1999 Lehenbach Unterlamm DEPISCH 1995 Maxendorfbach Zerlach DEPISCH 1999 Oedter Bach Feldbach LUGITSCH 1986 Oedter Bach Mühldorf bei Feldbach LUGITSCH 1986 Ottersbach Jagerberg VISOTSCHNIG 1984 Ottersbach St. Stefan im Rosental VISOTSCHNIG 1984 Pampererbach Riegersburg LUGITSCH 1999 Perlsdorfbach Perlsdorf LUGITSCH 1993 Raab Edelsbach bei Feldbach SACKL 2004 Raab Eichkögl SACKL 2004 Raab Fehring SACKL 2004 Raab Feldbach SACKL 2004 Raab Fladnitz im Raabtal SACKL 2004 Raab Gniebing-Weißenbach SACKL 2004 Raab Hohenbrugg-Weinberg SACKL 2004 Raab Johnsdorf-Brunn SACKL 2004 Raab Kirchberg an der Raab SACKL 2004 Raab Leitersdorf im Raabtal SACKL 2004 Raab Lödersdorf SACKL 2004 Raab Mühldorf bei Feldbach SACKL 2004 Raab Oberstorcha SACKL 2004 Raab Paldau SACKL 2004 Raab Pertlstein SACKL 2004 Raab Raabau SACKL 2004 Raab Studenzen SACKL 2004 Rittschein Breitenfeld an der Rittschein GEOCONSULT WIEN ZT 2008 Saßbach Jagerberg LUGITSCH 2000 Saßbach St. Stefan im Rosental LUGITSCH 2000 Schwarzaubach Kirchbach in Steiermark DONAUCONSULT ZOTTL & 2008 Schwarzaubach Schwarzau im Schwarzautal DONAUCONSULT ZOTTL & 2008 Schwarzaubach St. Stefan im Rosental DONAUCONSULT ZOTTL & 2008 Stiefing Pirching am Traubenberg BURKELZ 1995 Sulzbach Bad Gleichenberg ILF ZT GMBH/ HPI GMBH/ 2008 Sulzbach Merkendorf ILF ZT GMBH/ HPI GMBH/ 2008 Sulzbach Stainz bei Straden ILF ZT GMBH/ HPI GMBH/ 2008 Sulzbach Bad Gleichenberg LUGITSCH 1998 Sulzbach Merkendorf LUGITSCH 1998 Trummerbach Riegersburg LUGITSCH 1999. -

Pr\344Mierte Betriebe Nach Bezirk U. Gemeinde 2013Xls.Xls
Landesprämierung Steirisches Kürbiskernöl g.g.A 2013 Bezirk Deutschlandsberg Aibl Fürpaß Siegfried Aibl 38 8552 Aibl Bad Gams Deutsch Barbara Furth 1 8524 Bad Gams Ganster Rudolf Niedergams 31 8524 Bad Gams Mandl Manfred Niedergams 22 8524 Bad Gams Farmer-Rabensteiner Franz Furth 8 8524 Bad Gams Deutschlandsberg Hamlitsch KG Ölmühle Wirtschaftspark 28 8530 Deutschlandsberg Leopold Ölmühle Frauentalerstraße 120 8530 Deutschlandsberg Reiterer Josef Bösenbacherstraße 94 8530 Deutschlandsberg Schmuck Johann Blumauweg-Wildbach 77 8530 Deutschlandsberg Groß Sankt Florian Jauk Josef Hubert Petzelsdorfstraße 31 8522 Groß Sankt Florian Weißensteiner Gabriele Vocherastraße 27 8522 Groß Sankt Florian Otter Anton Gussendorfgasse 21 8522 Groß Sankt Florian Schmitt Jakob Kelzen 14 8522 Groß Sankt Florian Stelzer Gertrude Florianerstraße 61 8522 Groß Sankt Florian Lamprecht Stefan Kraubathstraße 34 8522 Groß Sankt Florian Großradl Wechtitsch Angelika Oberlatein 32 8552 Großradl Lannach Jöbstl Karl Hauptstraße 7 8502 Lannach Niggas Theresia Radlpaßstraße 13 8502 Lannach Rumpf Herta Kaiserweg 4 8502 Lannach Limberg bei Wies Gollien Josef Eichegg 62 8542 Limberg bei Wies Pitschgau Jauk Karl Heinz Bischofegg 14 8455 Pitschgau Kürbisch Anna Bischofegg 20 8455 Pitschgau Kainacher Inge Haselbach 8 8552 Pitschgau Stampfl Gudrun Hörmsdorf 23 8552 Pitschgau Pölfing-Brunn Jauk Christian Brunn 45 8544 Pölfing-Brunn Michelitsch Karl Pölfing 29 8544 Pölfing-Brunn Preding Bauer Erwin Wieselsdorf 38 8504 Preding Rassach Hirt Renate Herbersdorf 35 8510 Rassach Becwar -

Landesprämierung Steirisches Kürbiskernöl G.G.A. 2018
Landesprämierung Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. 2018 Bad Gleichenberg Hackl Barbara Merkendorf 70 8344 Bad Gleichenberg Bad Radkersburg Drexler Manfred Neudörflweg 5 8490 Bad Radkersburg Friedl Jasmin Pridahof 12 8490 Bad Radkersburg Majczan Josef Sicheldorf 38 8490 Bad Radkersburg Deutsch Goritz Baumgartner Irene - Agnes Weixelbaum 15 8484 Unterpurkla Lackner Andreas Weixelbaum 14 8483 Deutsch Goritz Edelsbach bei Feldbach Wiedner-Hiebaum Herbert Rohr 7 8332 Edelsbach b. Feldbach Fehring Bauer Franz Schiefer 119 8350 Fehring Dirnbauer Friedrich Höflach 22a 8350 Fehring Esterl Josef Schiefer 86 8350 Fehring Gütl Alfred Hatzendorf 65 8361 Hatzendorf Kaufmann Ernst u. Elisabeth Höflach 16 8350 Fehring Kern Stefanie Schiefer 13 8350 Fehring Kniely jun. Johann Pertlstein 31 8350 Fehring Koller jun. Josef Schiefer 29 8350 Fehring Krenn Josef u. Elisabeth Hohenbrugg 33 8350 Fehring Kürbishof Koller Weinberg 78 8350 Fehring Lamprecht Günter Weinberg 26 8350 Fehring Reindl Franz Höflach 45 8350 Fehring Schnepf Peter August Petzelsdorf 5 8350 Fehring Zach Johannes Pertlstein 29 8350 Fehring Feldbach Fritz Clement KG Brückenkopfgasse 11 8330 Feldbach Groß Franz Unterweißenbach 51 8330 Feldbach Holler Josef Petersdorf 3 8330 Feldbach Kirchengast Maria Mühldorf 62 8330 Feldbach Kohl David Leitersdorf 8 8330 Feldbach Lugitsch Rudolf KG Gniebing 122 8330 Feldbach Neuherz Christian Edersgraben 2 8330 Feldbach Gnas Ettl Hannes u. Maria Raning 44 8342 Gnas Fruhwirth Johann u. Johanna Thien 33 8342 Gnas Hödl Josef Raning 92 8342 Gnas Kerngast Anita Burgfried 65/1 8342 Gnas Neubauer Alois Obergnas 27 8342 Gnas Niederl Günter Obergnas 12 8342 Gnas Reiss Manfred u. Doris Grabersdorf 71 8342 Gnas Schadler Elisabeth Hirsdorf 23 8342 Gnas Sommer Alois Lichtenberg 84 8342 Gnas Trummer Josef Katzendorf 6 8342 Gnas Wagner Johannes Lichtenberg 12 8342 Gnas Halbenrain Gangl Christoph Donnersdorf 38 8484 Unterpurkla Summer Michaela Dietzen 32 8492 Halbenrain Jagerberg Fastl Justine Pöllau 6 8091 Jagerberg Groß Erwin Wetzelsdorf 17 8083 St. -

Verordnung Der Steiermärkischen Landesregierung Vom 10
1 von 3 Jahrgang 2014 Ausgegeben am 10. September 2014 99. Verordnung: Änderung der Steiermärkischen Bezirkshauptmannschaftenverordnung elektronischen Signatur bzw. der Echtheit de Das elektronische Original dieses Dokumentes wurde amtssigniert. Hinweise zur Prüfung dieser 99. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 10. Juli 2014, mit der die Steiermärkische Bezirkshauptmannschaftenverordnung geändert wird Auf Grund des § 8 Abs. 5 lit. d des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920, BGBl. Nr. 368/1925, zuletzt in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 2/2008 wird mit Zustimmung der Bundesregierung verordnet: Die Steiermärkische Bezirkshauptmannschaftenverordnung, LGBl. Nr. 99/2012, wird geändert wie folgt: 1. § 2 lautet: s Ausdrucks finden Sie unter: „§ 2 Sprengel der politischen Bezirke Die Sprengel der in § 1 genannten politischen Bezirke umfassen folgende Gemeinden: Bezirk Gemeinden Bruck-Mürzzuschlag Aflenz, Turnau, Breitenau am Hochlantsch, Bruck an der Mur, Kapfenberg, Pernegg an der Mur, Sankt Lorenzen im Mürztal, https://as.stmk.gv.at Sankt Marein im Mürztal, Tragöß-Sankt Katharein, Mariazell, Thörl, Kindberg, Stanz im Mürztal, Krieglach, Sankt Barbara im Mürztal, Mürzzuschlag, Langenwang, Spital am Semmering, Neuberg an der Mürz Deutschlandsberg Deutschlandsberg, Frauental an der Laßnitz, Eibiswald, Groß Sankt Florian, Lannach, Pölfing-Brunn, Preding, Sankt Josef (Weststeiermark), Sankt Martin im Sulmtal, Sankt Peter im Sulmtal, Sankt Stefan ob Stainz, Schwanberg, Stainz, Wettmannstätten, Wies Graz-Umgebung -
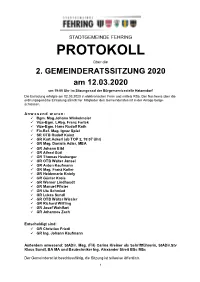
Protokoll 2. Gemeinderatssitzung 2020
STADTGEMEINDE FEHRING PROTOKOLL über die 2. GEMEINDERATSSITZUNG 2020 am 12.03.2020 um 19:00 Uhr im Sitzungssaal der Bürgerservicestelle Hatzendorf Die Einladung erfolgte am 02.03.2020 in elektronischer Form und mittels RSb. Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beige- schlossen. Anwesend waren: ü Bgm. Mag.Johann Winkelmaier ü Vize-Bgm. LAbg. Franz Fartek ü Vize-Bgm. Hans Rudolf Rath ü Fin.Ref. Mag. Ignaz Spiel ü SR OTB Rudolf Kainz ü GR Kurt Ackerl (ab TOP 2, 19:07 Uhr) ü GR Mag. Daniela Adler, MBA ü GR Johann Eibl ü GR Alfred Gütl ü GR Thomas Heuberger ü GR OTB Walter Jansel ü GR Anton Kaufmann ü GR Mag. Franz Koller ü GR Heidemarie Kniely ü GR Günter Krois ü GR Werner Lindhoudt ü GR Manuel Pfister ü GR Ute Schmied ü GR Lukas Sundl ü GR OTB Walter Wiesler ü GR Richard Wilfling ü GR Josef Wohlfart ü GR Johannes Zach Entschuldigt sind: ü GR Christian Friedl ü GR Ing. Johann Kaufmann Außerdem anwesend: StADir. Mag. (FH) Carina Kreiner als Schriftführerin, StADir.Stv Klaus Sundl, BA MA und Bautechniker Ing. Alexander Streit BSc MSc Der Gemeinderat ist beschlussfähig, die Sitzung ist teilweise öffentlich. 1 Vorsitzender: Bgm. Mag. Johann Winkelmaier TAGESORDNUNG: Öffentlicher Teil: 1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 2 Fragestunde 3 Sitzungsprotokoll der 01. Sitzung 2020 des Gemeinderates 4 Beratung und Beschlussfassung – Dislozierter Standort der Musikschule Fehring in Kirchberg an der Raab 5 Bericht des Prüfungsausschusses über die Prüfung 4. Quartal 2019 6 Bericht des Prüfungsausschusses über die Überprüfung des Rechnungsabschlusses 2019 7 Beratung und Beschlussfassung – Rechnungsabschluss 2019 8 Beratung und Beschlussfassung – Vergabe Aufträge Kasernenbrunnen 9 Beratung und Beschlussfassung – Vorhaben Haus der Musik Fehring - Auftragsvergaben 10 Beratung und Beschlussfassung – Verkauf Grdstk. -
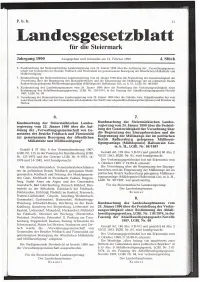
PDF-Dokument
P. b. b. 2L Lamdesgesetzb'Eatt für die Steierrnark Jahrgang 1990 Ausgegeben und versendet am 14. Februar 1990 4. Stück Kundmachung der Steiermärkischen Landesregierung vom 25. Jänner'1990 über die Auflösung der ,,Verwaltungsgemein- schaft von Gemeinden der Bezirke Feldbach und Fürstenfeld zur gemeinsamen Besorgung der öffentlichen MüIlabfuhr und Müllbeseitigung ". 7, Kundmachung der Steiermäikischen Landesregierung vom 24. Jänner 1990 über die Feststeliung der Gesetzwidrigkeit der Verordnung über die Begrenzung des Einzugsbereiches und die Eingrenzung der Müllmenge der im politischen Bezirk Radkersburg gelegenen Müllbeseitigungsanlage (Mülldeponie) Halbenrain Ges. m. b, H., LGBI. Nr. 9Bi 1987. Kundmachung des Landeshauptmannes vom 24. Jänner 1990 über die Feststellung der Verfassungswidrigkeit einer Bestimmung des Abfallbeseitigungsgesetzes, LGBI. Nr. 118/1974, in der Fassung der Abfallbeseitigungsgesetz-Novelle 1987, LGBL NT. 68. 9. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 22. Jänner 1990 über die Gehalts- bzw. Entgeltsansätze der vom Land Steiermark oder von den Gemeinden mit Ausnahme der Stadt Graz angestellten Ki4dergärtner(innen) und Erzieher an Horten. 6. 7. Kundmachung der Steiermärkischen Landes- Kundmachung der Steiermärkischen Landes- regierung vom 25. Jänner 1990 über die Auf- regierung vom 24. Jänner 1990 über die Feststel- lösung der ,Verwaltungsgemeinschaft von Ge- lung der Gesetzwidrigkeit der Verordnung über meinden der Bezirke Feldbach und Fürstenield die Begrenzung des Einzugsbereiches und die zur gemeinsamen Besorgung der öifentlichen Eingrenzung der Mültmenge der im politischen Müllabiuhr und Müllbeseitigung" Bezirk Radkersburg gelegenen Müllbesei- tigungsanlage (Mülldeponie) Halbenrain Ges. m. b. H., LGBI. Nr. 98/1987 Gemäß $ 37 Abs. 6 der Gemeindeordnung 1967, LGBI. Nr. 115, in der Fassung der Kundmachung LGBI. Gemäß Art. 139 Abs, 5 B-VG und gemäß 0 60 Abs, 2 Nr. -

Liste Der Leermelder (Pdf)
Liste der Leermeldungen Leermelder Leermelder* 1. Tranche 2. Tranche 'Hohentwiel' Schiffahrtsgesellschaft m.b.H. X "Am Hafen" Garagenerrichtungs- und Betriebs GmbH X "Arch+Ing" Bildungs- und Dienstleistungsgesellschaft m.b.H. X X "die Angewandte" Continuing Education GmbH in Liqu. X "Dr. Friederike WAWRIK - Stiftungsfonds" X X "DS"-Immobilienvermietungsges.m.b.H. X X "ERHOLUNGSZENTRUM-RHEINAUEN" Badeerrichtungs- & Betriebsgesellschaft m.b.H. X "GetService"-Flughafen-Sicherheits- und Servicedienst GmbH X X "HO-IMMOTREU" Grundstücksverwaltungsgesellschaft m.b.H. X X "HSL - Lindner" Traktorenleasing GmbH X X "Hypo-Rent" Leasing- und Beteiligungsgesellschaft mbH X X "Kärntner Heimstätte" Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und Siedlungsvereinigung X X Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Mongala" Beteiligungsverwaltung GmbH X X "Museumsverbund" Betriebsgesellschaft m.b.H. X "Neue Heimat" Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsges. Kärnten, GmbH X X "ÖISS"- Datensysteme Gesellschaft m.b.H. X X "Österreich Institut G.m.b.H." X "POSEIDON" Grundstücksverwaltungsgesellschaft m.b.H. X X "Theater in der Josefstadt Privatstiftung" X X "Theater in der Josefstadt" Betriebsgesellschaft m.b.H. X X "Verein Haus der Natur - Museum für Natur und Technik" X X "Volkstheater" - Privatstiftung X X "Volkstheater" Gesellschaft m.b.H. X X "VWG" Vorarlberger Wiederverwertungsgesellschaft m.b.H. X "Wiener Stadterneuerungsgesellschaft", Gemeinnützige Wohnbau-, Planungs- und X Betreuungsgesellschaft m.b.H. "Wohn- und Pflegeheim Natters/Mutters/Götzens" X X 100 Jahre Elektrizitätswirtschaft,