Die Synode Des Bistums Meißen 1969 Bis 1971
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
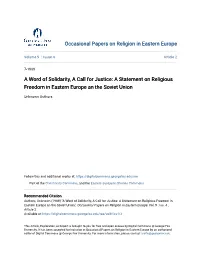
A Statement on Religious Freedom in Eastern Europe an the Soviet Union
Occasional Papers on Religion in Eastern Europe Volume 9 Issue 4 Article 2 7-1989 A Word of Solidarity, A Call for Justice: A Statement on Religious Freedom in Eastern Europe an the Soviet Union Unknown Authors Follow this and additional works at: https://digitalcommons.georgefox.edu/ree Part of the Christianity Commons, and the Eastern European Studies Commons Recommended Citation Authors, Unknown (1989) "A Word of Solidarity, A Call for Justice: A Statement on Religious Freedom in Eastern Europe an the Soviet Union," Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 9 : Iss. 4 , Article 2. Available at: https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol9/iss4/2 This Article, Exploration, or Report is brought to you for free and open access by Digital Commons @ George Fox University. It has been accepted for inclusion in Occasional Papers on Religion in Eastern Europe by an authorized editor of Digital Commons @ George Fox University. For more information, please contact [email protected]. A WORD OF SOLIDARITY, A CALL FOR JUSTICE: A STATEMENT ON RELIGIOUS FREEDOM IN EASTERN EUROPE AND THE SOVIET UNION United States Catholic Conference November 17, 1988 The Church in Eastern Europe and the Soviet Union today is a church of many realities. There is the particularly tragic memory of Bishop Ernest Coba of Albania, murdered by prison authorities for celebrating a Mass with a few other inmates in his cell in contravention of prison regulations on Easter Day, 1979. In Czechoslovakia in 1988 there is the case of Augustin Navratil, a Catholic layman and father of nine, who has been involuntarily committed to a psychiatric clinic for responding to newspaper criticisms of his widely supported 31-point petition for religious rights. -

Medina County Woman Hopes Cold Murder Case Will Heat Up
DAILY NZ P A G E 1A C O L O R P U B D A T E 04-10-05 O P E R A T O R SBLACKWELL DATE / / TIME : State Edition www.MySanAntonio.com THE VOICE OF SOUTH TEXAS SINCE 1865 $1.50 ROYALS HITCHED WITHOUT A HITCH Medina County woman hopes fter 33 star-crossed cold murder case will heat up Aand often unhappy years, Bexar sheriff’s unit now green binder that holds her fon- Christina Hasler, 8, were found dest memories and worst night- dead in their mobile home in through other looking into deaths. mares. Southwest Bexar County five years marriages, public D She began typing: ago on March 28. March 18 “MARCH 2005, the fifth year an- would’ve been Christina’s 13th scorn and familial BY MARIANO CASTILLO niversary of my kids’ deaths. The birthday. dismay, Britain’s EXPRESS-NEWS STAFF WRITER pain gets worse as time passes, The pair were beaten and Nea- you feel so very desperate. WHAT gley stabbed, and both had been Prince Charles and Past sundown, in an isolated CAN I DO TO FIND THIS MUR- dead for several days before they the Duchess of house atop a hill in northeastern DERER? Does no one care?” were discovered in their home Medina County, Anna Jean Hasler The page would go inside the near the Medina County line. Cornwall — the pulled her wheelchair up to the binder, a collection of photos and The investigation garnered more former Camilla kitchen table and placed her fin- writings that chronicle the lives attention in Medina County than gertips on the keys of an electric and unsolved double homicide of in Bexar, and after a year and a TOBY MELVILLE/ASSOCIATED PRESS Parker Bowles — typewriter. -

Roman Catholic Church
OUR LADY OF FATIMA Traditional Latin Mass Roman Catholic Church SOCIETY OF SAINT PIUS X St. Ignatius of Loyola Rev. Fr. Dominique Bourmaud Pastor Our Lady of Fatima: St. Vincent de Paul Priory: Our Lady of Mount Carmel: Third and Peach (Fr. Bourmaud’s Residence) 3900 Scruggs Drive PO Box 141 3110 Flora Avenue N. Richland Hills, TX 76180 Sanger, TX 76266 Kansas City, MO 64109 www.olmcnrh.com www.sangercatholic.com (816) 923-0202 (ext. 515) (817) 284-4809 (940) 458-7344 E-mail: [email protected] Eighth Sunday after Pentecost July 30th, 2017 Fr. Dominique Bourmaud, Pastor Mass Schedule Sanger – Our Lady of Fatima ~ August ~ Saturday, 5th: Mass……………………………………..…..…….5 PM —Followed by the rosary and benediction Sunday, 6th: Mass…..………………………..………………….8 AM Sunday, 13th: Mass*…..…………………………...………..……8 AM Monday, 14th: Mass*…..……………………………..…………...8 AM Tuesday, 15th: Mass* – Feast of the Assumption………………..8 AM —Holy Day of Obligation Saturday, 19th: Mass……………..………………………….……..5 PM Sunday, 20th: Mass…...…………..…...………………………….8 AM Sunday, 27th: Mass………………..………..…………………….8 AM North Richland Hills – Our Lady of Mt. Carmel ~ July ~ Sunday, 30th: Mass………………………..…………………………………….12 PM ~ August ~ Friday, 4th: Mass…………………..……..…………………………………….7 PM —Followed by the rosary and benediction Sunday, 6th: Mass…………………………..….………………………………12 PM Saturday, 12th: Mass……………………………..……………...…………………5 PM Sunday, 13th: Mass*…………………….………..…………………………..…12 PM Tuesday, 15th: Mass* - Feast of the Assumption…..……….…………………....12 PM —Holy Day of Obligation Sunday, 20th: Mass…………………………………..………………………….12 PM Saturday, 26th: Mass…………………………..………..………………………….5 PM Sunday, 27th: Mass……………………………………..………….……………12 PM *Mass celebrated by Fr. Cooper. SATURDAYS AND SUNDAYS CONFESSIONS BEGIN 1 HOUR BEFORE MASS UNLESS OTHERWISE LISTED COVENANT EYES: As mentioned previously, here is an interesting website which can prove helpful to families or individuals on the use of internet. -

Looking Westwards
Founded in 1944, the Institute for Western Affairs is an interdis- Looking westwards ciplinary research centre carrying out research in history, political The role of the Institute for Western Affairs science, sociology, and economics. The Institute’s projects are typi- in the construction of the Lubusz Land concept cally related to German studies and international relations, focusing On local historical policy and collective on Polish-German and European issues and transatlantic relations. memory in Gorzów Wielkopolski The Institute’s history and achievements make it one of the most Cultural heritage against a background important Polish research institution well-known internationally. of transformation in 1970s and 1980s Western Since the 1990s, the watchwords of research have been Poland– Ger- Poland many – Europe and the main themes are: Polish interest in the early medieval past • political, social, economic and cultural changes in Germany; of Kołobrzeg • international role of the Federal Republic of Germany; The Greater Poland Uprising in the French and British daily press • past, present, and future of Polish-German relations; • EU international relations (including transatlantic cooperation); Rosa Luxemburg against war • security policy; Literary fiction and poverty. The example of Gustav Freytag’s novel Soll und Haben • borderlands: social, political and economic issues. The Institute’s research is both interdisciplinary and multidimension- Coming to terms with the West German 68ers in the writings of the 85ers al. Its multidimensionality can be seen in published papers and books The manuscript of the letter of the Polish on history, analyses of contemporary events, comparative studies, bishops to the German bishops and the use of theoretical models to verify research results. -

Catholics in Congress URGH New Cardinals
x r - r * o o — c r i c ~. CD O **sj H c x c x Catholics in Congress CO CO > m cc CD ►—j 33 ( f - o CZ 1---! ‘2 ’ Q X pc m 98th to have a record 141 O 2 IT. O C JTON (NC) - The Catholics — was set at the election bids, accounting for the 13), New Jersey (nine of 16) and o 2 T Third are Episcopalians, with 61 r * *—• ess, which convened beginning of the 97th Congress two members. six-seat gain. California (nine of 47). CD C ill have a record 141 years ago. There were 129 The 17 Catholics in the Senate As for party affiliation, 96 of the Catholics in both the95th Congress BUT IN TERMS of percentage, X a survey of the new remain identical to two years ago, 141 Catholics are Democrats and S o io w s . (1977-78) and 96th Congress (1979- meaning that the entire six-seat 45 are Republican. In the 97th the "most Catholic" delegation ■ '9 * A »—I {J j 80). ey, made by Ameri- increase for Catholics in the new Congress, 89 of the 135 Catholics will come from New Mexico, CO where all three representatives t H - < d for Separation of Congress came in the House of were Democrats and 46 were > X) State, which monitors Representatives. Republican. and one of two senators are aetween government CATHOLICS CONTINUE to be The largest state delegation of Catholics. r n By contrast there will be no H n, found that 17 of 100 the largest faith group in Actually there will be 21 Catholics will come from New —. -

INSIDE Diocesan Conference Day,P
God, grants and special VOLUME XXVI AID Eucharist and Pro-Life Stance, opportunities, p. 8 p. 4 NUMBER 3 P AGE Supreme Court and Ten 44 NO. PERMIT SAN ANGELO, TX ANGELO, SAN US POST US Collection for tsunami victims Commandments, p. 9 ORG. NONPROFIT largest in history, p. 5 MAR Radio en Español, p. 11 Diocesan Conference Day, p. 7 2005 INSIDE Rite of Election, p. 12 UESTED THE WEST REQ VICE TEXAS PO BOX 1829 BOX PO DIOCESE OF SAN ANGELO SAN OF DIOCESE SAN ANGELO TX 76902-1829 TX ANGELO SAN NEWSPAPER OF THE DIOCESE OF SAN ANGELO [email protected] • www.san-angelo-diocese.org SER ADDRESS One week after tracheotomy, pope ‘continues to improve,’ Vatican says by Cindy Wooden Catholic News Asked later if the Vatican's Holy Week Service and Easter schedule, would be changed dras- VATICAN CITY (CNS) – After a week in tically, the spokesman said the Holy Week Rome's Gemelli hospital, where he under- and Easter liturgies "are fixed." went a tracheotomy to ease breathing diffi- "The pope must decide, once he has re- culties, Pope John Paul II "continues to im- turned, the way he will participate in these prove and show progress," the Vatican ceremonies. But at the moment, nothing has spokesman said. been decided," he said. "The surgical wound is healing," spokes- Navarro-Valls said he did not think any man Joaquin Navarro-Valls told reporters changes were being made to the papal apart- March 3. The pope was hospitalized Feb. 24 ment in the Vatican in anticipation of the and underwent the tracheotomy, in which a pope's return, nor did he think special medi- Pope John Paul II blesses the faithful during a surprise appearance from the window tube is placed in the trachea through a hole cal equipment was being installed. -

Asking for Clarity
September 29, 2017 Vol 02, No 19 A journal for restless minds Asking For Clarity Asking For Clarity Doesn’t the Pope Answer His Critics?” His A disconcerting silence objective thoughts and reasoned com- A disconcerting silence ments—in my humble opinion—bear Let Your Actions Speak reading. Rather than interpret, parse, Words are not enough here has been a disconcerting and rephrase his words, I will let Father silence from the Vatican Deacon’s Diner Longenecker speak for himself: Food for a restless mind these past two years, despite “six major initiatives in which Tboth clergy and laity have expressed concerns about the Pope’s teaching, particularly ema- nating from Amoris Laetitia. Despite the his week’s big Catholic news repeated pleas and warnings of chaos and is the release of a “filial correc- confusion, Francis has refused to respond or tion” of Pope Francis by a 1 Colloquī is a Deacon’s Cor- acknowledge the initiatives.” group of theologians and ner weekly journal. Its mission T church laymen. … and purpose: to encourage seri- There are and have ous discussion, to promote rea- been a plethora of reports This is the sixth major soned debate, and to provide on this silence, including initiative in which both serious content for those who this past week in our lo- clergy and laity have ex- hope to find their own pathway cal newspaper. What has pressed concerns about to God. been the thrust of most of the Pope’s teaching, par- Each week Colloquī will the reporting has been to ticularly emanating from contain articles on theology, cast a pall on those who have publicly Amoris Laetitia. -

Reference Guide No. 14
GERMAN HISTORICAL INSTITUTE,WASHINGTON,DC REFERENCE GUIDE NO.14 THE GDR IN GERMAN ARCHIVES AGUIDE TO PRIMARY SOURCES AND RESEARCH INSTITUTIONS ON THE HISTORY OF THE SOVIET ZONE OF OCCUPATION AND THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC, 1945–1990 CONTENTS INTRODUCTION THE EDITORS CENTRAL ARCHIVES 1. Bundesarchiv, Abteilung DDR, Berlin ..................................................... 5 2. Bundesarchiv, Abteilung Milita¨rarchiv, Freiburg .................................. 8 3. Politisches Archiv des Auswa¨rtigen Amts, Berlin ............................... 10 4. Die Bundesbeauftragte fu¨ r die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU), Zentralstelle Berlin, Abteilung Archivbesta¨nde ........ 12 5. Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv (SAPMO), Berlin ............................................ 15 6. Archiv fu¨ r Christlich-Demokratische Politik (ACDP), Konrad-Adenauer-Stiftung, St. Augustin .................................................. 17 7. Archiv des Deutschen Liberalismus (ADL), Friedrich-Naumann-Stiftung, Gummersbach ............................................ 19 STATE ARCHIVES State Archives: An Overview ....................................................................... 21 8. Landesarchiv Berlin ................................................................................... 22 9. Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam ................................ 24 10. Landeshauptarchiv Schwerin ................................................................ -

Comunicato Del Consiglio Di Cardinali Per Lo Studio Dei
N. 0406 Giovedì 05.07.2012 COMUNICATO DEL CONSIGLIO DI CARDINALI PER LO STUDIO DEI PROBLEMI ORGANIZZATIVI ED ECONOMICI DELLA SANTA SEDE: BILANCIO CONSUNTIVO CONSOLIDATO DELLA SANTA SEDE E BILANCIO CONSUNTIVO DEL GOVERNATORATO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO COMUNICATO DEL CONSIGLIO DI CARDINALI PER LO STUDIO DEI PROBLEMI ORGANIZZATIVI ED ECONOMICI DELLA SANTA SEDE: BILANCIO CONSUNTIVO CONSOLIDATO DELLA SANTA SEDE E BILANCIO CONSUNTIVO DEL GOVERNATORATO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO ● TESTO IN LINGUA ITALIANA ● TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE ● TESTO IN LINGUA ITALIANA Martedì 3 e Mercoledì 4 c.m. si è svolta in Vaticano la riunione del Consiglio di Cardinali per lo Studio dei Problemi Organizzativi ed Economici della Santa Sede, presieduta dal Segretario di Stato di Sua Santità, l’Em.mo Cardinale Tarcisio Bertone, S.D.B. Vi hanno partecipato gli Em.mi Cardinali: Joachim Meisner, Arcivescovo di Köln (Germania), Antonio Maria Rouco Varela, Arcivescovo di Madrid (Spagna), Polycarp Pengo, Arcivescovo di Dar-el-Salaam (Tanzania): Francis Eugene George, O.M.I., Arcivescovo di Chicago (USA); Norberto Rivera Carrera, Arcivescovo di México (México), Wilfrid Fox Napier, O.F.M., Arcivescovo di Durban (Sud Africa), Juan Luis Cipriani Thorne, Arcivescovo di Lima (Perù), Angelo Scola, Arcivescovo di Milano (Italia), Telesphore Placidus Toppo, Arcivescovo di Ranchi (India); George Pell, Arcivescovo di Sydney (Australia), Agostino Vallini, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, John Tong Hon, Vescovo di Hong Kong (Cina); Jorge Liberato Urosa Savino, Arcivescovo di Caracas (Venezuela), Jean-Pierre Ricard, Arcivescovo di Bordeaux (Francia), Odilo Pedro Scherer, Arcivescovo di São Paulo (Brasile). La Prefettura per gli Affari Economici della Santa Sede era rappresentata dal Presidente, Sua Em.za Rev.ma il Card. -

German Women Today: What Some German Newspapers Say. Inter Nationes Basis-Info 4-2000/Society
DOCUMENT RESUME ED 439 264 CE 079 887 AUTHOR Born, Sigrid, Ed. TITLE German Women Today: What Some German Newspapers Say. Inter Nationes Basis-Info 4-2000/Society. In Press. INSTITUTION Inter Nationes, Bonn (Germany). PUB DATE 2000-01-00 NOTE 29p. AVAILABLE FROM Inter Nationes, Kennedyallee 91-103, D-53175 Bonn, Germany (free). Tel: 02 28 / 88 00; Fax: 88 04 57; Web site: http://www.inter-nationes.de. PUB TYPE Collected Works General (020) EDRS PRICE MF01/PCO2 Plus Postage. DESCRIPTORS Building Trades; Comparative Analysis; Education Work Relationship; *Employed Women; *Employment Level; Employment Patterns; *Employment Problems; Entrepreneurship; Foreign Countries; Internet; Newspapers; Poverty; *Salary Wage Differentials; Sex Bias; Sex Differences; *Sex Discrimination; Sex Fairness; Small Businesses; *Success; Technical Occupations; Trend Analysis; World Wide Web IDENTIFIERS *Germany ABSTRACT This document contains eight articles from German newspapers that feature women who have achieved career success in very diverse economic sectors, while simultaneously highlighting the discrimination and other problems (including lower income, fewer promotions to executive positions, and smaller pensions) that many other German women continue to encounter in the workplace. The following articles are included: "Introduction" (Simone Denise Battenfeld); "A Woman Helps Small to Medium-Sized Businesses" (Margarete Pauli); "A Woman as Cathedral Building Supervisor in Cologne; Barbara Schock-Werner from Nuremburg Convinced the Churchmen with Her Unusual -

Full Text and Explanatory Notes of Cardinals' Questions on 'Amoris Laetitia'
Full Text and Explanatory Notes of Cardinals’ Questions on ‘Amoris Laetitia’ The full documentation relating to the cardinals’ initiative, entitled ‘Seeking Clarity: A Plea to Untie the Knots in Amoris Laetitia.’ Four cardinals have turned to what they call an “age-old” process of posing a series of questions to Pope Francis in the hope that his clarification will help clear up “grave disorientation and great confusion” caused by key parts of his summary document on the synod on the family, Amoris Laetitia. The cardinals — Carlo Caffarra, archbishop emeritus of Bologna; Raymond Burke, patron of the Sovereign Military Order of Malta; Walter Brandmüller, president emeritus of the Pontifical Committee for Historical Sciences; and Joachim Meisner, archbishop emeritus of Cologne — sent five questions, called dubia (Latin for “doubts”), to the Holy Father and Cardinal Gerhard Müller, prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, on Sept. 19, along with an accompanying letter. Each of the dubia is aimed at eliciting from the Apostolic See clarification on key parts of the document, most notably whether it is admissible to allow any remarried divorcees without an annulment Holy Communion. Due to varying interpretations of this and other parts of the apostolic exhortation Amoris Laetitia (The Joy of Love), some of which appear to contradict previous papal teachings (those of Pope St. John Paul II in particular), the cardinals said they chose to highlight those points in “charity and justice,” for the sake of Church unity. Consistent with his tendency of so far not responding to concerns about the apostolic exhortation, the Holy Father also did not reply to their request, although sources confirm that he did receive it. -

Religious Extremism $5.00 “ Reason Often Makes Mistakes, but CONSCIENCE Never Does.” — Henry Wheeler Shaw
THE NEWSJOURNAL OF CATHOLIC OPINION VOL. XXXIV—NO. 2 2013 Playing Hardball against Women’s Rights The Holy See at the UN JOANNE OMANG Keeping it All in the Family Europe’s Antichoice Movement NEIL DATTA Fatwas are Opinions MARIEME HELIE LUCAS At the Back of the Bus Ultra-Orthodox Judaism and Women DAHLIA LITHWICK ALSO: Book reviews by Bennett Elliott, Roger Ingham, Henk Baars and Eileen Moran WWW.CATHOLICSFORCHOICE.ORG Religious Extremism $5.00 “ Reason often makes mistakes, but CONSCIENCE never does.” — Henry Wheeler Shaw “ He who acts against his CONSCIENCE always sins.” — St. Thomas Aquinas “C ONSCIENCE is the most sacred of all property; other property depending in part on positive law, the exercise of that being a natural and unalienable right.” — James Madison “A good CONSCIENCE is the palace of Christ.” — St. Augustine “ I shall drink—to the Pope, if you please—still to CONSCIENCE first and to the Pope afterwards.” — Blessed John Henry Newman “But no man has a monopoly of CONSCIENCE.” — Mary A. Ward Great minds think alike. Subscribe to CONSCIENCE today $15 for a year’s subscription www.conscience-magazine.org Conscience EDITOR’ S NOTE THE NEWSJOURNAL OF CATHOLIC OPINION Executive Editor Jon O’Brien Editor David J. Nolan ELIGION IS NOT THE BARRIER TO PROGRESS AT THE UNITED NATIONS [email protected] or in parliaments around the world. Religious extremism, on the Contributing Editor Sara Morello other hand, is. Religious extremism ignores the moderate views of Editorial Adviser most religious people and those with no religion, and it has the Rosemary Radford Ruether potential to do serious damage to the health and well-being of Editorial Associate anybody in its path.