Unio Crassus
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pastports, Vol. 3, No. 8 (August 2010). News and Tips from the Special Collections Department, St. Louis County Library
NEWS AND TIPS FROM THE ST. LOUIS COUNTY LIBRARY SPECIAL COLLECTIONS DEPARTMENT VOL. 3, No. 8—AUGUST 2010 PastPorts is a monthly publication of the Special Collections Department FOR THE RECORDS located on Tier 5 at the St. Louis County Library Ortssippenbücher and other locale–specific Headquarters, 1640 S. Lindbergh in St. Louis sources are rich in genealogical data County, across the street Numerous rich sources for German genealogy are published in German-speaking from Plaza Frontenac. countries. Chief among them are Ortssippenbücher (OSBs), also known as Ortsfamilienbücher, Familienbücher, Dorfsippenbücher and Sippenbücher. CONTACT US Literally translated, these terms mean “local clan books” (Sippe means “clan”) or To subscribe, unsubscribe, “family books.” OSBs are the published results of indexing and abstracting change email addresses, projects usually done by genealogical and historical societies. make a comment or ask An OSB focuses on a local village or grouping of villages within an ecclesiastical a question, contact the parish or administrative district. Genealogical information is abstracted from local Department as follows: church and civil records and commonly presented as one might find on a family group sheet. Compilers usually assign a unique numerical code to each individual BY MAIL for cross–referencing purposes (OSBs for neighboring communities can also reference each other). Genealogical information usually follows a standard format 1640 S. Lindbergh Blvd. using common symbols and abbreviations, making it possible to decipher entries St. Louis, MO 63131 without an extensive knowledge of German. A list of symbols and abbreviations used in OSBs and other German genealogical sources is on page 10. BY PHONE 314–994–3300, ext. -

Tschüss, Nullzins: Bei Geld Fängt Der Spaß Erst Richtig An! Jetzt Zu Unserem Sparkassen-Anlegerforum Mit Chin Meyer Kostenfrei Anmelden
18. Juni 2019 Sparkassen- Anlegerforum Tschüss, Nullzins: Bei Geld fängt der Spaß erst richtig an! Jetzt zu unserem Sparkassen-Anlegerforum mit Chin Meyer kostenfrei anmelden Ausgabe 1 | 2019 Auflage: 145.000 Stück „Glück auf, Oberhessen“: Finanzieren mit Heimvorteil: Edle Tropfen: Das Braunkohlerevier Die Baufinanzierung der Die Schlitzer Destillerie Wölfersheim Sparkasse Oberhessen Vorwort Liebe Leserinnen und Leser, die Niedrigzinsphase hat uns nun fast ein Jahrzehnt fest im Griff und viele Menschen haben die Lust am Sparen verloren. Doch es geht auch anders: Wir bieten Ihnen attraktive Auswege aus dem Zinstief und zeigen Ihnen, dass Geld anlegen Spaß machen kann. Dazu veranstalten wir für Sie das kostenfreie „Sparkassen-Anlegerforum“ – eine Infotainment-Veranstaltung mit dem bekannten Finanzkabarettisten Chin Meyer und Dr. Holger Bahr von der DekaBank. Melden Sie sich schnell an – die Plätze sind begrenzt! Auf der anderen Seite sind die niedrigen Zinsen natürlich günstig für alle, die einen Kredit aufnehmen. Insbesondere „Häuslebauer“ profitieren davon. Noch mehr Vorteile haben Sie, wenn Sie mit dem „Heimvorteil“ der Sparkasse Oberhessen finanzieren: Faire Beratung mit flexiblen Beratungszeiten, Top-Konditionen und 18 Monate keine Bereitstellungszinsen. Mehr dazu ab Seite 10. Auch für die vorliegende Ausgabe haben wir uns auf die Suche nach spannenden Geschichten aus Oberhessen gemacht. Diesmal nehmen wir Sie mit auf eine Zeitreise zu einem einst bedeutenden Wirtschaftszweig in Wetterau und Vogelsberg: dem Bergbau. Im ersten Teil unserer Serie „Glück auf, Oberhessen“ zeigen wir Ihnen, wie der Abbau von Braunkohle „über und unter Tage“ 200 Jahre lang die Region um Wölfersheim geprägt hat. Auch die Gegenwart hat viel Interessantes zu bieten: Lesen Sie, wie die Schülerfirma „Frunana“ aus Nidda zur Erfolgsstory wurde (Seite 18), was es mit Hessens erstem „Moped-Marathon“ auf sich hat (Seite 19) und wo in unserer schönen Heimat eine der ältesten Brennereien der Welt steht (Seite 12/13). -

German Limes Road REMARKABLE RELICS of EARTHWORKS and OTHER MONUMENTS, RECONSTRUCTIONS and MUSEUMS
German Limes Road REMARKABLE RELICS OF EARTHWORKS AND OTHER MONUMENTS, RECONSTRUCTIONS AND MUSEUMS. THE GERMAN LIMES ROAD RUNS ALONG THE UPPER GERMAN-RAETIAN LIMES FROM BAD HÖNNINGEN /RHEINBROHL ON THE RHINE TO REGENSBURG ON THE DANUBE AS A TOURIST ROUTE. German Limes Road Dear Reader With this brochure we would like to invite you on a journey in the footsteps of the Romans along the Upper German-Raetian Limes recognized by UNESCO as a World Heritage site. This journey has been made German Limes Road possible for you by the association “Verein Deutsche German Limes Cycleway Limes-Straße e.V.”, which has laid out not only the German Limes Trail German Limes Road but also the German Limes Cycle- way for you. In addition to this, we would also like to The Upper German-Raetian Limes, the former border of the Roman introduce you to the Limes Trail. Empire between the Rhine and the Danube, recognised today by UNESCO as a World Heritage site, can be explored not only by car, but also by bike The association in which 93 municipalities, administra- or on foot along fully signposted routes. tive districts and tourism communities have come together, aims at generating an awareness in public of The German Limes Road, the German Limes Cycleway and the German the Limes as an archaeological monument of world his- Limes Trail offer ideal conditions for an encounter with witnesses of an torical significance. With its activities based on sharing ancient past as well as for recreational activities in beautiful natural land - knowledge and marketing, it wants to raise interest for scapes. -
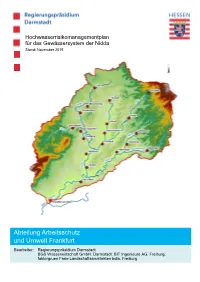
HWRM-Nidda-Langfassung.Pdf
Hochwasserrisikomanagementplan für das Gewässersystem der Nidda Stand: November 2015 Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt Bearbeiter: Regierungspräsidium Darmstadt BGS Wasserwirtschaft GmbH, Darmstadt; BIT Ingenieure AG, Freiburg, faktorgruen Freie Landschaftsarchitekten bdla, Freiburg Bearbeiter: Brandt Gerdes Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH Pfungstädter Straße 20 64297 Darmstadt Internet: www.bgswasser.de Tel.: +49 (0)6151 9453-0 Fax: +49 (0)6151 9453-80 BIT Ingenieure AG Talstraße1 79102 Freiburg Internet: http://www.bit-ingenieure.de Tel.: +49 (0)761 29657-0 Fax: +49 (0)761 29657-11 faktorgruen Freie Landschaftsarchitekten BDLA Merzhauser Straße 110 79100 Freiburg Internet: www.faktorgruen.de Tel.: +49 (0)761 707647-0 Fax: +49 (0)761 707647-50 Regierungspräsidium Darmstadt Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt Dezernat IV/F 41.2 - Oberflächengewässer Gutleutstraße 114 60327 Frankfurt am Main Internet: www.rp-darmstadt.hessen.de Tel.: +49 (0)69 2714-0 Fax: +49 (0)69 2714-5950 Hochwasserrisikomanagementplan Nidda Der Hochwasserrisikomanagementplan für das Gewässersystem der Nidda, nachfolgend vereinfachend als Hochwasserrisikomanagementplan Nidda bezeichnet, umfasst das gesamte Einzugsgebiet der Nidda mit der Nidda als Hauptge- wässer inklusive der Nebengewässer Nidder, Seemenbach, Wetter, Usa und Horloff. Der Hochwasserrisikomanagementplan Nidda ist wie folgt dokumentiert: Mappe 1: Textunterlagen - Hochwasserrisikomanagementplan - Maßnahmensteckbrief - Umweltbericht Mappe 2: Planunterlagen - Übersicht Projektgebiet - -

Ki-Klz Last Updated March 2015 Kichler?FN: Said by the Paulskaya FSL to Be Fromuc Marburg, Hessen
AHSGR American Historical Society of Germans From Russia Germanic Origins Project Legend: BV=a German village near the Black Sea . FN= German family name. FSL= First Settlers’ List. GL= a locality in the Germanies. GS= one of the German states. ML= Marriage List. RN= the name of a researcher who has verified one or more German origins. UC= unconfirmed. VV= a German Volga village. A word in bold indicates there is another entry regarding that word or phrase. Click on the bold word or phrase to go to that other entry. Red text calls attention to information for which verification is completed or well underway. Push the back button on your browser to return to the Germanic Origins Project home page. Ki-Klz last updated March 2015 Kichler?FN: said by the Paulskaya FSL to be fromUC Marburg, Hessen. I could not find this family in the 1798 Volga censuses. KicklingenGL: see Kecklingen. Kidow(?)GL: was an unidentified locality which according to the Frank FSL was in the state of Hessen- Darmstadt and was homeUC to a Eckert family. Kiebingen?, Hezogtum Wuerttemberg[sic?]: is 2.5 km SE of Rottenburg-am-Neckar and appears in the 17th century to have been in Hasburgian Lands, not Wuerettemberg, however the Hasburgians may have hired Wuerttemberg to handle their diplomatic work for this relatively small outpost of their holdings. It was said by the Rosenheim FSL to be homeUC to a Mueller{Johannes} family. KieblerFN: see Keifler and Kifler?. Kiech{Johannes}: was godfather to Sippel{Johannes} one of the twin sons of Sippel{Johannes} baptized in Luebeck 18 July 1766 (Mai&Marquardt#1324). -

The Excavation of WWII RAF Bomber, Halifax LV881-ZA-V
Pre-print - For the Journal of Conflict Archaeology (2018) The Excavation of WWII RAF Bomber, Halifax LV881-ZA-V PHIL MARTERa, RONALD VISSERb, PIM ALDERSc, CHRISTOPH RÖDERd, MICHAEL GOTTWALDe, MIRKO MANKf, STEVEN HUBBARDg, UDO RECKERh aDepartment of Archaeology, University of Winchester, UK; bDepartment of Archaeology, Saxion University of Applied Sciences, Deventer, The Netherlands; chessenARCHÄOLOGIE , Wiesbaden, Germany; dIndependent Aviation Archaeologist, Flugzeugwrackmuseum, Ebsdorfergrund, Germany; eDirector of Archaeology of the Federal State of Hesse, Wiesbaden, Germany. ABSTRACT. This article outlines the preliminary results of archaeological fieldwork at the crash site of RAF Halifax bomber LV881-ZA-V and explores some of the challenges presented by the excavation of this military wartime crash site. The aircraft and her crew were shot down by a German night fighter in the early hours of March 31st 1944 during the infamous Nuremberg Raid. Four of her crew were killed and the remaining three were taken prisoner and later took part in the ‘Long March’. All three survived the war. An international team comprised of staff and students from Germany, the Netherlands, Finland and the UK explored what remained of the crash site, located on a hill outside the village of Steinheim, north east of Frankfurt in the German Federal State of Hesse. KEY WORDS: World War II, RAF, Bomber Command, Crash site, Aviation Archaeology, Halifax bomber. Introduction The village of Steinheim lies among the gently rolling hills of the Wetterau region, some 50 km north east of Frankfurt in the district of Gießen (see Figure 1a and 1b). The rural district of Gießen forms part of the German Federal State of Hesse, and was an area frequently over-flown by Allied bombers during World War II. -
Naturschutzjahresbericht 2004/2005 Für Den Wetteraukreis
Naturschutzjahresbericht 2004/2005 für den Wetteraukreis Im Internet unter: www.wetteraukreis.de/berichte/index.htm Naturschutzjahresbericht 2004/2005 für den Wetteraukreis Eine Zusammenstellung ausgewählter Aktivitäten des Naturschutzes im Wetteraukreis Impressum Herausgeber: Der Kreisausschuss des Wetteraukreises Erster Kreisbeigeordneter Bertram Huke Europaplatz 61169 Friedberg Titelbild: Heckrinder (Auerochsenrückzüchtungen) bei Ranstadt (Foto: Olberts, NFW) Redaktion und Layout: Ralf Eichelmann, Fachdienst Naturschutz und Landschaftspflege Dr. Burkhard Olberts, Naturschutzfonds Wetterau e.V. – Landschaftspflegeverband des Wetteraukreises Druck: Druckerei der Kreisverwaltung Friedberg Beiträge: Für den Inhalt der einzelnen Beiträge sind die jeweiligen Autorinnen und Autoren verantwortlich. Friedberg, Februar 2006 Grußwort des Ersten Kreisbeigeordneten und Naturschutzdezernenten Bertram Huke zum Naturschutzjahresbericht 2004/2005 des Wetteraukreises Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Naturschutzes, ich hoffe, Sie haben sich schon gefragt, warum es keinen Naturschutzjahresbericht 2004 gab? Schließlich waren die Naturschutzjahresberichte 2001, 2002 und 2003 so erfolg- reich, dass Sie sicher schon auf den Bericht des Jahres 2004 gewartet haben! Ihnen als Expertinnen und Experten in Sachen Naturschutz und Landschaftspflege muss ich aber sicher nicht näher erläutern, dass sich Erfolge in diesen Gebieten im Gegensatz zur Wirtschaft nicht jedes Jahr einstellen, sondern erst mittel- oder sogar langfristig zu erkennen -

A Dataset and Evaluation Framework for Complex Geographical Description Parsing
A Dataset and Evaluation Framework for Complex Geographical Description Parsing Egoitz Laparra Steven Bethard School of Information School of Information University of Arizona University of Arizona Tucson, AZ, USA Tucson, AZ, USA [email protected] [email protected] Abstract Much previous work on geoparsing has focused on identifying and resolving individual toponyms in text like Adrano, S.Maria di Licodia or Catania. However, geographical locations occur not only as individual toponyms, but also as compositions of reference geolocations joined and modified by connectives, e.g., “. between the towns of Adrano and S.Maria di Licodia, 32 kilometres northwest of Catania”. Ideally, a geoparser should be able to take such text, and the geographical shapes of the toponyms referenced within it, and parse these into a geographical shape, formed by a set of coordinates, that represents the location described. But creating a dataset for this complex geoparsing task is difficult and, if done manually, would require a huge amount of effort to annotate the geographical shapes of not only the geolocation described but also the reference toponyms. We present an approach that automates most of the process by combining Wikipedia and OpenStreetMap. As a result, we have gathered a collection of 360,187 uncurated complex geolocation descriptions, from which we have manually curated 1,000 examples intended to be used as a test set. To accompany the data, we define a new geoparsing evaluation framework along with a scoring methodology and a set of baselines. 1 Introduction Geoparsing, or toponym resolution, is the task of identifying geographical entities, and attaching them to their corresponding reference in a coordinate system (Gritta et al., 2018b). -

River Development Planning (RDP)
River Development Planning (RDP) Final project report Date of report: 17 November 2018 Report number: 2017/12 - 2018/08 Introduction to IMPEL The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL) is an international non-profit association of the environmental authorities of the EU Member States, acceding and candidate countries of the European Union and EEA countries. The association is registered in Belgium and its legal seat is in Brussels, Belgium. IMPEL was set up in 1992 as an informal Network of European regulators and authorities concerned with the implementation and enforcement of environmental law. The Network’s objective is to create the necessary impetus in the European Community to make progress on ensuring a more effective application of environmental legislation. The core of the IMPEL activities concerns awareness raising, capacity building and exchange of information and experiences on implementation, enforcement and international enforcement collaboration as well as promoting and supporting the practicability and enforceability of European environmental legislation. During the previous years IMPEL has developed into a considerable, widely known organisation, being mentioned in a number of EU legislative and policy documents, e.g. the 7th Environment Action Programme and the Recommendation on Minimum Criteria for Environmental Inspections. The expertise and experience of the participants within IMPEL make the network uniquely qualified to work on both technical and regulatory aspects -

Abteilung Arbeitsschutz Und Umwelt Frankfurt
Maßnahmensteckbrief Hochwasserrisikomanagementplan für das Gewässersystem der Nidda Stand: November 2015 Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt Bearbeiter: Regierungspräsidium Darmstadt BGS Wasserwirtschaft GmbH, Darmstadt; BIT Ingenieure AG, Freiburg, faktorgruen Freie Landschaftsarchitekten bdla, Freiburg Bearbeiter: Brandt Gerdes Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH Pfungstädter Straße 20 64297 Darmstadt Internet: www.bgswasser.de Tel.: +49 (0)6151 9453-0 Fax: +49 (0)6151 9453-80 BIT Ingenieure AG Talstraße1 79102 Freiburg Internet: http://www.bit-ingenieure.de Tel.: +49 (0)761 29657-0 Fax: +49 (0)761 29657-11 faktorgruen Freie Landschaftsarchitekten BDLA Merzhauser Straße 110 79100 Freiburg Internet: www.faktorgruen.de Tel.: +49 (0)761 707647-0 Fax: +49 (0)761 707647-50 Regierungspräsidium Darmstadt Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt Dezernat IV/F 41.2 - Oberflächengewässer Gutleutstraße 114 60327 Frankfurt am Main Internet: www.rp-darmstadt.hessen.de Tel.: +49 (0)69 2714-0 Fax: +49 (0)69 2714-5950 Maßnahmensteckbrief Hochwasserrisikomanagementplan Nidda Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS 1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN 1 2 MAßNAHMENTYPENKATALOG: ÜBERSICHT DER EINZELMAßNAHMEN 4 3 SCHEMA ZUR BEWERTUNG VON MAßNAHMENVORSCHLÄGEN 7 4 GRUNDLEGENDE MAßNAHMEN - ZUSTÄNDIGKEITEN 10 5 WEITERGEHENDE MAßNAHMEN - KLASSIFIZIERUNG, WIRKUNGSANALYSE, AUFWAND UND VORTEIL 14 5.1 Vorbemerkungen 14 5.2 Weitergehende Maßnahmen an der Wetter 18 5.3 Weitergehende Maßnahmen an der Horloff 21 5.4 Weitergehende Maßnahmen an der Nidda 23 5.5 Weitergehende -

Embryotoxicity Along the Nidda River And
Schweizer et al. Environ Sci Eur (2018) 30:22 https://doi.org/10.1186/s12302-018-0150-4 RESEARCH Open Access The importance of sediments in ecological quality assessment of stream headwaters: embryotoxicity along the Nidda River and its tributaries in Central Hesse, Germany Mona Schweizer1* , Andreas Dieterich1, Núria Corral Morillas1,2, Carla Dewald1, Lukas Miksch1, Sara Nelson1, Arne Wick3, Rita Triebskorn1,4 and Heinz‑R. Köhler1 Abstract Background: Although the crucial importance of sediments in aquatic systems is well-known, sediments are often neglected as a factor in the evaluation of water quality assessment. To support and extend previous work in that feld, this study was conducted to assess the impact of surface water and sediment on fsh embryos in the case of a highly anthropogenically infuenced river catchment in Central Hesse, Germany. Results: The results of 96 h post fertilisation fsh embryo toxicity test with Danio rerio (according to OECD Guide‑ line 236) revealed that river samples comprising both water and sediment exert pivotal efects in embryos, whereas surface water alone did not. The most prominent reactions were developmental delays and, to some extent, malfor‑ mations of embryos. Developmental delays occurred at rates up to 100% in single runs. Malformation rates ranged mainly below 10% and never exceeded 25%. Conclusion: A clear relationship between anthropogenic point sources and detected efects could not be estab‑ lished. However, the study illustrates the critical condition of the entire river system with respect to embryotoxic potentials present even at the most upstream test sites. In addition, the study stresses the necessity to take into account sediments for the evaluation of ecosystem health in industrialised areas. -

Misgurnus Fossilis L.) in Rhineland-Palatinate and Hesse, Germany
Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst. 2018, 419, 43 Knowledge & © B. Schreiber et al., Published by EDP Sciences 2018 Management of Aquatic https://doi.org/10.1051/kmae/2018031 Ecosystems www.kmae-journal.org Journal fully supported by Onema RESEARCH PAPER Reintroduction and stock enhancement of European weatherfish (Misgurnus fossilis L.) in Rhineland-Palatinate and Hesse, Germany Benjamin Schreiber1,*, Egbert Korte2, Thomas Schmidt1,3 and Ralf Schulz1,3 1 Institute for Environmental Sciences, University of Koblenz-Landau, Fortstrasse 7, 76829 Landau, Germany 2 Institut für Gewässer- und Auenökologie GbR, Riedstadt, Germany 3 Eusserthal Ecosystem Research Station, University of Koblenz-Landau, Birkenthalstrasse 13, 76857 Eusserthal, Germany Abstract – A stocking program for the endangered European weatherfish (Misgurnus fossilis L.) was conducted in the German federal states of Rhineland-Palatinate and Hesse, southwest Germany. An initial monitoring enabled to identify local broodstock and to assess habitats regarding their ecological suitability for reintroduction. In a second step, broodstock were caught for artificial propagation and cultured fry were released in previously selected river sectors. Furthermore, reintroduction sectors were biannually monitored to assess stocking success. Within the study period (2014–2016), a total number of approximately 83,500 juveniles were stocked in three river sectors for reintroduction and approximately 85,000 juveniles were stocked in four other river sectors to strengthen existing populations. During the post-release monitoring, 45 individuals were recaptured in two sectors. The documented short-term reintroduction success (i.e. survival of released individuals) indicates appropriateness of the selected stocking strategy. Furthermore, the provided course of action might be transferred to further states or countries and thereby contribute to weatherfish conservation at larger scales.