GUGLE – Smart City Wien Penzing, Alsergrund
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Jewish Middle Class in Vienna in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries
The Jewish Middle Class in Vienna in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries Erika Weinzierl Emeritus Professor of History University of Vienna Working Paper 01-1 October 2003 ©2003 by the Center for Austrian Studies (CAS). Permission to reproduce must generally be obtained from CAS. Copying is permitted in accordance with the fair use guidelines of the U.S. Copyright Act of 1976. CAS permits the following additional educational uses without permission or payment of fees: academic libraries may place copies of CAS Working Papers on reserve (in multiple photocopied or electronically retrievable form) for students enrolled in specific courses; teachers may reproduce or have reproduced multiple copies (in photocopied or electronic form) for students in their courses. Those wishing to reproduce CAS Working Papers for any other purpose (general distribution, advertising or promotion, creating new collective works, resale, etc.) must obtain permission from the Center for Austrian Studies, University of Minnesota, 314 Social Sciences Building, 267 19th Avenue S., Minneapolis MN 55455. Tel: 612-624-9811; fax: 612-626-9004; e-mail: [email protected] 1 Introduction: The Rise of the Viennese Jewish Middle Class The rapid burgeoning and advancement of the Jewish middle class in Vienna commenced with the achievement of fully equal civil and legal rights in the Fundamental Laws of December 1867 and the inter-confessional Settlement (Ausgleich) of 1868. It was the victory of liberalism and the constitutional state, a victory which had immediate and phenomenal demographic and social consequences. In 1857, Vienna had a total population of 287,824, of which 6,217 (2.16 per cent) were Jews. -

VIENNA UNIVERSITY of TECHNOLOGY INTERNATIONAL OFFICE Gusshausstrasse 28 / 1St Floor, A-1040 Wien
VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY INTERNATIONAL OFFICE Gusshausstrasse 28 / 1st floor, A-1040 Wien Contact: Tel: +43 (0)1 58801 - 41550 / 41552 Fax: +43 (0)1 58801 - 41599 Email: [email protected] ANKUNFT http://www.tuwien.ac.at/international Opening hours: Monday, Thursday: 9:30 a.m. – 11:30 a.m., 1:30 p.m. – 4:30 p.m. Wednesday: 9:30 a.m. – 11:30 a.m. How to reach us: Metro: U1 (Station Taubstummengasse) U2 (Station Karlsplatz) U4 (Station Karlsplatz) Tram: Line 62 (Station Paulanergasse) Line 65 (Station Paulanergasse) Line 71 (Station Schwarzenbergplatz) Welcome Guide TU Wien │ 1 Published by: International Office of Vienna University of Technology Gusshausstrasse 28 A-1040 Wien © 2014 Print financed by funds of the European Union 2 │ Welcome Guide TU Wien CONTENTS GENERAL INFORMATION ABOUT TU WIEN .............................................. 5 1 History of Vienna University of Technology ......................................... 5 2 Structure of Vienna University of Technology ...................................... 6 3 Fields of Study ..................................................................................... 7 4 The Austrian National Union of Students ........................................... 11 PLANNING IN YOUR HOME COUNTRY..................................................... 13 1 Applying for Studies at TU Wien ........................................................ 13 2 Visa ....................................................................................................13 3 Linguistic Requirements .................................................................... -

Jewish Communities of Leopoldstadt and Alsergrund
THE VIENNA PROJECT: JEWISH COMMUNITIES OF LEOPOLDSTADT AND ALSERGRUND Site 1A: Introduction to Jewish Life in Leopoldstadt Leopoldstadt, 1020 The history of Jews in Austria is one of repeated exile (der Vertreibene) and return. In 1624, after years and years of being forbidden from living in Vienna, Emperor Ferdinand III decided that Jewish people could return to Vienna but would only be allowed to live in one area outside of central Vienna. That area was called “Unterer Werd” and later became the district of Leopoldstadt. In 1783, Joseph II’s “Toleranzpatent” eased a lot of the restrictions that kept Jews from holding certain jobs or owning homes in areas outside of Leopoldstadt. As a result, life in Vienna became much more open and pleasant for Jewish people, and many more Jewish immigrants began moving to Vienna. Leopoldstadt remained the cultural center of Jewish life, and was nicknamed “Mazzeinsel” after the traditional Jewish matzo bread. Jews made up 40% of the people living in the 2nd district, and about 29% of the city’s Jewish population lived there. A lot of Jewish businesses were located in Leopoldstadt, as well as many of the city’s synagogues and temples. Tens of thousands of Galician Jewish refugees from Eastern Europe made their home there, and brought many of their traditions (such as Yiddish literature) with them. Questions to Consider Look up the history of Jewish eXile and return in Vienna. How many times were they sent away from the city, and why did the city let them return? What were some of the restrictions on Jewish life in Vienna before the “Toleranzpatent” in 1783? What further rights did Jewish people gain in 1860? How did this affect Jewish life and culture in Vienna in the late 1800s and early 1900s? Describe the culture of Leopoldstadt before 1938. -

Building an Unwanted Nation: the Anglo-American Partnership and Austrian Proponents of a Separate Nationhood, 1918-1934
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Carolina Digital Repository BUILDING AN UNWANTED NATION: THE ANGLO-AMERICAN PARTNERSHIP AND AUSTRIAN PROPONENTS OF A SEPARATE NATIONHOOD, 1918-1934 Kevin Mason A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of PhD in the Department of History. Chapel Hill 2007 Approved by: Advisor: Dr. Christopher Browning Reader: Dr. Konrad Jarausch Reader: Dr. Lloyd Kramer Reader: Dr. Michael Hunt Reader: Dr. Terence McIntosh ©2007 Kevin Mason ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Kevin Mason: Building an Unwanted Nation: The Anglo-American Partnership and Austrian Proponents of a Separate Nationhood, 1918-1934 (Under the direction of Dr. Christopher Browning) This project focuses on American and British economic, diplomatic, and cultural ties with Austria, and particularly with internal proponents of Austrian independence. Primarily through loans to build up the economy and diplomatic pressure, the United States and Great Britain helped to maintain an independent Austrian state and prevent an Anschluss or union with Germany from 1918 to 1934. In addition, this study examines the minority of Austrians who opposed an Anschluss . The three main groups of Austrians that supported independence were the Christian Social Party, monarchists, and some industries and industrialists. These Austrian nationalists cooperated with the Americans and British in sustaining an unwilling Austrian nation. Ultimately, the global depression weakened American and British capacity to practice dollar and pound diplomacy, and the popular appeal of Hitler combined with Nazi Germany’s aggression led to the realization of the Anschluss . -

DISCLOSURE TEMPLATE Gilead Sciences Gesmbh
PHARMIG CODE OF CONDUCT - GUIDANCE REGARDING ARTICLE 9 - STANDARDIZED DISCLOSURE TEMPLATE Gilead Sciences GesmbH DISCLOSURE TEMPLATE - ARTICLE 9 CoC (TRANSPARENCY) Reporting period (calendar year):2020 Date of publication:30/06/2021 Where available: Donations Contribution to costs of events Fees for services and Full Name Practice or business address physician and Grants (cf. Article 9.4a 1) (i), (ii) consultancy(cf. number to HCOs CoC and/or Article 9.4b 2) (i), Article 9.4a 2) CoC commercial (ii), (iii) CoC) and/or Article 9.4b register number, 3) CoC) association register number TOTAL Optional (cf. (cf. (cf. (cf. per(cf. HCP, Article all transfers 9.4 of (cf. Support Registrati HCPTravel will be summed& up]Fees Outlays Article Article Article Article CoC) Article agreements on fees accomodati 9.4 CoC) 9.4 CoC) 9.4 CoC) 9.4 CoC) 9.4b 1) with HCOs on CoC) / third parties appointed by HCOs to manage an event Priv.-Doz. Dr Kinderspitalgass Attarbaschi Wien, Alsergrund Austria N/A N/A 1,210 1,210 e 6 Andishe Dr. Bachmayer Oberndorf bei Paracelsusstraße Austria N/A N/A 330 330 H Sebastian Salzburg 37 C P s ao. Univ.Prof. Dr. Bellmann Innsbruck Austria Anichstraße 35 N/A N/A 800 800 Romuald Dr. Breitenecker Otto-Bauer-Gasse Wien, Mariahilf Austria N/A N/A 1,950 112 2,062 Florian 15/10 Where available: Donations Contribution to costs of events Fees for services and Full Name Practice or business address physician and Grants (cf. Article 9.4a 1) (i), (ii) consultancy(cf. -

How Water and Its Use Shaped the Spatial Development of Vienna
Water Hist (2016) 8:301–328 DOI 10.1007/s12685-016-0169-7 How water and its use shaped the spatial development of Vienna 1 2 3 Friedrich Hauer • Severin Hohensinner • Christina Spitzbart-Glasl Received: 2 February 2015 / Accepted: 9 July 2016 / Published online: 2 August 2016 Ó The Author(s) 2016. This article is published with open access at Springerlink.com Abstract Telling an environmental history of Vienna’s urban waters, this paper advocates the compound study of the evolution of fluvial and urban form. It traces the structural permanence of diverse types of running waters in a period of massive urban transformation from early modern times to present. The focus on the material effects, side-effects and afterlives of socio-natural processes offers novel perspectives to the reconstruction of city development. The featured cases show that long-term studies are vital in understanding the genesis of urban water bodies and urban form as a product of socio-natural processes. They inform us about the inertia of arrangements and the unforeseen perpetuation of site-specific effects of interventions. Societal interaction with natural elements such as Vienna’s waters, we conclude, reverberates in the material and immaterial realm alike. Keywords Urban Development Á River Dynamics Á Industrialisation Á Persistence Á Structural Permanence Á Mills & Friedrich Hauer [email protected] Severin Hohensinner [email protected] Christina Spitzbart-Glasl [email protected] 1 Department of Urban Design, Vienna University of Technology (TU Wien), Karlsplatz 13, 1040 Vienna, Austria 2 Institute of Hydrobiology and Aquatic Ecosystem Management (IHG), University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (BOKU), Max-Emanuel-Str. -

BUWOG Hands "Westlife" Project in Penzing Over to Owners
Vienna, 02 March 2015 BUWOG hands "Westlife" project in Penzing over to owners A total of 26 residential units on Missindorfstraße/Linzerstraße near Matznerpark Over 80% of the flats already sold Optimal transport connections due to proximity of tram, bus, commuter train and metro BUWOG Group has completed the "Westlife" project in the Penzing district of Vienna with a total of 26 residential units (23 of them privately financed investment and three owner-occupied flats) and will begin handing them over to the owners this coming week. At present, only five of the modern facility's flats are still available, with flat sizes ranging from 55 m² to 63 m². The biggest of the residential units still available also has a 70 m² garden area. The facility's centrepiece, the green interior courtyard, is available to all of the residents. The residential units of the project are equipped with either a balcony/loggia or terrace. The "Westlife" project's transport connections are optimal: the Hütteldorfer Straße (U3) and Hietzing (U4) metro stations are each about a ten-minute walk away, the 52 tram line stops directly in front of the residential facility on Diesterweggasse, and the Penzing commuter train station is within view. The Ameisgasse bus station (51A) completes the range of nearby public transportation options. By car the Western Motorway (A1) can be quickly reached via the Wienzeile and the Southern Motorway (A2) via Grünbergstraße. There are 21 private parking spaces available in the residential facility for the owners. In the future, as well, the relevance of the 14th district of Vienna will be significant for BUWOG group. -

Analysing Spatial Patterns of Social Housing Schemes in Vienna and Copenhagen
MASTERARBEIT Titel der Masterarbeit Location of Social Housing: Analysing spatial patterns of social housing schemes in Vienna and Copenhagen Verfasserin DI Sandra Jurasszovich angestrebter akademischer Grad Master of Arts (MA) Wien, 1. September 2015 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 066 664 Studienrichtung lt. Studienblatt: Masterstudium DDP Urban Studies Betreuer: Prof. Dr. Jesús Leal (Universidad Complutense de Madrid) Sandra Jurasszovich Location of Social Housing: Analysing spatial spatial patterns of social housing schemes in Vienna and Copenhagen Erasmus Mundus Master Course in Urban Studies [4Cities] 2013-2015 1st of September 2015 Supervisor: Jesús Leal Abstract Providing social housing is a crucial subject in current political debate as well as in scientific literature. When examining the topic of social housing there are two major issues: firstly, what socio- demographic groups are entitled to benefit from social housing and how has the socio-economic composition changed over the last decades? And secondly, where in a city are social housing units built? The latter question, which is related to the planning system of a city, is oftentimes underestimated, disregarded or simply overlooked in literature covering social housing in Europe. This thesis addresses exactly this problem, its objective being the identification of how the planning systems are used to influence the location of social housing developments across urban space by the example of Vienna and Copenhagen. Both cities have repeatedly been appraised as being amongst the most liveable cities worldwide. As a result of their increasing attractiveness as a place to live in, land and housing prices have been soaring. The research underlines that the possibilities for providers of social housing are limited considerably by high land price. -

Vielfältige Natur in Penzing. Kurzfassung
Vielfältige Natur in Penzing Kurzfassung Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeines zum Biosphärenpark Wienerwald .............................................................................. 3 2. Vielfältige Natur im Gemeindebezirk Penzing ................................................................................. 4 2.1 Zahlen und Fakten ................................................................................................................... 4 2.2 Landschaftliche Beschreibung ................................................................................................. 5 2.3 Wald ........................................................................................................................................ 6 2.4 Offenland ................................................................................................................................. 8 2.5 Gewässer ............................................................................................................................... 17 2.6 Schutz- und Erhaltungsziele im Gemeindebezirk .................................................................. 23 Bearbeitung: Biosphärenpark Wienerwald Management GmbH Norbertinumstraße 9 3013 Tullnerbach Telefon: +43 2233 54187 Fax: +43 2233 54187-50 Email: [email protected] https://www.bpww.at Redaktion: Mag. Johanna Scheiblhofer Wolfgang Schranz Stand: Oktober 2019, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben dienen ausschließlich der Information. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit -

First Vienna Residential Market Report | 2021 02
FIRST VIENNA RESIDENTIAL MARKET REPORT EDITION 2021 Illus fehlen hier noch EDITORIAL issues such as: What role does digitalisation play in the residential space? DEAR READER How can we best combine sustainability and affordability in residential de- velopment projects? How will future residential project planning respond We are pleased to present the First Vienna Residential Market Report, the to the increased trend of working from home in the light of the pandemic? ninth edition of our joint publication. We will be going into this last question on page 14. THIS HAS BEEN A TURBULENT YEAR with the pandemic leav- ing its mark on every aspect of the economy, resulting in long-term ef- fects for many. The real estate industry has not remained unscathed by the crisis, although the residential market is showing significantly more “The past year has brought even more focus on stability: The demand for residential accommodation remained high in the home, raising important questions concern- 2020 – probably due to the fact that residential property is a safe form of investment in general. ing the housing market.” THE HIGH DEMAND also resulted from constantly increasing numbers of one-person households and the continued rise in Vienna’s population, which is due to reach the two million mark in 2028. In contrast, property IN THE FIRST VIENNA RESIDENTIAL MARKET REPORT, we developers in 2021 will still have challenges to face as land available for will be sharing our experience and expertise for a more in-depth and com- development has become scarce in the capital and construction costs are prehensive insight into the market. -
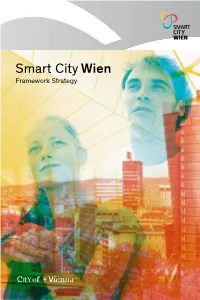
Smart City Wien Framework Strategy Smart City Wien Framework Strategy Our City Has Been Smart for Several Generations
Smart City Wien Framework Strategy Smart City Wien Framework Strategy Our city has been smart for several generations. Far-sighted, intelligent solutions for its daily life have made Vienna the city with the highest qual ity of life worldwide.This is clearly borne out by its drinking water supply or social housing construction activities. However, to maintain this high qual ity of life against the background of restricting conditions, it is necessary to strive for constant self-analysis and the development of new and innovative solutions – in brief: to reinvent oneself continuously, especially as climate change and increasingly scarce resources call for novel global approaches. With the Smart City Wien framework strategy,Vienna is charting its course towards becoming a “smart city”.This is a course that differs from the strat egies of other cities in one key respect: Vienna will not let anybody down. For Vienna, the integration of the social component into all areas is an essential element of its framework strategy. Climate-related and ecologi cal objectives and the improvement of the everyday realities of its citizens are assigned the same importance in Vienna. Cities are smart if all people living in them have access to the same degree of participation. The Smart City Wien framework strategy constitutes a milestone in the future development of the Austrian capital – a strategy designed to ensure that all Viennese will continue living in the world’s most liveable city even in the coming decades. Dr. Michael Häupl Mag.a Maria Vassilakou Mayor Executive City Counsillor for Urban Planning, Traffic & Transport, Climate Pro tection, Energy and Public Participation Photo Häupl: Michelle Pauty/PID, Photo Vassilakou: Lukas Beck Lukas Vassilakou: Photo Photo Häupl: Michelle Pauty/PID, Foreword The Smart City Wien Initiative Vienna is a fantastic place to live and work in.The city is growing, and The big Smart City Wien Initiative was launched in 2011 under so are its opportunities.This growth is based on several strong factors, the aegis of Mayor Michael Häupl. -

2020 Current Market Rents Estimates
2020 CURRENT MARKET RENTS ESTIMATES EXCEPTIONALLY OBTAINED BY UPDATING THE VALUES FROM THE 2019 SURVEYS WITH ESTATE AGENCIES USING INDICES FROM NATIONAL SOURCES TABLE OF CONTENTS Pages Introduction .......................................................................................................... 2-4 2020 current market rents estimates .................................................................. 5-6 Comparison of estimated average rent levels for flats ........................................ 7 Trend of rents 2020/2019 ..................................................................................... 8 Surface of dwellings .............................................................................................. 9 Neighbourhoods covered ..................................................................................... 10-13 This booklet is distributed to real estate agents that participate in our work. We are grateful for their kind collaboration. © ISRP-OECD 2021 INTRODUCTION The rent data presented in this booklet are part of a wider work programme, the objective of which is to compare the relative cost of living of international civil servants, in any place of employment, with that of Brussels, the reference city. The results of this work, carried out by the International Service for Remunerations and Pensions (ISRP) at the OECD and Eurostat, with the assistance of National Statistical Offices, are used to adjust the salaries of staff in the European Union institutions, the Co-ordinated Organisations¹ and other