NAMEN-Version RP
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Akasvayu Girona
AKASVAYU GIRONA OFFICIAL CLUB NAME: CVETKOVIC BRANKO 1.98 GUARD C.B. Girona SAD Born: March 5, 1984, in Gracanica, Bosnia-Herzegovina FOUNDATION YEAR: 1962 Career Notes: grew up with Spartak Subotica (Serbia) juniors…made his debut with Spartak Subotica during the 2001-02 season…played there till the 2003-04 championship…signed for the 2004-05 season by KK Borac Cacak…signed for the 2005-06 season by FMP Zeleznik… played there also the 2006-07 championship...moved to Spain for the 2007-08 season, signed by Girona CB. Miscellaneous: won the 2006 Adriatic League with FMP Zeleznik...won the 2007 TROPHY CASE: TICKET INFORMATION: Serbian National Cup with FMP Zeleznik...member of the Serbian National Team...played at • FIBA EuroCup: 2007 RESPONSIBLE: Cristina Buxeda the 2007 European Championship. PHONE NUMBER: +34972210100 PRESIDENT: Josep Amat FAX NUMBER: +34972223033 YEAR TEAM G 2PM/A PCT. 3PM/A PCT. FTM/A PCT. REB ST ASS BS PTS AVG VICE-PRESIDENTS: Jordi Juanhuix, Robert Mora 2001/02 Spartak S 2 1/1 100,0 1/7 14,3 1/4 25,0 2 0 1 0 6 3,0 GENERAL MANAGER: Antonio Maceiras MAIN SPONSOR: Akasvayu 2002/03 Spartak S 9 5/8 62,5 2/10 20,0 3/9 33,3 8 0 4 1 19 2,1 MANAGING DIRECTOR: Antonio Maceiras THIRD SPONSOR: Patronat Costa Brava 2003/04 Spartak S 22 6/15 40,0 1/2 50,0 2/2 100 4 2 3 0 17 0,8 TEAM MANAGER: Martí Artiga TECHNICAL SPONSOR: Austral 2004/05 Borac 26 85/143 59,4 41/110 37,3 101/118 85,6 51 57 23 1 394 15,2 FINANCIAL DIRECTOR: Victor Claveria 2005/06 Zeleznik 15 29/56 51,8 13/37 35,1 61/79 77,2 38 32 7 3 158 10,5 MEDIA: 2006/07 Zeleznik -

Jugarenequipo-Partidos De Luka Doncic
www.jugarenequipo.es Hay 178 partidos en el informe Partidos de Luka Dončić 2015 - 28-febrero-1999 2018 Nota: La casilla de verificación seleccionada indica los partidos completos Código colores sombreado duración indica fuente: Elinksbasket Grabación Intercambio Internet+edición Web RTVE Youtube 2014-2015 Liga Endesa 30/04/2015 Liga Regular Jornada 29 Real Madrid Baloncesto 92-77 Unicaja Málaga 2061 K. C. Rivers: 11 pts 2 reb 1 rec. Rudy Fernández: 2 pts 4 reb 2 asi. Andrés Nocioni: 12 pts 4 reb 3 asi. Facundo Campazzo: 3 pts 1 asi. Jonas Maciulis: 5 pts 3 reb 1 asi. Felipe Reyes: 21 pts 4 reb. Sergio "Chacho" Rodríguez: 7 pts 6 asi. Gustavo Ayón: 4 pts 3 reb 2 asi. Luka Doncic: 3 pts. Sergio Llull: 16 pts 1 reb 7 asi 3 fpr. Ioannis Bourousis: 2 pts 1 reb. Marcus Slaughter: 6 pts 1 reb 1 asi. Stefan Markovic: 2 pts 1 reb 3 asi. Kostas Vasileiadis: 5 pts 1 reb 1 asi. Ryan Toolson: 2 pts 1 reb. Will Thomas: 10 pts 4 reb 1 asi. Carlos Suárez: 15 pts 4 reb 1 tap. Kenan Karhodzic: 2'. Jayson Granger: 11 pts 3 reb 6 asi 5 fpr. Fran Vázquez: 2 pts 1 reb. Mindaugas Kuzminskas: 4 pts 2 reb 1 asi. Jon Stefansson: 2 pts 1 reb 3 asi. Caleb Green: 13 pts 7 reb 3 asi. Vladimir Golubovic: 11 pts 11 reb 3 fpr. Excelente --AVC 16:9 1280x720 3623 kb/s Variable AC3 2 canales 192 kb/s Teledeporte 1:56:21 DVD5 2015 Copa Intercontinental 25/09/2015 Final Ida Bauru Basket 91-90 Real Madrid Baloncesto 3003 Patric Viera: DNP. -
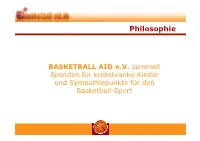
Bbl Koop8-9-2010 Abstimmung
Philosophie BASKETBALL AID e.V. sammelt Spenden für krebskranke Kinder und Sympathiepunkte für den Basketball-Sport Zielgruppen Geldgeber (Spenden) • Freunde des Basketballs • Unternehmen Supporter (Aktive Mithilfe) • Spieler, Trainer, Teams, Eltern und Fans • Liga-Vereine und Freizeit-Basketballer • Mitglieder von BASKETBALL AID Rückblick auf die BASKETBALL AID-Saison 2009/2010 Viele orangefarbene Herzen haben Kindern geholfen Saisonziel 2009/2010 erreicht • Von 20 auf über 200 Vereinsmitglieder gewachsen, darunter prominente Namen wie Patrick Femerling, Pascal Roller, Steffen Hamann, Stephen Arigbabu, Sophie von Saldern, Jan Jagla uvm. • Prominente Firmenmitglieder und Partner: Deutsche Bank, Molten, McFit, Artland Dragons, Deutsche Bank Skyliners, KissFM, MyMuesli • 25 Aktionen an 13 Liga- Standorten • Spendengelder in Höhe von mehr als 35.000 Euro gesammelt BASKETBALL AID Wir sind Basketball. Hamburg: SC Rist Wedel Große Helden helfen kleinen Helden • Spendenaktion von SC Rist Wedel und BASKETBALL AID für die Uniklinik Hamburg Eppendorf • Ergebnis 2.450 Euro ASC Theresianum Mainz Für einen Korb voll Euro • Zweitägige Benefizveranstaltung • Aufmerksamkeit für den Förderverein für tumor- und leukämiekranke Kinder Mainz • Ergebnis: 3.400 Euro Frankfurt: Charityparty 2010 Die Nacht der langen Kerle • Charity Party mit Unterstützung des Managements und der Mannschaft der Deutsche Bank Skyliners • Ergebnis: 3.000 Euro aus Eintrittsgeldern und Tombola Berlin: Charityparty 2009 Mitten in Berlin • Feiern mit Stars von Alba Berlin und dem 1993er -
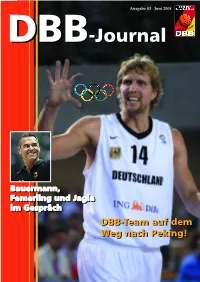
DBB-Journal DBB-Journal
Ausgabe 03 Juni 2008 DBBDBB-Journal-Journal BBaauueerrmmaannnn,, FFeemmeerrlliinngg uunndd JJaaggllaa iimm GGeesspprrääcchh DBB-TeamDBB-Team aufauf demdem WegWeg nachnach Peking!Peking! DBB-Journal 03/08 Liebe Leserinen und Leser, ich begrüße Sie zur 3. Ausgabe des DBB-Journals. Wir freuen uns, Sie heute mit einer geball- mit Perspektive“, das NBBL TOP4, die Diese Worte möchten wir Ihnen nicht vor- ten Ladung an Inhalten erfreuen zu dür- Trainer- und Schiedsrichterseiten (Neue enthalten: fen. Möglich machen es die anstehenden Regeln!!!) oder unsere Rubriken. Wir hof- Es gibt Wege im Basketball, die geht jeder. Es Herren-Länderspiele in Deutschland und fen sehr, dass Ihnen die Mischung gefällt. gib Umwege, die sind nur für Auserwählte. die anschließende Olympia-Qualifikation So ein ein Umweg ist der vdbt mit Gerhard der „Bauermänner“ in Athen. Aus diesem Eine Notiz noch am Rande: besonders Schmidt. Denn über diesen erhielt ich jetzt die Grund halten Sie nicht nur die 3. Ausgabe gefreut hat uns eine Zuschrift des ehema- Nr. 02 des DBB-Journals. Vielen Dank an des DBB-Journals, sondern gleichzeitig ligen Bundestrainers Prof. Günter Hage- beide Wege, und zugleich herzlichen Glück- auch das Hallenheft für die Spiele in Hal- dorn, der sich aus seinem „Exil“ in Korfu wunsch zu diesem faszinierenden Organ. le/Westfalen, Berlin, Bamberg, Hamburg mit gewohnt dichterischen Worten für die Nun, wer in die Sonne (aus)wanderte, wie und Mannheim in der Hand. Zusendung des DBB-Journals bedankte. ich, und andere im Regen (stehen) ließ, darf sich über Umwege nicht wundern. Denn der Natürlich räumen wir den deutschen Regen wäscht Erinnerungen ab! Herren vor diesem wichtigen, Olympi- Herzliche Grüße an alle Heutigen, Jetzigen schen Sommer den größten Platz ein. -

Past Match-Ups & Game Notes
Turkish Airlines EuroLeague PAST MATCH-UPS & GAME NOTES REGULAR SEASON - ROUND 2 Euroleague Basketball Whatsapp Service Do you want to receive this document and other relevant information about Euroleague Basketball directly on your mobile phone via Whatsapp? Click here and follow the instructions. EUROLEAGUE 2020-21 | REGULAR SEASON | ROUND 2 1 Oct 08, 2020 CET: 18:00 LOCAL TIME: 20:00 | MEGASPORT ARENA CSKA MOSCOW MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV 41 KURBANOV, NIKITA 50 ZOOSMAN, YOVEL Forward | 2.02 | Born: 1986 Guard | 2.00 | Born: 1998 33 MILUTINOV, NIKOLA 24 ALBER, EIDAN Center | 2.13 | Born: 1994 Guard | 1.94 | Born: 2000 28 LOPATIN, ANDREI 23 ZIZIC, ANTE Forward | 2.08 | Born: 1998 Center | 2.10 | Born: 1997 23 SHENGELIA, TORNIKE 18 SAHAR, DORI Forward | 2.06 | Born: 1991 Forward | 1.95 | Born: 2001 @TokoShengelia23 21 CLYBURN, WILL 11 DORSEY, TYLER Forward | 2.01 | Born: 1990 Guard | 1.96 | Born: 1996 17 VOIGTMANN, JOHANNES 6 COHEN, SANDY Forward | 2.11 | Born: 1992 Guard | 1.98 | Born: 1995 13 STRELNIEKS, JANIS 5 HUNTER, OTHELLO Guard | 1.91 | Born: 1989 Center | 2.03 | Born: 1986 11 ANTONOV, SEMEN 4 CALOIARO, ANGELO Forward | 2.02 | Born: 1989 Forward | 2.03 | Born: 1989 10 HACKETT, DANIEL 3 JONES, CHRIS Guard | 1.93 | Born: 1987 Guard | 1.88 | Born: 1993 7 UKHOV, IVAN 1 WILBEKIN, SCOTTIE Guard | 1.93 | Born: 1995 Guard | 1.88 | Born: 1993 6 HILLIARD, DARRUN 0 BRYANT, ELIJAH Guard | 1.98 | Born: 1993 Guard | 1.96 | Born: 1995 5 JAMES, MIKE 14 BLAYZER, OZ Guard | 1.85 | Born: 1990 Forward | 2.00 | Born: 1992 @TheNatural_05 4 KHOMENKO, -

Nº 68 Sept. / Oct. 2016 Editorial
Nº 68 SEPT. / OCT. 2016 EDITORIAL Todos tenemos algún deporte que nos apasiona, o Y porque queremos que vivas tu emoción al máximo, algún equipo o deportista al que seguimos y que nos queremos multiplicar los canales para que puedas hace sentir una gran emoción cada vez que los vemos hacerlo desde casa junto a tu familia, desde el estadio competir. Existe además otro tipo de emoción ligada junto a tus amigos, desde el autobús de camino a al deporte, la que se puede sentir cuando apostamos casa, o mejor aún, con tus amigos y tu familia desde nuestro dinero de forma sana y responsable a algún nuestras tiendas. resultado o pronóstico que creemos puede ocurrir. Y queremos ofrecer la oferta más variada del mercado Desde Sportium queremos promover la forma de para que puedas multiplicar las opciones de apuesta. apostar responsable y sana. Pero queremos que Y queremos ofrecer los mejores precios para que estas vayan ligadas a un nuevo concepto, porque si puedas multiplicar tus ganancias. Pero sobre agregaras la pasión que sientes como seguidor a la todo, queremos que multipliques tu experiencia. pasión que sientes apostando, el resultado no sería Queremos que practiques Sportium. una simple suma, sería una emoción totalmente multiplicada, algo que no tendría nombre. O si, para nosotros sería practicar Sportium. PUNTOS DE VENTA SPORTIUM Busca tu local más cercano en www.sportiumnews.com AGENDA SEPTIEMBRE | OCTUBRE FÚTBOL 06-08 Copa del Rey. Segunda ronda eliminatoria. 13-14 Liga de Campeones. Inicio Fase de grupos. TENIS 15 Europa League. Inicio Fase de grupos. 16-18 Copa Davis. -

Any De Desafiaments En Clau Blaugrana
FUTBOL BARÇA BÀSQUET EUROLLIGA FUTBOL PREMIER El Barça debuta El City, rival del Any de desafiaments en el Top 16 a la Barça en la en clau blaugrana pista del líder de Champions, El 2015 és vital per al Barça recuperar el la lliga alemanya atrapa el Chelsea rumb en l’àmbit esportiu i en l’institucional (Esport 3 / 20 h) de Mourinho 0,5 ‘Gaspartisme’ 2.0 EUROS XAVI TORRES OPINIÓ El gran Lebowski RAMON SALMURRI Debats i biaixos TONI ROMERO ANY 14. NÚM. 4696 ANY 14. · www.lesportiudecatalunya.cat · @lesportiucat www.lesportiudecatalunya.cat DIVENDRES, 2 DE GENER DEL 2015 · DIVENDRES, ALBERT SALAMÉ 2·OPINIÓ L’ESPORTIU. DIVENDRES, 2 DE GENER DEL 2015 AVUI FA... Jordi Camps DIARI DE REDACCIÓ Lluís Simon El bé comú, el mal particular Molta gent es queixa que Mas i Junqueras no es posin d’acord pel bé del país, però proveu de posar junts en una habitació Bartomeu i Laporta pel bé del Barça... PUJA Miguel Indurain es retira 1997 CICLISME. El cinc cops guanyador del Tour Miguel Indurain va posar fi a tres mesos de dubtes i d’especulacions, des de la seva retirada en la Vuelta a Espanya, i va anunciar la seva retira- da del ciclisme. El corredor navarrès va fer l’anunci en una roda de premsa multitudinària a Pamplona en la qual va llegir un breu comunicat en què deia que la decisió de plegar havia estat “llarga i pro- fundament meditada”. Indurain es retirava amb cinc Tours (1991-1995), dos Giros (1992 i 1993), un mundial de contrarellotge (1995), una medalla d’or olímpica en contrarellotge (1996) i tres Voltes a Catalunya, entre altres victòries. -
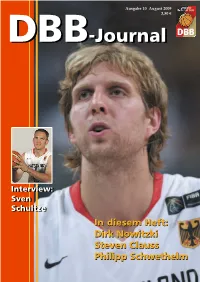
DBB-Journal DBB-Journal
Ausgabe 10 August 2009 3,50 € DBBDBB-Journal-Journal Interview:Interview: SvenSven SchultzeSchultze InIn diesemdiesem Heft:Heft: DirkDirk NowitzkiNowitzki StevenSteven ClaussClauss PhilippPhilipp SchwethelmSchwethelm Editorial Liebe Leserinnen und Leser des DBB-Journals, Alle Jahre wieder … ist unser Sommer prall gefüllt mit Basketball! Die Ligen machen Pause, aber alle Nationalmannschaften - und das sind immerhin neun an der Zahl – absolvieren ihre Sommer- Pro gramme. Sieben Europameisterschaften standen und stehen auf dem Programm, dazu eine Universiade. Nur die Damen ab - sol vierten ihr Programm in diesem Sommer ohne Endmaß - nahme. Ebenso prall ge füllt wie der Sommer mit Bas ket ball ist dieses Heft mit Lesestoff! Und zwar wie schon im vergangenen Sommer mit vielen Extraseiten über die Herren-National - mannschaft, deren Kader und Gegner wir ausführlich vorstellen. Dirk Nowitzki, Steven Clauss, Sven Schultze, Philipp Schwethelm, Toni Rodriguez und Jens Kujawa heißen die Personen, die in die- sem Heft eine größere Rolle spielen, sei es durch Interviews oder durch Sto ries. Wir blicken zurück auf die Titel kämpfe der U20- Ansporn für uns, Ihnen dort immer interessante Themen und und U18-National mann schaf ten, auf die Uni ver si ade und auf Personen vorstellen zu können. Machen Sie uns weiterhin bes- den ersten Teil des Damenpro gramms. Und ganz weit zurück auf ser, indem Sie Ihre Meinung kundtun! den sensationellen 4. WM-Platz der DBB-Junio ren im Jahr 1987. Im Vorfeld der U17-WM 2010 in Hamburg hat die ING-DiBa der Einen schönen aktuellen U16-National mannschaft mit dem ING-DiBa Junior- (Rest)-Sommer Cup in Bamberg gleich ein ganzes Vorberei tungs turnier er mög - wünscht licht. -

Nº 1013 ACB Noticias Digital
Nº 1013 AÑO XXVIII - 29 Mayo 2017 Departamento de Comunicación TEMPORADA I N D I C E 2016-2017 JORNADAS Cuadro de Playoff'17 2 Resultados y Clasificación Playoff'17 3 1/4 Estadísticas Individuales 4 Final Fichas Cuartos de Final (1er Partido) 5-6 Fichas Cuartos de Final (2º Partido) 7-8 Fichas Cuartos de Final (3er Partido) 9-10 Estadísticas Acumuladas 11-14 Próximas Jornadas 15 Patrocinador principal 1 PLAYOFF'17 (1) Real Madrid Real Madrid (8) MoraBanc Andorra Semifinal 1 (4) Unicaja Unicaja (5) Iberostar Tenerife CAMPEÓN (2) Baskonia ACB 2016-2017 Baskonia (7) Herbalife G Canaria Semifinal 2 (3) Valencia Basket Club Valencia Basket Club (6) FC Barcelona Lassa 2 ACB 2016/2017 - Resultados y Clasificación RESULTADOS PLAYOFF Cuartos de Final 1er Partido REAL MADRID - MORABANC ANDORRA (107- 76) (1-0) BASKONIA - HERBALIFE GRAN CANARIA (71 - 59) (1-0) VALENCIA BASKET CLUB - FC BARCELONA LASSA (83 - 61) (1-0) UNICAJA - IBEROSTAR TENERIFE (79 - 65) (1-0) 2º Partido MORABANC ANDORRA - REAL MADRID (89 - 77) (1-1) HERBALIFE GRAN CANARIA - BASKONIA (94 - 79) (1-1) FC BARCELONA LASSA - VALENCIA BASKET CLUB (91 - 79) (1-1) IBEROSTAR TENERIFE - UNICAJA (73 - 67) (1-1) 3er Partido REAL MADRID - MORABANC ANDORRA (95 - 84) (2-1) BASKONIA - HERBALIFE GRAN CANARIA (73 - 71) (2-1) MEMORIA DE ALTAS Y BAJAS VALENCIA BASKET CLUB - FC BARCELONA LASSA (67 - 64) (2-1) UNICAJA - IBEROSTAR TENERIFE (71 - 61) (2-1) - Con fecha 19/05/17 Baskonia sustituye a Chase Budinger por Ricky Ledo - Con fecha 19/05/17 Unicaja sustituye a Adam Waczynski Emparejamientos Semifinales -

Doblecitaambleslliguesnacional
MUNDO DEPORTIVO DIVENDRES 19 DE SETEMBRE DE 2008 bàsquet CAT 05 Doble cita amb les Lligues Nacionals Catalanes La final a quatre de la Lliga Catalana ACB i de la Lliga Femenina 2, aquest cap de setmana PLANTILLES FINAL A QUATRE ACB DKV JOVENTUT Bases: Demond Mallet (00), Josep Franch (10) Escortes: Bracey Wright (6), Pau Ribas (4), Ferran Laviña (18), David Jelinek (12) Alers: Simas Jasaitis (13), Christian Eyenga (15), Pere Tomàs (19) Ala-pivots: Jan Jagla (14) Pivots: Eduardo Hernández Sonseca (16), Henk Norel (17) Entrenador: Sito Alonso Lesionat: Ricky Rubio (dubte) Preeuropeu: Luka Bogdanovic (Sèrbia) i Pops Mensah-Bonsu (Anglaterra) PLUS PUJOL LLEIDA Bases: Javier Mendiburu (5), Quino Colom (17), Gavrilo Markovic (-), Oriol Jorge (-) Escortes: Troy Anthony DeVries (4), Alberto Miguel (8), 'Juampi' Sutina (-) Alers: Salva Arco (14), Ala-pivots: Roger Fornas (9), Dimitry Flis (11), Marcus V. Toledo (13), Pol Domingo (-) Pivots: Gimel Josep Lewis (15), Rafael Hettsheimeier (7) Entrenador: Edu Torres FC BARCELONA Bases: Andre Barret (6), Víctor Sada (24), Jaka Lakovic (10) Escortes: Juan Carlos Navarro (11), Gianluca Basile (5), Roger Grimau (44) La plantilla del DKV Joventut, celebrant el títol que va conquerir a la Lliga Catalana ACB la passada temporada FOTO: FCBQ Alers: Lubos Barton (9) Ala-Pivots: Jordi Trias (8), Fran Vázquez (17) Pivots: David Andersen (13), Xavi Rey (14) Barcelona Carlos García nal Catalana de Lliga Femenina 2 nal de la temporada passada, en les darreres dues edicions de la Entrenador: Xavi Pascual aquest proper diumenge, 21 de set- què el Femení Sant Adrià es va Lliga Nacional Catalana de LF 2, Preeuropeu: Ersan Ilyasova (Turquía), Nenad n Amb el Plus Pujol Lleida com a embre, al Pavelló Marina Besòs de erigir en vencedor (60-68, al Pave- ja que al 2006 va batre el Nexus CB Djedovic (Bosnia) primer campió de les Lligues Na- Sant Adrià de Besòs a partir de les lló Fontajau de Girona). -
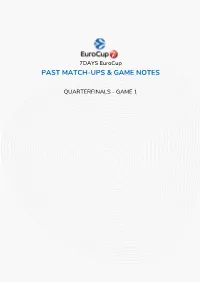
Past Match-Ups & Game Notes
7DAYS EuroCup PAST MATCH-UPS & GAME NOTES QUARTERFINALS - GAME 1 EUROCUP 2018-19 | QUARTERFINALS | GAME 1 1 Mar 05, 2019 CET: 19:00 LOCAL TIME: 19:00 | MAX SCHMELING HALLE ALBA BERLIN UNICAJA MALAGA 11 BRENNEKE, LORENZ 14 TAMBA, ISMAEL Forward | 2.05 | Born: 2000 Forward | 1.98 | Born: 2001 41 DRESCHER, HENDRIK 7 STILMA, MORGAN Center | 2.06 | Born: 2000 Forward | 2.02 | Born: 2000 16 NIKIC, KRESIMIR 33 WILTJER, KYLE Center | 2.15 | Born: 1999 Center | 2.08 | Born: 1992 33 CLIFFORD, DENNIS 9 DIAZ, ALBERTO Center | 2.13 | Born: 1992 Guard | 1.88 | Born: 1994 @Dcliff_eats @albertodiaz94 31 GIEDRAITIS, ROKAS 11 DIEZ, DANIEL Forward | 2.00 | Born: 1992 Forward | 2.01 | Born: 1993 @danidiez11 5 GIFFEY, NIELS 3 FERNANDEZ, JAIME Forward | 2.00 | Born: 1991 Guard | 1.86 | Born: 1993 15 HERMANNSSON, MARTIN 26 LESSORT, MATHIAS Guard | 1.90 | Born: 1994 Center | 2.06 | Born: 1995 @hermannsson15 6 HUNDT, BENNET 12 MILOSAVLJEVIC, DRAGAN Guard | 1.78 | Born: 1998 Forward | 1.98 | Born: 1989 9 MATTISSECK, JONAS 2 OKOUO, VINY Guard | 1.95 | Born: 2000 Center | 2.14 | Born: 1997 25 OGBE, KENNETH 22 ROBERTS, BRIAN Guard | 1.98 | Born: 1994 Guard | 1.85 | Born: 1985 44 PENO, STEFAN 10 SALIN, SASU Guard | 1.94 | Born: 1997 Guard | 1.91 | Born: 1991 @StefanPeno 1 SAIBOU, JOSHIKO 17 SHERMADINI, GIORGI Guard | 1.88 | Born: 1990 Center | 2.17 | Born: 1989 @joshisaibou 10 SCHNEIDER, TIM 43 SUAREZ, CARLOS Forward | 2.08 | Born: 1997 Forward | 2.03 | Born: 1986 43 SIKMA, LUKE 21 WACZYNSKI, ADAM Forward | 2.03 | Born: 1989 Forward | 1.99 | Born: 1989 @LCSikma43 -

Past Match-Ups & Game Notes
Turkish Airlines EuroLeague PAST MATCH-UPS & GAME NOTES REGULAR SEASON - ROUND 28 EUROLEAGUE 2019-20 | REGULAR SEASON | ROUND 28 1 Mar 06, 2020 CET: 21:00 LOCAL TIME: 21:00 | BUESA ARENA KIROLBET BASKONIA VITORIA-GASTEIZ ALBA BERLIN 50 ERIC, MICHAEL 44 PENO, STEFAN Center | 2.10 | Born: 1988 Guard | 1.93 | Born: 1997 @StefanPeno 33 POLONARA, ACHILLE 43 SIKMA, LUKE Center | 2.02 | Born: 1991 Forward | 2.03 | Born: 1989 @LCSikma43 31 SHIELDS, SHAVON 34 CAVANAUGH, TYLER Forward | 2.01 | Born: 1994 Forward | 2.06 | Born: 1994 23 SHENGELIA, TORNIKE 32 THIEMANN, JOHANNES Center | 2.06 | Born: 1991 Center | 2.05 | Born: 1994 @TokoShengelia23 19 FALL, YOUSSOUPHA 31 GIEDRAITIS, ROKAS Center | 2.21 | Born: 1995 Forward | 2.00 | Born: 1992 15 GRANGER, JAYSON 25 OGBE, KENNETH Guard | 1.89 | Born: 1989 Guard | 1.98 | Born: 1994 @jaygranger11 12 DIOP, ILIMANE 16 NIKIC, KRESIMIR Center | 2.11 | Born: 1995 Center | 2.13 | Born: 1999 @eliimane 11 JANNING, MATT 15 HERMANNSSON, MARTIN Guard | 1.93 | Born: 1988 Guard | 1.90 | Born: 1994 @mjanning23 @hermannsson15 7 HENRY, PIERRIA 11 BRENNEKE, LORENZ Guard | 1.93 | Born: 1993 Forward | 2.04 | Born: 2000 3 VILDOZA, LUCA 10 SCHNEIDER, TIM Guard | 1.91 | Born: 1995 Forward | 2.08 | Born: 1997 5 GONZALEZ, MIGUEL 9 MATTISSECK, JONAS Guard | 2.01 | Born: 1999 Guard | 1.94 | Born: 2000 1 PENAVA, AJDIN 8 ERIKSSON, MARCUS Center | 2.06 | Born: 1997 Guard | 2.01 | Born: 1993 17 GARCIA, SERGI 6 DELOW, MALTE Forward | 1.93 | Born: 1997 Guard | 1.94 | Born: 2001 6 CHRISTON, SEMAJ 5 GIFFEY, NIELS Guard | 1.91 | Born: 1992