Maurice Utrillo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lapin Agile in Winter
ART AND IMAGES IN PSYCHIATRY SECTION EDITOR: JAMES C. HARRIS, MD Lapin Agile in Winter Ah, Montmartre, with its provincial corners and its bohemian ways...Iwould be so at ease near you, sitting in my room, composing a motif of white houses or all other things. Utrillo to César Gay from the Villejuif asylum, 19161(p6) AURICE UTRILLO (1883-1955) WAS BORN ON instruction, and he began to demonstrate real talent. Relieved, December 26 in the Montmartre quarter of and considering him cured, his mother took him back to Mont- Paris, France. He began to paint as occupa- martre, thinking that she could return to her own work as an art- tional therapy under the tutelage of his mother ist. Soon Maurice was drinking again and getting into fights, of- to divert him from alcoholism.2 Reluctant at ten returning home beaten and bruised. Mfirst, he gradually began to paint what he saw around him. His As his talent was recognized, rather than serve as a distraction cityscapes (city streets, favorite parts of Montmartre, and churches) from alcohol, his paintings were often exchanged for drinks. Each delighted the man in the street and intrigued the connoisseur. day he would vow to remain sober, yet by day’s end, he would be Although he was surrounded by the founders of modern ab- overcome by a craving for alcohol. He would drink alone and be- stract art, he recreated the city around him by realistically pre- come agitated and threatening. His mother continually rescued senting simplified images of familiar scenes. His work has a cer- him after his bouts of drinking and brought him home, seeking tain calmness and a nostalgic vitality about it, suggesting that there hospital admission as a last resort. -
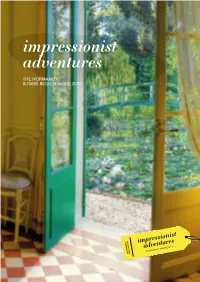
Impressionist Adventures
impressionist adventures THE NORMANDY & PARIS REGION GUIDE 2020 IMPRESSIONIST ADVENTURES, INSPIRING MOMENTS! elcome to Normandy and Paris Region! It is in these regions and nowhere else that you can admire marvellous Impressionist paintings W while also enjoying the instantaneous emotions that inspired their artists. It was here that the art movement that revolutionised the history of art came into being and blossomed. Enamoured of nature and the advances in modern life, the Impressionists set up their easels in forests and gardens along the rivers Seine and Oise, on the Norman coasts, and in the heart of Paris’s districts where modernity was at its height. These settings and landscapes, which for the most part remain unspoilt, still bear the stamp of the greatest Impressionist artists, their precursors and their heirs: Daubigny, Boudin, Monet, Renoir, Degas, Morisot, Pissarro, Caillebotte, Sisley, Van Gogh, Luce and many others. Today these regions invite you on a series of Impressionist journeys on which to experience many joyous moments. Admire the changing sky and light as you gaze out to sea and recharge your batteries in the cool of a garden. Relive the artistic excitement of Paris and Montmartre and the authenticity of the period’s bohemian culture. Enjoy a certain Impressionist joie de vivre in company: a “déjeuner sur l’herbe” with family, or a glass of wine with friends on the banks of the Oise or at an open-air café on the Seine. Be moved by the beauty of the paintings that fill the museums and enter the private lives of the artists, exploring their gardens and homes-cum-studios. -
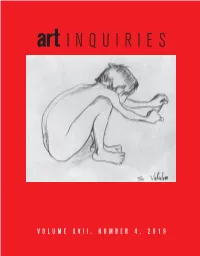
Art I N Q U I R I E S • Vol
art I N Q U I R I E S art art • Volume X VII • Number 4, 2019 art VOLUME XVII, NUMBER 4, 2019 www.secacart.org secacart inquires_xviii_cover_2019.indd 1 12/12/19 9:29 AM Wicked, Hard and Supple An Examination of Suzanne Valadon’s Nude Drawings of Young Maurice Courtney Hunt he artist Suzanne Valadon’s Lautrec and Auguste Renoir. As an of her subjects came from her singular position was the artist’s model, Valadon was able neighborhood of Montmartre, but result of many intersecting to observe the bohemian art scene one model occupied a closeness to circumstances in her life that on the Butte and then to use this the artist that the others did not— allowed her the freedom unique perspective for her own her own son. Tand ability, rare among women artwork, supplementing it with the In this article, I will address the artists, to depict not just the female encouragement and assistance of nude drawings of Maurice Utrillo, nude, but also the male. Born in those who painted her.1 Valadon depicted by his mother from the French countryside in 1865, began as an artist by making late childhood until adolescence. Valadon moved to Paris with her drawings, a practice that is evident in Portraits of Maurice, who was the mother Madeleine when she was the signature bold line present even sole male model in Valadon’s body just a child. In Montmartre, Valadon in her later paintings. Her drawings of work representing children, are became an acrobat and then a model in the 1890s include pictures of intrinsically complicated, and are for such artists as Henri Toulouse- children, often in the nude. -
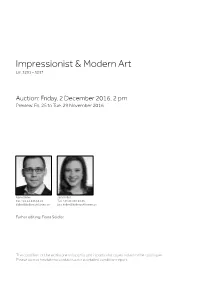
Impressionist & Modern
Impressionist & Modern Art Lot 3201 – 3237 Auction: Friday, 2 December 2016, 2 pm Preview: Fri. 25 to Tue. 29 November 2016 Fabio Sidler Jara Koller Tel. +41 44 445 63 41 Tel. +41 44 445 63 45 [email protected] [email protected] Furher editing: Fiona Seidler The condition of the works are only partly and in particular cases noted in the catalogue. Please do not hesitate to contact us for a detailed condition report. Impressionist & Modern Art 3201* AUGUST BABBERGER (Hausen in Wiesental 1885 - 1936 Altdorf) Landscape view of Lake Lucerne and Pilatus. 1915. Oil on hardboard. Signed and datet lower left: Babberger 1915. 66.5 x 82.5 cm. The authenticity of the work has been confirmed by Andreas Gabelmann, Sep- After his studies in Florence, Babberger tings were seized from German museums tember 2016. began to become more and more involved and later shown at the “Entartete Kunst” in landscape. Through his wife who was exhibition. Provenance: from Lucerne, he familiarised himself with - Private collection, Switzerland. the Swiss landscape around Lake Lucerne, The present work is a typical example of - Private collection, San Francisco. which became his second home, with its Babberger’s art circa 1915/16. As subject - Private collection, New York. surrounding body of mountains providing he has chosen his preferred landscape inspiration and fascination. From 1915 the of Lake Lucerne and the Pilatus. Styli- In 1895 the Babbergers came from summit of the Pilatus caught his interest stically, Hodler’s influence is strongly in Germany to Basel, Switzerland, where and in subsequent years it became the evidence. -

Impressionism & Modern
Impressionism & Modern Art Lot 3201 – 3279 Auction: Friday, 29 June 2018, 4pm Preview: Sat. 16 June, 11.30am to 7pm Sun. 17 to Sun. 24 June 2018, 10am to 7pm Editing: Fabio Sidler Jara Koller Tel. +41 44 445 63 41 Tel. +41 44 445 63 45 [email protected] [email protected] The condition of the works are only partly and in particular cases noted in the catalogue. Please do not hesitate to contact us for a detailed condition report. Impressionist & Modern Art 3201 MAX LIEBERMANN (1847 Berlin 1935) Allee mit Frauenfigur und Kind (Avenue with female figure and child). 1896. Oil on panel. Signed lower right: M. Liebermann. 37 x 27 cm. Provenance: Liebermann depicts a typical scene for the - Galerie Thannhauser, Munich (1923). artist - a mother and child leisurely strolling - Weinmüller, Munich, auction 1-2 June in a landscape - which he so well mastered. 1949, no. 704 (with ill.). The light and carefree mood are wonder- - Christies London, auction 27 June 1989, fully captured in the artist's impressionistic no. 714 (with ill.). style. Both the arrangement of the rows of - Kunstsalon Franke, Baden-Baden (1990). trees and the proportions of the figures to - Private collection, Switzerland, bought the trees are reminiscent of two paintings from the above gallery. that Liebermann painted during his time in Laren, thus allowing the assumption that Exhibitions: this painting was created in Laren in 1996. - Munich 1923, Max Liebermann, Galerie The subject of the tree-lined road was a Thannhauser, no. 15 (with ill.). particular favourite of Liebermann and - Baden-Baden 1990, Max Liebermann/ features prominently throughout his work. -

OTSUKA MUSEUM of ART Exhibition List of Works
OTSUKA MUSEUM OF ART exhibition list of works No. Painter Title Place Country 0001 Michelangelo Buonarroti Dividing the Light from the Darkness Cappella Sistina Vatican 0001 Michelangelo Buonarroti Creation of the Sun and the Moon Cappella Sistina Vatican 0001 Michelangelo Buonarroti Parting the Waters Cappella Sistina Vatican 0001 Michelangelo Buonarroti Creation of Adam Cappella Sistina Vatican 0001 Michelangelo Buonarroti Creation of Eve Cappella Sistina Vatican 0001 Michelangelo Buonarroti Original Sin and Banishment from Eden Cappella Sistina Vatican 0001 Michelangelo Buonarroti Sacrifice of Noah Cappella Sistina Vatican 0001 Michelangelo Buonarroti Deluge Cappella Sistina Vatican 0001 Michelangelo Buonarroti Naoh's Drunkenness Cappella Sistina Vatican 0001 Michelangelo Buonarroti Last Judgement Cappella Sistina Vatican 0002 El Greco (Domenikos Theotokopoulos) Trinity Museo del Prado Spain 0003 El Greco (Domenikos Theotokopoulos) St.Andrew and St.Francis Museo del Prado Spain 0004 El Greco (Domenikos Theotokopoulos) Martydom of St.Maurice Museo El Escorial Spain 0005 El Greco (Domenikos Theotokopoulos) Burial of Count Orgas Santo Tomé Spain 0006 El Greco (Domenikos Theotokopoulos) Annunciation Museo del Prado Spain 0006 El Greco (Domenikos Theotokopoulos) Baptism of Christ Museo del Prado Spain 0006 El Greco (Domenikos Theotokopoulos) Crucifixion Museo del Prado Spain 0006 El Greco (Domenikos Theotokopoulos) Resurrection Museo del Prado Spain 0006 El Greco (Domenikos Theotokopoulos) Pentecost Museo del Prado Spain 0006 El Greco (Domenikos -

Impressionist & Modern
IMPRESSIONIST & MODERN ART Thursday 2 March 2017 IMPRESSIONIST & MODERN ART Thursday 2 March 2017 at 5pm New Bond Street, London VIEWING ENQUIRIES Cologne PHYSICAL CONDITION OF Saturday 25 February, 11am to 4pm India Phillips Katharina Schmid LOTS IN THIS AUCTION Sunday 26 February, 11am to 4pm Head of Department +49 221 2779 9650 Monday 27 February, 9am to 5pm +44 (0) 20 7468 8328 [email protected] PLEASE NOTE THAT THERE IS Tuesday 28 February, 9am to 5pm [email protected] NO REFERENCE IN THIS Wednesday 1 March, 9am to 5pm Geneva CATALOGUE TO THE PHYSICAL Thursday 2 March, 9am to 2pm Hannah Foster Victoria Rey-de Rudder CONDITION OF ANY LOT. Senior Specialist +41 22 300 3160 INTENDING BIDDERS MUST SALE NUMBER +44 (0) 20 7468 5814 [email protected] SATISFY THEMSELVES AS TO 23932 [email protected] THE CONDITION OF ANY LOT Hong Kong AS SPECIFIED IN CLAUSE 14 CATALOGUE Ruth Woodbridge Edward Wilkinson OF THE NOTICE TO BIDDERS £22.00 Specialist +1 323 436 5430 CONTAINED AT THE END OF +44 (0) 20 7468 5816 [email protected] THIS CATALOGUE. ILLUSTRATIONS [email protected] Front cover: Lot 17 Los Angeles As a courtesy to intending Inside front cover (left): Lot 32 Thérence de Matharel Alexis Chompaisal bidders, Bonhams will provide a Inside front cover (right): Lot 18 Specialist + 1 323 436 5469 written Indication of the physical Inside back cover: Lot 31 +44 (0) 20 7468 8263 [email protected] condition of lots in this sale if a Back cover: Lot 19 [email protected] request is received up to 24 Kathy Wong hours before the auction starts. -

Representations of the Dancer in the Works of Théophile Gautier
The Eroticised Body and the Transcendent Word: Representations of the Dancer in the Works of Theophile Gautier, Arthur Symons and W.B. Yeats A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the University of Canterbury by Maureen Elizabeth Coulter University of Canterbury 2004 ,c ii Contents Aclrnowledgements iii List of Illustrations v List of Abbreviations vii Abstract xii Preface xiv Introduction 1 Chapter 1 Theophile Gautier: The Art of the Dancer, the Dancer as Art 14 Chapter 2 Theophile Gautier: The Flight to Transcendence 62 Chapter 3 Arthur Symons and the Eroticised Dancer 115 Chapter 4 The Dancer as Image in the Works ofW.B. Yeats 175 Chapter 5 The Dancer and the Dance: The Whirling of the Gyre 233 Conclusion 285 Bibliography 293 7 iii Acknowledgements I should like to thank my supervisors, Dr Rob lackaman and Professor David Gunby. In the years I have been working on this thesis, they have both been wholly supportive and encouraging, always willing to act as sounding-boards for my ideas and to help clarify confusion when it arose. Both have spurred me on at the times when my energy and confidence flagged. I especially thank Professor Gunby for his sound practical advic~, and Dr lackaman for the enthusiasm he has always shown for my topic, and for his whimsical sense of humour. I should also like to thank Pierre Daprini for acting as an advisory supervisor, and for responding to my topic with such verve. I also thank Dr Gordon Spence for his contribution as a supervisor when Dr lackaman was on leave. -

Highlights from the Masterpiece Art Collection 1 October – 1 November 2019
Front cover: ITALIAN SCHOOL (Possibly Rome, XVII Century), The Great Flood Highlights from the Masterpiece Art Collection 1 October – 1 November 2019 +44 (0)20 3946 7881 www.masterpieceart.co.uk [email protected] © Masterpiece Art Limited, a company registered in England & Wales at 3 Norland Place, Holland Park W11 4QG Company Registration Number 09555198 TABLE OF CONTENTS 1 ABOUT MASTERPIECE ART 3 OLD MASTER PAINTING 17 OBJET DE VERTU 27 BRITISH & IRISH SCHOOLS 37 EUROPEAN SCHOOLS 51 MODERN & POST-WAR ART 59 CONTEMPORARY ART 67 OUR TEAM Masterpiece Art is an exclusive gallery and fine art advisory firm based in Holland Park, West London. The cultural focal point of a group of independent but closely connected business services companies - the Ameera Group, a London based corporate services and wealth preservation business and Patron Law, a law firm focusing on Business, Pri- vate Client, Real Estate and Dispute Resolution – Masterpiece Art caters to both new and established collectors. The collection includes notable artworks from a range of golden ages of art history, incorporating Old Master, Nine- teenth Century, Modern, Post-War and Contemporary art.. Our clients benefit from the wealth of art experience within the gallery and the wider network of businesses. As investors ourselves, we understand the need to diversify a portfolio and, as with other asset classes, we are inherently tuned to your sensitivity to risk, offering unbiased advice on how best to navigate this complex market. Whether you are taking your first steps into collecting, sup- plementing an existing collection, or looking to understand the value of an artwork in your possession, we can help. -

Vision of Vincent Van Gogh and Maurice Utrillo
http://www.ierek.com/press ARChive Online ISSN: 2537-0162 International Journal on: The Academic Research Community Publication The International Conference : Cities’ Identity Through Architecture and Arts (CITAA) Vision of Vincent van Gogh and Maurice Utrillo in Landscape Paintings and their Impact in Establishing the Identity of the Place DOI: 10.21625/archive.v1i1.133 Hala Ibrahim Mohamed Elsaed 1 1Painting Department -Faculty of Fine Arts Keywords Abstract Painting There are varieties of visions, visual solutions and plastic relations for various Landscape painting topics, but the landscape painting is still the closest subject to the identity of Van Gogh the place. Maurice Utrillo When the artist translates the realistic features of the place describing it with his special style and touches, this represents a record for characteristics of a certain period related to this place. It might also depict the landscape by his sense, telling us with his painting brush the story of its heritage. The artist links it with the reality experienced -here the memory adds the highest value to the view and translates features of nature of this place in terms of form- or feelings and influence through the ages. When Van Gogh was influenced by a city, like Arles in France, he produced the most beautiful of his paintings, which appeared to show his style and colors. Actually, we see this city through a creative artist with radiant colors, each panting as a celebration or a poem singing the beauty of this place. And when Maurice Utrillo was influenced by a city -like Paris in France especially Montmartre district with its steep winding streets, picturesque windmills, snowfall, and clouds of gray affected- he created his most important paintings of landscape. -

Grunddaten Inventar-Nr. Obj.-ID WV G 81.024 1
Provenienzbericht Stand:10/26/2020 Provenienzbericht Paul Cezanne, Pommes, orange et citron, um 1885 Abb.1: Abb.2: Grunddaten Inventar-Nr. G 81.024 Obj.-ID 11911 WV Felichenfeldt et al. 2019, FWN 800-TA; Rewald et al. 1996, Nr. 564; Venturi 1936, Nr. 204. Künstler/-in Paul Cezanne Quelle: Felichenfeldt et al. 2019. (Venturi 1936; Rewald et al. 1996) weitere Beteiligte Quelle: Titel Pommes, orange et citron Quelle: Felichenfeldt et al. 2019. alternativer Titel Datierung um 1885 Quelle: Feilchenfeldt et al. 2019 (Rewald 1996) Technik Öl auf Leinwand Bildträger 1 Provenienzbericht Stand:10/26/2020 Bildmass 23 x 33 cm Rahmenmass 44 x 53.7 x 10.5 cm Signatur/Inschrift Beschriftung Rahmen Beschriftung Originalrahmen Beschriftung Montierung Zugehörige Teile Zustand Credit Line Kunstmuseum Bern, Legat Georges F. Keller 1981 2 Provenienzbericht Stand:10/26/2020 Provenienz 1886 – o.D. Paul Cézanne (*19.01.1839, Aix-en-Provence, † 22.10.1906, Aix-en- Provence)[Künstler][1, 2, 3, 4, 5] o.D. Fritz Meyer-Fierz (* 09.10.1947, Lichtensteig, † 11.12.1917, Zürich)[Kunstsammler][1] o.D. Ambroise Vollard (*03.07.1866, Saint-Denis de La Réunion, † 22.07.1939, Versailles)[Kunsthändler] Stock Nr. 3135 [1, 2] o.D. – spätestens 1936 Galerie Bignou, Paris/New York [Kunsthandel][1, 2, 3] o.D. – spät 1960 Georges F. Keller (*16.08.1899, Paris, † 06.04.1981, Davos)[Kunsthändler][1, 2, 5] o.D.– 1981 Serena-Stiftung, Vaduz [Überführung in Stiftungsbesitz][5] seit 1981 Kunstmuseum Bern [Schenkung][5, 6] Quellennachweis [1] Feilchenfeldt et al. 2019, FWN 800-TA; Rewald et al. 1996, Nr. -

A Visit to Paris with Paul Davenport in the Footsteps of the Impressionists
A Visit to Paris with Paul Davenport In the Footsteps of the Impressionists August 5 – 15, 2019 We spend nine nights in Paris, August 5 to 15, 2019, visiting Impressionist sites in Paris and the suburbs, and exploring other attractions in this extraordinary city. Dr. Paul Davenport was President of Western University from 1994 to 2009. In 2004 he began teaching courses in Continuing Studies at Western and at the University of Toronto entitled In the Footsteps of the Impressionists. Since 2007 he has led student and alumni bike tours in France, in Touraine, the Loire Valley, Provence, and Dordogne. He also leads walking tours of Paris; this will be the fifth. He lives in Tours, France, with his wife Josette. Guests may want to purchase one of the standard guides to Paris, available in bookstores or on amazon.ca and amazon.com. My favorite is Rick Steves’ Paris, which will be provided as part of the trip package. Another good guide is the Michelin Green Guide Paris. Wikipedia has good pages on most of the places we visit. Aug 5, Mon Departure from North America for Paris for many guests Aug 6, Tue Arrival in Paris and visit to Montmartre Cemetery Transfer from the airport by hired van to our 4* hotel, Mercure Paris Montmartre Sacré-Coeur. http://www.mercure.com/gb/hotel-0373-mercure-paris-montmartre- sacre-coeur-hotel/index.shtml The hotel is located on the southwest edge of Montmartre, with easy access to restaurants and to Place de Clichy, where metro lines 2 and 13 intersect.