P. Placidus a Spescha Als Pionier Des Alpinismus
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dufourspitze 4634M £1699
Icicle Mountaineering Ltd | 11a Church Street Windermere | Lake District | LA23 1AQ | UK Tel +44 (0)1539 44 22 17 | [email protected] Website: www.icicle-mountaineering.ltd.uk Online: shop.icicle-mountaineering.ltd.uk 2020 trip dossier | Dufourspitze 4634m £1699 Website link | http://www.icicle-mountaineering.ltd.uk/dufourspitze.html Key features Climb Dufourspitze, the highest mountain in Switzerland and second highest in the Alps.. 5 days guiding (Monday - Friday), with flexible itinerary to take advantage of the best conditions. Previous crampon or climbing experience is required, as this is a progression from an Intro course. Led by top qualified guides (IFMGA), guiding ratio 1:2 throughout the course. All technical equipment (e.g. B3 boots, crampons, ice axe etc.) can be hired from Icicle 2020 dates; 5 - 11 Jul, 19 - 25 Jul, 26 Jul - 1 Aug, 9 - 15 Aug, 30 Aug -+- 5 Sep. Icicle® is the registered trademark of Icicle Mountaineering UK registered company 413 6635. VAT 770 137 933 20 years ‘inspirational mountain adventure holidays’ established in 2000 Icicle Mountaineering Ltd | 11a Church Street Windermere | Lake District | LA23 1AQ | UK Tel +44 (0)1539 44 22 17 | [email protected] Website: www.icicle-mountaineering.ltd.uk Online: shop.icicle-mountaineering.ltd.uk Course overview . Climb the highest summit of Monte Rosa; Dufourspitze 4634m. It's the highest mountain in Switzerland, and the second highest in all of the Alps after Mont Blanc. We offer a week long programme to attempt this peak, as your acclimatisation and flexibility for selecting a weather window are crucial. To keep the itinerary flexibilty, the guiding ratio is 1:2 throughout, so you can take advantage of the best days for the summit weather window. -
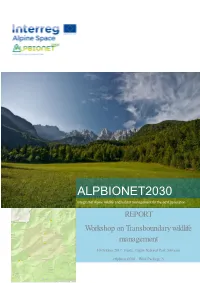
Workshop on Transboundary Wildlife Management
ALPBIONET2030 Integrative Alpine wildlife and habitat management for the next generation REPORT Workshop on Transboundary wildlife management 10 October 2017, Trenta, Triglav National Park, Slovenia (Alpbionet2030 – Work Package 2) Integrative Alpine wildlife and habitat management for the next generation A workshop to discuss tactics and devise actions for transboundary wildlife management between the wildlife managers of Transboundary Ecoregion Julian Alps, defined as the sum of Triglav Hunting Management Area and Gorenjska Hunting Management Area (Slovenia) and Tarvisiano Hunting District (Italy) with their core protected areas of Triglav National Park and Prealpi Giulie Nature Park, was held at the conference facilities of the “Dom Trenta” National Park house in Trenta. This Workshop is one of the activities of WP T.2 of the Alpbionet2030 project co- financed by the EU Alpine Space Programme. INTRODUCTION The behaviour and habitat use of animals can be strongly affected by hunting methods and wildlife management strategies. Hunting and wildlife management therefore have an influence on ecological connectivity. Lack of consistency in wildlife management between regions can cause problems for population connectivity for some species, particularly those with large home ranges, (e.g. some deer and large carnivores). Hunting seasons, feeding (or lack thereof), the existence of resting zones where hunting is prohibited, legal provisions for wildlife corridors, even administrative authority for wildlife management differ from one Alpine country to another. The Mountain Forest Protocol of the Alpine Convention (1996) asks parties to harmonise their measures for regulating the game animals, but so far this is only happening in a few isolated instances. Thus, to further the goals of ecological connectivity, ALPBIONET2030 aims coordinate wildlife management in selected pilot areas. -

Switzerland. Design &
SWITZERLAND. DESIGN & LIFESTYLE HOTELS Design & Lifestyle Hotels 2021. Design & Lifestyle Hotels at a glance. Switzerland is a small country with great variety; its Design & Lifestyle Hotels are just as diverse. This map shows their locations at a glance. A Aargau D Schaffhausen B B o d Basel Region e n s Rhein Thur e 1 2 e C 3 Töss Frauenfeld Bern 29 Limm B at Baden D Fribourg Region Liestal 39 irs B Aarau 40 41 42 43 44 45 Herisau Delémont 46 E Geneva A F Appenzell in Re e h u R H ss 38 Z ü Säntis r F Lake Geneva Region i 2502 s Solothurn c ub h - s e o e D e L Zug Z 2306 u g Churfirsten Aare e Vaduz G r W Graubünden 28 s a e La Chaux- e lense 1607 e L i de-Fonds Chasseral e n e s 1899 t r 24 25 1798 h le ie Weggis Grosser Mythen H Jura & Three-Lakes B 26 27 Rigi Glarus Vierwald- Glärnisch 1408 Schwyz Bad Ragaz 2119 2914 Neuchâtel re Napf stättersee Pizol Aa Pilatus Stoos Braunwald 2844 l 4 I Lucerne-Lake Lucerne Region te Stans La 5 nd châ qu u C Sarnen 1898 Altdorf Linthal art Ne Stanserhorn R Chur 2834 de e Flims J ac u 16 Weissfluh Piz Buin Eastern Switzerland / L 2350 s Davos 3312 18 E Engelberg s mm Brienzer Tödi e Rothorn 14 15 Scuol Liechtenstein e 12 y Titlis 3614 17 Arosa ro Fribourg 7 Thun 3238 Inn Yverdon B Brienz a D 8 Disentis/ Lenzerheide- L r s. -

4000 M Peaks of the Alps Normal and Classic Routes
rock&ice 3 4000 m Peaks of the Alps Normal and classic routes idea Montagna editoria e alpinismo Rock&Ice l 4000m Peaks of the Alps l Contents CONTENTS FIVE • • 51a Normal Route to Punta Giordani 257 WEISSHORN AND MATTERHORN ALPS 175 • 52a Normal Route to the Vincent Pyramid 259 • Preface 5 12 Aiguille Blanche de Peuterey 101 35 Dent d’Hérens 180 • 52b Punta Giordani-Vincent Pyramid 261 • Introduction 6 • 12 North Face Right 102 • 35a Normal Route 181 Traverse • Geogrpahic location 14 13 Gran Pilier d’Angle 108 • 35b Tiefmatten Ridge (West Ridge) 183 53 Schwarzhorn/Corno Nero 265 • Technical notes 16 • 13 South Face and Peuterey Ridge 109 36 Matterhorn 185 54 Ludwigshöhe 265 14 Mont Blanc de Courmayeur 114 • 36a Hörnli Ridge (Hörnligrat) 186 55 Parrotspitze 265 ONE • MASSIF DES ÉCRINS 23 • 14 Eccles Couloir and Peuterey Ridge 115 • 36b Lion Ridge 192 • 53-55 Traverse of the Three Peaks 266 1 Barre des Écrins 26 15-19 Aiguilles du Diable 117 37 Dent Blanche 198 56 Signalkuppe 269 • 1a Normal Route 27 15 L’Isolée 117 • 37 Normal Route via the Wandflue Ridge 199 57 Zumsteinspitze 269 • 1b Coolidge Couloir 30 16 Pointe Carmen 117 38 Bishorn 202 • 56-57 Normal Route to the Signalkuppe 270 2 Dôme de Neige des Écrins 32 17 Pointe Médiane 117 • 38 Normal Route 203 and the Zumsteinspitze • 2 Normal Route 32 18 Pointe Chaubert 117 39 Weisshorn 206 58 Dufourspitze 274 19 Corne du Diable 117 • 39 Normal Route 207 59 Nordend 274 TWO • GRAN PARADISO MASSIF 35 • 15-19 Aiguilles du Diable Traverse 118 40 Ober Gabelhorn 212 • 58a Normal Route to the Dufourspitze -

Swiss: 1,600 Kilometres Long, It Spans Four 4 /XJDQR࣠±࣠=HUPDWW Linguistic Regions, Five Alpine Passes, P
mySwitzerland #INLOVEWITHSWITZERLAND GRAND TOUR The road trip through Switzerland Whether you’re travelling by car or by motorcycle – mountain pass roads like the Tremola are one of the highlights of the Grand Tour of Switzerland. Switzerland in 10 stages Marvel at the sunrise over the 1 =XULFK࣠±࣠$SSHQ]HOO Matterhorn at least once in your lifetime. p. 12 Don’t miss wandering through the vine- yards of the winemaking villages of the 2 $SSHQ]HOO࣠±࣠6W0RULW] Lavaux. Or conquering the cobblestoned p. 15 Tremola on the south side of the Gotthard Pass. The Grand Tour of Switzerland is a 3 6W0RULW]࣠±࣠/XJDQR magnificent holiday and driving experi- p. 20 ence – and a concentration of all things Swiss: 1,600 kilometres long, it spans four 4 /XJDQR࣠±࣠=HUPDWW linguistic regions, five Alpine passes, p. 24 12 UNESCO World Heritage Properties and 22 stunning lakes. MySwitzerland is happy 5 =HUPDWW࣠±࣠/DXVDQQH to present a selection of highlights from p. 30 10 fascinating stages. Have fun exploring! 6 *HQHYD±࣠1HXFKkWHO p. 32 7 Basel 7 ࣠±࣠1HXFKkWHO 1 2 p. 35 10 8 9 8 1HXFKkWHO࣠±࣠%HUQ p. 40 3 9 %HUQ࣠±࣠/XFHUQH 6 5 4 p. 42 10 /XFHUQH±࣠=XULFK You will find a map of the Grand Tour at the back of the magazine. For more information, p. 46 please see MySwitzerland.com/grandtour 3 Grand Tour: people and events JUST LIKE OLD FRIENDS The Grand Tour of Switzerland is a journey of sights and discoveries. You will meet many different people along the tour, and thus enjoy the most enriching of experiences. -

A Hydrographic Approach to the Alps
• • 330 A HYDROGRAPHIC APPROACH TO THE ALPS A HYDROGRAPHIC APPROACH TO THE ALPS • • • PART III BY E. CODDINGTON SUB-SYSTEMS OF (ADRIATIC .W. NORTH SEA] BASIC SYSTEM ' • HIS is the only Basic System whose watershed does not penetrate beyond the Alps, so it is immaterial whether it be traced·from W. to E. as [Adriatic .w. North Sea], or from E. toW. as [North Sea . w. Adriatic]. The Basic Watershed, which also answers to the title [Po ~ w. Rhine], is short arid for purposes of practical convenience scarcely requires subdivision, but the distinction between the Aar basin (actually Reuss, and Limmat) and that of the Rhine itself, is of too great significance to be overlooked, to say nothing of the magnitude and importance of the Major Branch System involved. This gives two Basic Sections of very unequal dimensions, but the ., Alps being of natural origin cannot be expected to fall into more or less equal com partments. Two rather less unbalanced sections could be obtained by differentiating Ticino.- and Adda-drainage on the Po-side, but this would exhibit both hydrographic and Alpine inferiority. (1) BASIC SECTION SYSTEM (Po .W. AAR]. This System happens to be synonymous with (Po .w. Reuss] and with [Ticino .w. Reuss]. · The Watershed From .Wyttenwasserstock (E) the Basic Watershed runs generally E.N.E. to the Hiihnerstock, Passo Cavanna, Pizzo Luceridro, St. Gotthard Pass, and Pizzo Centrale; thence S.E. to the Giubing and Unteralp Pass, and finally E.N.E., to end in the otherwise not very notable Piz Alv .1 Offshoot in the Po ( Ticino) basin A spur runs W.S.W. -
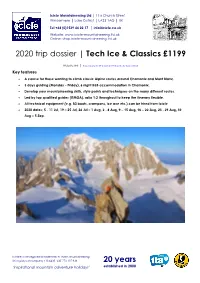
Tech Ice & Classics £1199
Icicle Mountaineering Ltd | 11a Church Street Windermere | Lake District | LA23 1AQ | UK Tel +44 (0)1539 44 22 17 | [email protected] Website: www.icicle-mountaineering.ltd.uk Online: shop.icicle-mountaineering.ltd.uk 2020 trip dossier | Tech Ice & Classics £1199 Website link | http://www.icicle-mountaineering.ltd.uk/classics.html Key features A course for those wanting to climb classic Alpine routes around Chamonix and Mont Blanc. 5 days guiding (Monday - Friday), 6 night B&B accommodation in Chamonix. Develop your mountaineering skills, style points and techniques on the many different routes. Led by top qualified guides (IFMGA), ratio 1:2 throughout to keep the itinerary flexible. All technical equipment (e.g. B3 boots, crampons, ice axe etc.) can be hired from Icicle 2020 dates; 5 - 11 Jul, 19 – 25 Jul, 26 Jul – 1 Aug, 2 - 8 Aug, 9 – 15 Aug, 16 – 22 Aug, 23 - 29 Aug, 30 Aug – 5 Sep. Icicle® is the registered trademark of Icicle Mountaineering UK registered company 413 6635. VAT 770 137 933 20 years ‘inspirational mountain adventure holidays’ established in 2000 Icicle Mountaineering Ltd | 11a Church Street Windermere | Lake District | LA23 1AQ | UK Tel +44 (0)1539 44 22 17 | [email protected] Website: www.icicle-mountaineering.ltd.uk Online: shop.icicle-mountaineering.ltd.uk Course overview For those who enjoy mountaineering climbing classic routes, this course allows you to push your skills (grade III ice or UK Severe or US Grade 5.9) to attempt some of the major mixed and ice mountaineering routes around Chamonix and the Mont Blanc Massif. -

In Memoriam 115
IN MEMORIAM 115 • IN MEMORIAM CLAUDE WILSON 1860-1937 THE death of Claude Wilson within a few weeks of attaining his seventy-seventh birthday came as a terrible shock to his many friends. Few of us even knew that he was ill, but in the manner of his passing none can regret that there was no lingering illness. We can but quote his own words in Lord Conway's obituary: 'the best we can wish for those that we love is that they may be spared prolonged and hopeless ill health.' His brain remained clear up to the last twenty-four hours and he suffered no pain. The end occurred on October 31. With Claude Wilson's death an epoch of mountaineering comes to an end. He was of those who made guideless and Alpine history from Montenvers in the early 'nineties, of whom but Collie, Kesteven, Bradby, ~olly and Charles Pasteur still survive. That school, in which Mummery and Morse were perhaps the most prominent examples, was not composed of specialists. Its members had learnt their craft under the best Valais and Oberland guides; they were equally-proficient on rocks or on snow. It mattered little who was acting as leader in the ascent or last man in the descent. They were prepared to turn back if conditions or weather proved unfavourable. They took chances as all mountaineers are forced to do at times but no fatal accidents, no unfortunate incidents, marred that great page of Alpine history, a page not confined to Mont Blanc alone but distributed throughout the Western Alps. -

Del Gran Paradiso Alta Montaña Y Patrimonio Religioso En La Cima De Un Gigante De Los Alpes
16 I ESTUDIOS DEL PATRIMONIO CULTURAL 6 LA MADONNINA DEL GRAN PARADISO ALTA MONTAÑA Y PATRIMONIO RELIGIOSO EN LA CIMA DE UN GIGANTE DE LOS ALPES Constanza Ceruti I CONICET/UCASAL | [email protected] El presente trabajo aborda la veneración que recibe la Madonnina, una pe- queña imagen de la Virgen María depositada en la cima del monte Gran Paradiso, en los Alpes Occidentales. La montaña constituye la cumbre más alta situada enteramente en territorio italiano y se cuenta entre los llama- dos «gigantes alpinos» cuya altitud supera los cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Pero a diferencia de otros macizos como el Monte Blanco o el Matterhorn, que han sido cooptados por las ascensiones comerciales y deportivas, en el monte Gran Paradiso es aún factible experimentar el al- pinismo en sus formas más tradicionales, las que no excluyen la devoción religiosa. Nuestra Señora de los Montes y de las Nieves es venerada para proteger a los alpinistas en sus ascensiones y a los pobladores que habitan en los an- gostos valles Valsaverenche y Cogne, ante la amenaza de las avalanchas invernales. El culto a la Madonnina comprende instancias de ascensos en procesión colectiva, que se efectúan esporádicamente a la cumbre del Gran Paradiso con el fin de restaurar la imagen, afectada por las fulguraciones y la intemperie. Desde un punto de vista social y político, los llamados «viajes de la Virgen a la montaña» contribuyen a cohesionar a la comunidad y a legitimar el papel de obispos y sacerdotes, siendo para los pobladores alpinos motivo de orgu- llo contar con un párroco capaz de acompañar a la pequeña virgencita en su ascenso a la gran montaña. -
More Diverse My Säntis My Säntis 2021
english My Säntis More diverse My Säntis 2021 With new worlds of experiences saentisbahn.ch Directions We are the destination of your journey. Mount Säntis is the highest mountain in eastern Switzerland. The Säntis cable car starts out from Schwägalp, which is easy to reach throughout the year without a Swiss motorway toll sticker using well-maintained roads that are kept clear of snow in winter. There is plenty of free parking at the cable car base station (including bus and disabled parking bays). Public transport By train to Urnäsch or Nesslau. Then by post bus straight to the base station. Car / bus Time Distance Zürich-Schwägalp 1.20 h 81 km Chur-Schwägalp 1.20 h 88 km Friedrichshafen-Schwägalp 1.45 h 66 km Lindau-Schwägalp 1.20 h 98 km Konstanz-Schwägalp 1.20 h 61 km Bregenz-Schwägalp 1.15 h 76 km Stuttgart München Singen Ravensburg Meersburg Schaffhausen Friedrichshafen Konstanz Kreuzlingen Lindau Frauenfeld Romanshorn Bregenz Rorschach Altenrhein Wil Zürich Winterthur Gossau St.Margrethen St.Gallen Altstätten Zürich Herisau Appenzell Wattwil Schwägalp Urnäsch Rapperswil Feldkirch Nesslau Wildhaus Amden Buchs Arlberg Ziegelbrücke Sargans For more information, visit Glarus www.saentisbahn.ch and www.sbb.ch Schedule 2021 Keeping an eye on six different countries as well as the time. 19 October 2020 to 17 January 2021* Mon – Sun 08.30 am – 17.00 pm 6 February to 14 May 2021 Mon – Fri 08.30 am – 17.00 pm Sat, Sun 08.00 am – 17.00 pm 15 May to 24 October 2021 Mon – Fri 07.30 am – 18.00 pm Sat, Sun 07.30 am – 18.30 pm 25 October to 31 December 2021 Mon – Sun 08.30 am – 17.00 pm * Cable car closure from Monday, 18 January, to Friday, 5 February 2021. -

IN MEMORIAM Year of the ALPINE CLUB OBITUARY Election
IN MEMORL'\M IN MEMORIAM Year of THE ALPINE CLUB OBITUARY Election Fisher, Joel E. • • • • • • • • 1913 Murray, G. W. • • • • • • • • 1925 Brown, T. Graham • • • • • • • 1926 Wilson, General Sir Roger • • • • • • 1927 Wager, L. R. • • • • • • • • 1928 Pleydell-Bouverie, Hon. B. • • • • • • 1934 Handley, C. B. C. • • • • • • • 1960 Bazarrabusa, T. B. • • • • • • • I963 Harlin, J. • • • • • • • • • rg66 JOEL ELLIS FISHER 1891- 1966 J. E. FISHER died suddenly on January 6 while en route by car to a meeting of the Board of Directors of the Melville Shoe Company. He was in his seventy-fifth year. Born in New York City, Fisher graduated from Yale with honours in I 9 I I, the youngest man in his class, Phi Beta Kappa and Sigma XI. During World War I he was a naval lieutenant on the U.S.S. lsabel. For many years he was president of the North-western Terminal Railroad in Denver, secretary and director of the Melville Shoe Company, treasurer and vestryman of the Church of the Heavenly Rest, president of the Samaritan Home for the Aged, director of the Babson Gravity Research Foundation and the Washington Institute for Biophysical Research. He was elected to the Alpine Club in 1913, and was President of the American Alpine Club 1935- 37, having joined in I92I. He was also a member of the Swiss, French and Italian Alpine Clubs, and an honorary member of the Yale, Harvard and Colorado Mountaineering Clubs. His climbing in the Alps began in 1906 and, in a span of fifty-seven years, included over 150 major ascents. He had done the Matterhorn six times, the last in I950. -

Alpine Adventures 2019 68
RYDER WALKER THE GLOBAL TREKKING SPECIALISTS ALPINE ADVENTURES 2019 68 50 RYDER WALKER ALPINE ADVENTURES CONTENTS 70 Be the first to know. Scan this code, or text HIKING to 22828 and receive our e-newsletter. We’ll send you special offers, new trip info, RW happenings and more. 2 RYDERWALKER.COM | 888.586.8365 CONTENTS 4 Celebrating 35 years of Outdoor Adventure 5 Meet Our Team 6 Change and the Elephant in the Room 8 Why Hiking is Important – Watching Nature 10 Choosing the Right Trip for You 11 RW Guide to Selecting Your Next Adventure 12 Inspired Cuisine 13 First Class Accommodations 14 Taking a Closer Look at Huts 15 Five Reasons Why You Should Book a Guided Trek 16 Self-Guided Travel 17 Guided Travel & Private Guided Travel EASY TO MODERATE HIKING 18 Highlights of Switzerland: Engadine, Lago Maggiore, Zermatt 20 England: The Cotswolds 22 Isola di Capri: The Jewel of Southern Italy NEW 24 French Alps, Tarentaise Mountains: Bourg Saint Maurice, Sainte Foy, Val d’Isère 26 Sedona, Arches & Canyonlands 28 Croatia: The Dalmatian Coast 28 30 Engadine Trek 32 Scotland: Rob Roy Way 34 Montenegro: From the Durmitor Mountain Range to the Bay of Kotor 36 New Mexico: Land of Enchantment, Santa Fe to Taos NEW 38 Slovakia: Discover the Remote High Tatras Mountains NEW MODERATE TO CHALLENGING HIKING 40 Heart of Austria 42 Italian Dolomites Trek 44 High Peaks of the Bavarian Tyrol NEW 46 Sicily: The Aeolian Islands 48 Rocky Mountain High Life: Aspen to Telluride 50 New Brunswick, Canada: Bay of Fundy 52 Via Ladinia: Italian Dolomites 54 Dolomiti di