Donausteig-Tagebuch: „Durchs Eferdinger Becken Mäandern“
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

AKZEPTANZSTELLENVERZEICHNIS Restaurant Pass Card
OBERÖSTERREICH AKZEPTANZSTELLEN- VERZEICHNIS Lebensmittel Pass Card AUSZUG UNSERER BEKANNTESTEN AKZEPTANZPARTNER MAX MUSTERMANN SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES CARD: 1234 5678 9101 2345 GÜLTIG BIS 02/24 Prepaid ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR KARTENNUTZER Jeder in diesem Verzeichnis genannte Akzeptanzpartner akzeptiert gerne Ihre Sodexo Lebensmittel Pass Card. Unsere Akzeptanzstellen sind in der Regel zusätzlich durch den blauen Sodexo Türau!leber von außen erkennbar! Bitte beachten Sie, dass die Lebensmittel Pass Card nur für den Kauf von Lebens- mitteln gilt. Sie kann nicht zur Bezahlung von Alkohol, Tabakwaren, Non Food und Ähnlichem verwendet werden. Sollte Ihre Karte irrtümlich nicht akzeptiert werden, rufen Sie uns bitte an – wir stehen Ihnen gerne unter der Rufnummer 01/328 60 60 - 0 zur Verfügung. Eine tagesaktuelle Übersicht aller Akzeptanzstellen finden Sie online auf www.mysodexopass.at oder in der MySodexoApp. NUTZEN SIE AUCH WEITERE VORTEILE DER MYSODEXOAPP: Mobil bezahlen mit Sodexo Pay (Android) oder Apple Pay (iOS) Unsere MySodexoApp finden Sie für iOS oder Android im jeweiligen Transaktionen einsehen App Store. Karte sperren Guthaben abfragen Antworten auf häufig ? gestellte Fragen finden Sodexo Benefits & Rewards Services Austria GmbH Iglaseegasse 21-23 | 1190 Wien Tel.: +43 (0)1 328 60 60 - 0 | Fax: +43 (0)1 328 60 60 - 200 offi[email protected] | www.sodexo.at *) Teilnehmende Partner-Filialen / Franchisepartner entnehmen Sie bitte dem folgenden Verzeichnis 3334 Gaflenz Cafe KostBar Südtiroler Straße 22 Gastro Forster Herbert -
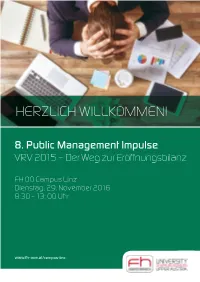
Tagungsmappe
Fotolia © HERZLICH WILLKOMMEN! 8. Public Management Impulse VRV 2015 – Der Weg zur Eröffnungsbilanz FH OÖ Campus Linz Dienstag, 29. November 2016 8:30 - 13: 00 Uhr www.fh-ooe.at/campus-linz 8:30 – 13:00 Uhr Hagenberg Linz Steyr Wels Herzlich willkommen! Die Harmonisierung der Rechenwerke auf europäischer Ebene (EU- Fiskalrahmenrichtlinie) und die Bundeshaushaltsrechtsreform 2009/2013 haben den Weg für eine neue Form und Gliederung des Haushalts- und Rechnungswesens auch für die Länder- und Gemeindeebene gebahnt. Eingeführt wird eine integrierte 3-Komponenten- Rechnung bestehend aus Finanzierungs-, Vermögens-, und Ergebnisrechnung. Im Zentrum der diesjährigen Public Management Impulse steht die Ver- mögensrechnung, die als neues Element des öffentlichen Rechnungs- wesens in der Eröffnungsbilanz das kurz- und langfristige Vermögen, die kurz- und langfristigen Fremdmittel sowie das Nettovermögen als Aus- gleichsposten transparent darstellt. Obwohl die Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 – kurz VRV 2015 – für Gemeinden über 10.000 Einwohner erst mit 1. 1. 2019 bzw. für Gemeinden unter 10.000 Einwohner mit 1. 1. 2020 an- zuwenden ist, lohnt sich schon heute ein Blick darauf, was sich konkret ändert und welche Vorarbeiten notwendig sind, um eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Wir wünschen Ihnen interessante Einblicke, hilfreiche Impulse für Ihre eigene Praxis und gute Gespräche! 8. Public Management Impulse: VRV 2015 – Der Weg zur Eröffnungsbilanz FH OÖ, Campus Linz – 29.11.2016 8:30 – 13:00 Uhr Hagenberg Linz Steyr Wels -

Vorläufiger Stellungsplan Oberösterreich
Vorläufiger Stellungsplan des Militärkommandos OBERÖSTERREICH Geburtsjahrgang 2003 Bitte beachten Sie Folgendes: 1. Für den Bereich des Militärkommandos Oberösterreich werden die Stellungspflichtigen durch die Stellungskommission Oberösterreich, Garnisonstraße 36, 4018 Linz der Stellung unterzogen. Das Stellungsverfahren nimmt in der Regel 1 1/2 Tage in Anspruch. 2. Die Stellungspflichtigen haben sich bis 0600 des Stellungstages im Stellungshaus einzufinden, können aber, wenn es aus verkehrstechnischen Gründen zwingend erforderlich ist, schon am Vorabend bis 2100 Uhr erscheinen (für Unterkunft im Stellungshaus ist gesorgt). Aufgrund der aktuellen COVID-Lage wird empfohlen, erst am Stellungstag anzureisen. 3. Zur Überprüfung der Identität und Staatsbürgerschaft sind mitzubringen: Amtlicher Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis der Republik Österreich, Führerschein usw.), eigener Staatsbürgerschaftsnachweis (entfällt bei Vorlage von Reisepass oder Personalausweis der Republik Österreich), bei Doppelstaatsbürgerschaft ein entsprechender Nachweis, Geburtsurkunde, E-Card, eventuell Heiratsurkunde. 4. Zur Beurteilung des Gesundheitszustandes sind mitzunehmen: Eventuell vorhandene ärztliche Atteste (hierfür besteht kein Anspruch auf Kostenvergütung) sowie der ausgefüllte und unterschriebene medizinische Fragebogen, falls er dem Stellungspflichtigen zugestellt wurde. 5. Zur Beurteilung des Ausbildungsstandes ist mitzunehmen: Eine gültige Schulbestätigung bzw. ein gültiger Lehrvertrag. 6. Bei Vorliegen besonders schwerwiegender Gründe besteht -

Manual on Danube Navigation Imprint
Manual on Danube Navigation Imprint Published by: via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH Donau-City-Straße 1, 1220 Vienna [email protected] www.via-donau.org Responsibility for content: Hans-Peter Hasenbichler Project management: Martin Paschinger Editing: Thomas Hartl, Vera Hofbauer Technical contributions: Maja Dolinsek, Simon Hartl, Thomas Hartl, Brigitte Hintergräber, Vera Hofbauer, Martin Hrusovsky, Gudrun Maierbrugger, Bettina Matzner, Lisa-Maria Putz, Mario Sattler, Juha Schweighofer, Lukas Seemann, Markus Simoner, Dagmar Slavicek Sponsoring: Hedwig Döllinger, Hélène Gilkarov Layout: Bernd Weißmann Print: Grasl Druck & Neue Medien GmbH Vienna, January 2013 ISBN 3-00-009626-4 © via donau 2013 Klimaneutrale Produktion Erneuerbare Energie Nachhaltiges Papier Pflanzenölfarben The Manual on Danube Navigation is a project of the National Action Plan Danube Navigation. Preface Providing knowledge for better utilising the Danube’s potential In connection with the Rhine, the Danube is more and more developing into a main European traffic axis which ranges from the North Sea to the Black Sea at a distance of 3,500 kilometres, thereby directly connecting 15 countries via waterway. Some of the Danube riparian states show the highest economic growth rates amongst the states of Europe. Such an increase in trade entails an enormous growth of traffic in the Danube corridor and requires reliable and efficient transport routes. The European Commission has recognised that the Danube waterway may serve as the backbone of this dynamically growing region and it has included the Danube as a Priority Project in the Trans-European Transport Network Siim Kallas (TEN-T) to ensure better transport connections and economic growth. Vice-President of the European Prerequisite for the utilisation of the undisputed potentials of inland naviga- Commission, Commissioner for tion is the removal of existing infrastructure bottlenecks and weak spots in the Transport European waterway network. -

Übernachtungsbetriebe in Der Region Eferding
Stand vom 03. Dez. 16 Übernachtungsbetriebe in der Region Eferding Gemeinde Eferding (ca 2 km von der Schanze entfernt) Brummeier’s Kepler Stuben Stadtplatz 35 Informationen: 4070 Eferding Betriebsart Hotel**** 07272/2462 40 Betten [email protected] 1 Suite www.brummeier.at Preis auf Anfrage Gasthof zum Goldenen Kreuz Schmiedstraße 29 Informationen: 4070 Eferding Betriebsart Hotel*** 07272/4142 41 Betten [email protected] www.gasthof-kreuzmayr.at Gemeinde Pupping (ca 1 km von der Schanze entfernt) Landgasthof Pension Dieplinger Brandstatt 2 + 4 Informationen: 4070 Eferding/Pupping Betriebsart Pension*** 07272/2324 oder 07272/3111 36 Betten [email protected] Preis: auf Anfrage www.langmayr.at Gasthof Klinglmayr Pupping 14 Informationen: 4070 Eferding/Pupping Betriebsart Pension 07272/2427 8 Betteb [email protected] Preis: auf Anfrage Haus Webinger Brandstatt 1 Informationen: 4070 Eferding/Pupping Betriebsart Privat 07272/4279 9 Betten Preis: auf Anfrage 1 Stand vom 03. Dez. 16 Gemeinde Aschach an der Donau (ca 7 km von der Schanze entfernt) Aschacher Hof Ritzbergerstrasse 7 Informationen: 4082 Aschach an der Donau Betriebsart Hotel 07273/6360 30 Betten [email protected] Preis: auf Anfrage www.aschach.at/aschacherhof Gasthof „Zur Sonne“ Kurzwernhartplatz 5 Informationen: 4082 Aschach an der Donau Betriebsart Hotel 07273/6308 20 Betten [email protected] 2 Suiten www.aschach.at/gasthof.sonne Preis: auf Anfrage Gasthof Pension Kaiserau Kaiserau 1 Informationen: 4082 Aschach an der Donau -

Reader – Ports and Inland Vessels
READER – PORTS AND INLAND VESSELS Extract of relevant passages from the „Manual of Danube Navigation”, via donau (2019) and of relevant passages from the “Annual Report of Danube Navigation”, viadonau (2018). Pictures: viadonau in Manual on Danube Navigation (2019), p. 79, 106 86 System elements of Danube navigation: Ports and terminals Terminology Ports are facilities for the transhipment of goods that have at least one port basin. Transhipment points without a port basin are known as transhipment sites. Source: viadonau Source: Comparison of ports and transhipment sites A port has many advantages compared to a transhipment site: Firstly it has longer quay walls and can therefore offer more possibilities for transhipment and logi- stics. Certain cargo groups are only allowed to be transhipped in a port basin in accordance with national laws. Secondly the port provides an important protective function: During flood water, ice formation or other extreme weather events ships can stay safe in the port. A terminal is a facility of limited spatial extension for the transhipment, storage and logistics of a specific type of cargo (e.g. container terminals or high & heavy termi- nals). A port or a transhipment site may dispose of one or more terminals. Ports as logistics service providers Functions and performance of a port Ports connect the transport modes of road, rail and waterway and are important service providers in the fields of transhipment, storage and logistics. In addition to their basic functions of transhipment and storage of goods, they also often perform a variety of value-added logistics services to customers, such as packaging, container stuffing and stripping, sanitation and quality checks. -

Förderungssätze Für Das Jahr 2021
Förderungssätze für das Jahr 2022 Gemäß §6 (1) der FRL kommunale Siedlungswasserwirtschaft 2016 Wien, September 2021 Impressum Medieninhaber und Herausgeber: Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus Stubenring 1, 1010 Wien Gesamtumsetzung: Kommunalkredit Public Consulting GmbH Wien, 2021. Stand: 20. September 2021 Copyright und Haftung: Auszugsweiser Abdruck ist nur mit Quellenangabe gestattet, alle sonstigen Rechte sind ohne schriftliche Zustimmung des Medieninhabers unzulässig. Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben in dieser Publikation trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus und der Autorin/des Autors ausgeschlossen ist. Rechtausführungen stellen die unverbindliche Meinung der Autorin/des Autors dar und können der Rechtsprechung der unabhängigen Gerichte keinesfalls vorgreifen. Bundesland Gemeindename Gemeinde Förderungssatz Förderungssatz Kennziffer Abwasser- Wasser- entsorgung [%] versorgung [%] Burgenland Andau 10701 23 20 Burgenland Antau 10616 14 15 Burgenland Apetlon 10702 21 19 Burgenland Bad Sauerbrunn 10611 10 10 Burgenland Bad Tatzmannsdorf 10901 12 20 Burgenland Badersdorf 10931 37 24 Burgenland Baumgarten 10617 10 10 Burgenland Bernstein 10902 16 20 Burgenland Bildein 10426 25 19 Burgenland Bocksdorf 10401 25 25 Burgenland Breitenbrunn am Neusiedler See 10301 13 10 Burgenland Bruckneudorf 10703 10 10 Burgenland Burgauberg-Neudauberg 10402 40 25 Burgenland Deutsch Jahrndorf 10704 30 15 Burgenland Deutsch -

Global Map of Irrigation Areas AUSTRIA
Global Map of Irrigation Areas AUSTRIA Area equipped for irrigation Area actually irrigated NUTS1-region NUTS2-region (ha) (ha) Burgenland Ostösterreich 24 790 10 940 Niederösterreich Ostösterreich 79 050 27 520 Wien Ostösterreich 1 770 550 Kärnten Südösterreich 1 040 210 Steiermark Südösterreich 3 570 1 340 Oberösterreich Westösterreich 2 270 720 Salzburg Westösterreich 240 40 Tirol Westösterreich 3 170 2 090 Vorarlberg Westösterreich 150 40 Austria total 116 050 43 450 NUTS1-region Area equipped for irrigation (ha) total with groundwater with surface water Ostösterreich 105 610 89 192 16 418 Südösterreich 4 610 2 143 2 467 Westösterreich 5 830 3 267 2 563 Austria total 116 050 94 602 21 448 http://www.fao.org/nr/water/aquastat/irrigationmap/aut/index.stm Created: March 2013 Global Map of Irrigation Areas AUSTRIA Area equipped for Municipality NUTS3-region Province irrigation (ha) Deutschkreutz Mittelburgenland Burgenland 0 Draßmarkt Mittelburgenland Burgenland 0 Frankenau-Unterpullendorf Mittelburgenland Burgenland 0 Großwarasdorf Mittelburgenland Burgenland 0 Horitschon Mittelburgenland Burgenland 0 Kaisersdorf Mittelburgenland Burgenland 0 Kobersdorf Mittelburgenland Burgenland 0 Lackenbach Mittelburgenland Burgenland 0 Lackendorf Mittelburgenland Burgenland 3 Lockenhaus Mittelburgenland Burgenland 0 Lutzmannsburg Mittelburgenland Burgenland 8 Mannersdorf an der Rabnitz Mittelburgenland Burgenland 129 Markt Sankt Martin Mittelburgenland Burgenland 0 Neckenmarkt Mittelburgenland Burgenland 0 Neutal Mittelburgenland Burgenland 0 Nikitsch -

Seite 1 Laufende Nr. 3 Jahr 2016 VERHANDLUNGSSCHRIFT Über Die Öffentliche Sitzung Des Gemeinderates Der Marktgemeinde Aschach
Laufende Nr. 3 Jahr 2016 VERHANDLUNGSSCHRIFT Über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Aschach an der Donau am 06.06.2016 Tagungsort: Sitzungssaal Marktgemeindeamt Aschach Beginn: 19:00 Uhr Ende: 21:45 Uhr Anwesende: Vorsitzender: Bürgermeister Ing. Knierzinger Friedrich (ÖVP) Österreichische Volkspartei (ÖVP) GVM Weichselbaumer Franz GVM Paschinger Franz GRM Rosemarie Schwantner GRM Christoph Knierzinger GRM Stadler Florian GRM Herbert Hofer GRM Johann Rechberger GRM Binder Andreas GRM Ing. Gerhard Buchroithner GRM Manfred Perndorfer Ersatzmitglieder ÖVP GRM Stadler Florian für Hrn. Schlagintweit Christian GRM Binder Andreas für Fr. Leitner Anita Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) 2. Vizebgm. Christoph Haider GVM Herwig Hosiner GRM Mag. Haider Roman GRM Harrer Elisabeth GRM Dieplinger Wolfgang GRM Radler Thomas Ersatzmitglieder FPÖ GRM Dieplinger Wolfgang für Hrn. Mag. Gaadt Manuel Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) GVM Ing. Robert Peter GRM Josef Jäger GRM Ing. Matthias Lucan Seite 1 GRM Ramona Frandl GRM Dietmar Groiss jun. Ersatzmitglieder SPÖ Die GRÜNEN GVM Dr. Judith Wassermair GRM Wassermair Johannes GRM Bachmayer Beatrix Ersatzmitglieder der GRÜNEN Weiters anwesend: AL Karin Rathmayr Seite 2 Der Vorsitzende begrüßt alle anwesenden Gemeinderäte und Besucher zur heutigen Sitzung. Er stellt fest, dass die Tagesordnung zeitgerecht zugestellt wurde. Gegen die heutige Sitzung bestehen keine Einwände und der Gemeinderat ist beschlussfähig. Der Vorsitzende teilt mit, dass der Tagesordnungspunkt 2.3., aufgrund einer Empfehlung eines Juristen, von der Tagesordnung abgesetzt wird. Hr. Mag. Haider Roman wird vom Vorsitzenden vor Beginn der Sitzung angelobt. Bevor in die Sitzung eingegangen wird, verliest der Vorsitzende einen Dringlichkeitsantrag, der vor dem Punkt Allfälligem behandelt werden soll. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs.3 OÖ Gemeindeordnung von GR Dietmar Groiss jun. -

Ports and Inland Vessels
READER – PORTS AND INLAND VESSELS Extract of relevant passages from the „Manual of Danube Navigation”, via donau (2012) and the „Annual Report 2014“ from via donau Terminology Ports are facilities for the transhipment of goods that have at least one port basin. Transhipment points without a port basin are known as transhipment sites. Source: via donau Comparison of ports and transhipment sites In comparison to a transhipment site, a port has multiple advantages: on one hand, it has longer quay walls and can therefore offer more possibilities for transhipment and logistics. Certain cargoes are only allowed to be tran- shipped in a port basin in accordance with national laws. Additionally, the port provides an important protective function: During flood water, ice formation or other extreme weather events ships can stay safe in the port. A terminal is a facility of limited spatial extension for the transhipment, stor- age and logistics of a specific type of cargo (e.g. container terminal or high & heavy terminal). A port or a transhipment site may dispose of one or more terminals. Ports as logistical service providers Functions and performance of a port Ports connect the transport modes of road, rail and waterway and are impor- tant service providers in the fields of transhipment, storage and logistics. In addition to their basic functions of transhipment and storage of goods, they also often perform a variety of value-added logistics services to custom- ers, such as packaging, container stuffing and stripping, sanitation and quality checks. This enhances ports as logistics platforms and impetus sources for locating companies and boosting the economy. -
Aschach. Der Markt Für Genießer. Weinbau Der Keltische Name Joviacum Ob Pedalritter, Wandervogel, Benzinkutscher Machen
zwischen Kelten und Aschach. Der Markt für Genießer. weinbau Der keltische Name Joviacum Ob Pedalritter, Wandervogel, Benzinkutscher machen. Hier gastieren Flanierer, Spazierer (=Aschach) er scheint erst mals im oder Donaukapitän – Aschach lädt sie alle und Genießer. Itinerarium Antonini anum zur Zeit zum Verweilen ein. Bürgerhäuser aus dem Marktatmosphäre pur, Gastgärten im Schat- des römischen Kaisers Marcus Mittel alter, Fassaden und Innenhöfe aus ten kühlender Bäume und die Donau im Drei - Aurelius Antoninus. gotischer, barocker und Renaissance-Zeit vierteltakt laden ein zur Einkehr. Gut essen, Die erste urkundliche Er wäh nung in den Farben des Regenbogens erfreuen sich wohl fühlen und einfach genießen. erfolgte durch Tassilo III. im Jahr das Auge und machen Lust aufs Leben. Sie 777. Kaiser Maximilian I. verlieh erzählen vom Leben der Bürger, Schiffer dem Markt ein in Österreich ein- und Schopper. Ein Ort voller Geschichte und maliges Wappen. Geschichten. 1784 wurde die freie Weinschank Wer der Hektik des Alltags ausweichen will, eingeführt, was zur Folge hatte, ist hier richtig. Das lauteste Geräusch, dass man bei den Aschacher Bür- das Sie hier hören werden, ist das Zwölf - gern und Weinbauern den Wein uhr schlagen des Kirchturms. Und manch - viel günstiger als bei den Gast mal das Tosen, Blubbern, Gluckern und wirten erstehen konnte. Die Wirte Rauschen der Donauwellen. Hier treffen sahen sich in ihrer Existenz be sich Genussradler, die gern rechts und droht und wurden bei der „Ober- links der Donau in aller Ruhe ihre Meter sten Justizstelle“ vorstellig. Der Beamte in Wien gestattete jedoch weiterhin die Ausschank mit dem Argument dass „Der Wein GESCHICHTE UND GESCHICHTEN Birdies UND BADESPASS einem Essig gleich komme und Auf zahlreichen Gebäuden im Ortskern finden Pedalritter, Wasserratten und Wandervögel finden keinen Anwert finde… der hie- Sie Hinweise zur Geschichte und Architektur in und um Aschach eine Auswahl an Ange boten, raus erfechsset werdene Wein von Aschach. -

Danube Bike & River Cruise: Prague to Budapest
VBT Itinerary by VBT www.vbt.com Danube Bike & River Cruise: Prague to Budapest Bike Vacation + Air Package A Danube cycling and river cruise doesn’t get any better than this! In just a week, you’ll explore four different countries— Germany, Austria, Slovakia, and Hungary—as well as a world-class cultural capital, Vienna. Cycle the renowned Danube Bike Path, admiring vistas of storybook villages and castles, lush vineyards, and carpeted hills unfurling along the river banks. Pause to explore medieval cities and the spectacular Melk Abbey, and enjoy a private wine tasting. And at the end of the day, return to a deluxe Emerald Waterways river ship, where attentive service, fine dining, and a welcoming ambiance invite you to relax after an invigorating day. There’s no better or more convenient way to experience the heart of Europe! Cultural Highlights Unpack once, then bike and boat along the Danube in four countries and three cultural 1 / 11 VBT Itinerary by VBT www.vbt.com capitals—all on one trip Follow the car-free and scenic Danube and EuroVelo 6 bike paths in this bicycle-friendly region Enjoy an exclusive Viennese concert with the music of Strauss and Mozart Choose to be as active or relaxed as you wish from our menu of cycling routes and walking tours What to Expect On Shore: This tour offers easy riverside terrain, with a few climbs to reach riverside towns. Riding is primarily on bike paths of both pavement and packed gravel, with some road riding through both urban and rural areas.