Und Kulturwissenschaften
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
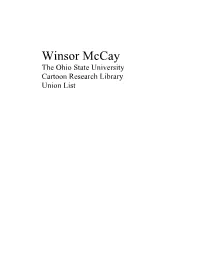
Winsor Mccay
Winsor McCay The Ohio State University Cartoon Research Library Union List This union list of work by Winsor McCay and related materials available at The Ohio State University Cartoon Research Library is published to provide researchers and collectors a single source of information compiled from several unpublished finding aids. Finding numbers are listed for the convenience of researchers. None of the books or serials relating to Winsor McCay that are available in the library are included in this list because information about these works is available on OSCAR, Ohio State University Libraries’ on-line catalog. McCay materials in the San Francisco Academy of Comic Art Collections (SFACA) gathered by Bill Blackbeard, Director, are not included because they are unprocessed at the present time. When the SFACA materials become available, a virtually complete archive of the published works of Winsor McCay will be accessible here. For further information, please contact the library. We are grateful to many persons for their role in making the rich resources described in this union list available to the public at the Cartoon Research Library: To collectors Bob Bindig, Henriette Adam Brotherton, John Canemaker, Leo and Marie Egli, Richard Gelman, Woody Gelman, Charles Kuhn, and Philip Sills for sharing their treasures. To Director of Libraries, William J. Studer, for making the initial acquisition of Gelman materials possible. To Pamela Hill for her assistance. To Erin Shipley for her patient work on this publication. Winsor McCay The Ohio State University Cartoon Research Library Union List Unless otherwise noted, all Winsor McCay materials form part of the Woody Gelman Collection. -

The Waking Life of Winsor Mccay: Social Commentary in a Pilgrim's
University of Richmond UR Scholarship Repository Student Publications Student Research 7-2015 The akW ing Life of Winsor McCay: Social Commentary in A Pilgrim’s Progress by Mr. Bunion Kirsten A. McKinney University of Richmond, [email protected] Follow this and additional works at: http://scholarship.richmond.edu/student-publications Part of the Graphic Design Commons, Illustration Commons, and the United States History Commons This is a pre-publication author manuscript of the final, published article. Recommended Citation McKinney, Kirsten A., "The akW ing Life of Winsor McCay: Social Commentary in A Pilgrim’s Progress by Mr. Bunion" (2015). Student Publications. 1. http://scholarship.richmond.edu/student-publications/1 This Post-print Article is brought to you for free and open access by the Student Research at UR Scholarship Repository. It has been accepted for inclusion in Student Publications by an authorized administrator of UR Scholarship Repository. For more information, please contact [email protected]. The Waking Life of Winsor McCay: Social Commentary in A Pilgrim’s Progress by Mr. Bunion By Kirsten A. McKinney ABSTRACT This article suggests that comic scholars and historians of American culture take a closer look at Winsor McCay’s A Pilgrim’s Progress by Mister Bunion. Known as the father of animation and the artistic virtuoso behind the classic children’s comic Little Nemo in Slumberland, McCay actually did most of his comic work for adults. Published in the daily The New York Evening Telegram, McCay’s adult works included Dream of the Rarebit Fiend (1904-1911), A Pilgrim’s Progress by Mr. Bunion (1905-1909) and Poor Jake (1909-1911). -

Spring Rights Guide 2021
Spring 2021 CONTENTS PFD FICTION 4 PFD NON-FICTION 24 DGA FICTION 73 DGA NON-FICTION 77 CONTACT 83 PFD FICTION FICTION LILY Rose Tremain ‘One of our most accomplished novelists' Observer “Nobody but she knows that her dream of death is a rehearsal for what will surely happen to her one day. Nobody knows yet that she is a murderer. She is seen as an innocent girl. In one month’s time she will be seventeen.” Foundling, rebel, angel, murderer. At the gates of a park in Bethnal Green in east London, in the year 1850, an abandoned baby is almost eaten by wolves. She is rescued by a young constable, who holds Agent: Caroline Michel the life of this child in his hands, and feels inexplicably drawn to her. Publisher: Chatto & Windus He takes her to The London Foundling Hospital, and Lily Editor: Clara Farmer is placed in foster care at the idyllic Rookery Farm, where she has the happiest of childhood’s, with her beloved Publication: November 2021 foster-mother Nellie. Until one rainy October day Lily is told the chilling news: ‘You’re going to a different place Page extent: 288 now, the place where the other children went, and you must not cry about it’. Rights sold: French (J Clattes) Lily’s a story of bravery, of resilience, of the darkness that German (Suhrkamp) lies within humanity- but also of its warmth. Lily is Italian (Einaudi) staggeringly real, she’s a character who grabs at your heart Russian (Eksmo) from the very first page and refuses to let go. -

Winsor Mccay, George Randolph Chester, and the Tale of the Jungle Imps
American Periodicals, 2007, v17, n2, pages 245-259. ISSN: (print 1054-7479), (online 1548-4238) http://muse.jhu.edu/journals/amp/ http://muse.jhu.edu/journals/american_periodicals/v017/17.2robb.html © 2007 The Ohio State University Press WINSOR MCCAY, GEORGE RANDOLPH CHESTER, AND THE TALE OF THE JUNGLE IMPS Jenny E. Robb In 2006 Lucy Shelton Caswell, the curator of the Ohio State University Cartoon Research Library, received a call from a local businesswoman who wanted to bring in some old cartoon drawings that she had found. The Library does not provide appraisal or authentication services, so Caswell attempted to direct her elsewhere. The woman was very persistent, however, so Caswell agreed to see her the next day. The woman walked in with a shabby, portfolio-sized cardboard box from which she produced eleven large hand-colored drawings that Caswell was astonished to discover were original comic strips by Winsor McCay. McCay is considered one of the greatest comic strip artists of all time, a master and pioneer of the art form. Caswell was particularly surprised, because these drawings were from McCay‟s very first newspaper comic strip series, A Tale of the Jungle Imps. Until then, no Jungle Imps originals were known to have survived from an era when comics were considered ephemera: something to be enjoyed today and then discarded tomorrow. For the most part, original comic strips were not collected or preserved by museums, libraries or collectors, and although some artists saved their originals, most were destroyed or disappeared. Somehow these eleven had survived and had found their way to the Cartoon Research Library. -

UC Irvine UC Irvine Electronic Theses and Dissertations
UC Irvine UC Irvine Electronic Theses and Dissertations Title The Adolescent in American Print and Comics Permalink https://escholarship.org/uc/item/4h64k2t2 Author Mugnolo, Christine Elizabeth Publication Date 2021 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE The Adolescent in American Print and Comics DISSERTATION submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in Visual Studies by Christine Elizabeth Mugnolo Dissertation Committee: Professor Cécile Whiting, Chair Professor Kristen Hatch Professor Lyle Massey 2021 © 2021 Christine Elizabeth Mugnolo TABLE OF CONTENTS Page LIST OF FIGURES iv ACKNOWLEDGEMENTS x VITA xii ABSTRACT OF THE DISSERTATION xiii CHAPTER 1: INTRODUCTION 1 CHAPTER 2: THE IMMIGRANT JUVENILE AS URBAN AVATAR: 30 SUNDAY COMICS AND THE YELLOW KID The Sunday Supplement vs. the Comic Weekly 32 Bad Boy Comic Strips 50 The Yellow Kid and the Residents of Hogan’s Alley 56 The Return Gaze and a New Form of Political Humor 65 The Yellow Kid as Mask and Mirror 79 CHAPTER 3: THE MIDDLE-CLASS JUVENILE AS CULTURAL IDIOT: BUSTER BROWN 95 Reform in Comics and Buster Brown 96 Buster Brown Breaks the Comic Strip Formula 99 Buster and Middle-Class Child Rearing 109 “Resolved!” 115 Spank as Shock 121 CHAPTER 4: THE ADOLESCENT BODY IN THE AMERICAN IMAGINATION, 130 PAINTING, AND PRINT Formulating the Adolescent as a Visual Type 132 The Adolescent Body and the Masculine Ideal 138 Adolescence -

Martin Bormann
MARTIN BORMANN NAZI IN EXILE By Paul Manning To my wife, Peg, and to our four sons, Peter, Paul, Gerald and John, whose collective encouragement and belief in this book as a work of historic impor- tance gave me the necessary persistence [FACSIMILE ELECTRONIC EDITION 2005] and determination to keep going. First edition Copyright © 1981 by Paul Manning All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form except by a newspaper or magazine reviewer who wishes to quote brief passages in connection with a review. Queries regarding rights and permissions should be addressed to: Lyle Stuart Inc., 120 Enterprise Ave., Secaucus, N. J. 07094 Published by Lyle Stuart Inc. Published simultaneously in Canada by Musson Book Company, a division of General Publishing Co. Limited, Don Mills, Ont. Manufactured in the United States of America Library of Congress Cataloging in Publication Data Manning, Paul. Martin Bormann, Nazi in exile. Includes index. 1. Bormann, Martin, 1900-1943[?]. 2. National socialism—Biography. 3. War criminals—Germany— Biography. I. Title. DD247.B65M36 943.086'092'4 [B] 81-5696 ISBN 0-8184-0309-8 AACR2 ACKNOWLEDGMENTS To Allen W. Dulles, for his encouragement and assurance that I was “on the right track, and should keep going,” after reading my German research notes in preparation for this book, during the afternoons we talked in his house on Q Street in Washington, D.C. To Robert W. Wolfe, director of the Modern Military Branch of the National Archives in Washington, his associate John E. Taylor, and George Chalou, supervisor of archivists in the Suitland, Maryland, branch of the National Archives, whose collective assistance in my search for telling documents from both sides of World War II contributed substantially to the his- torical merits of this book. -

Impression and Expression : Rethinking the Animated Image Through Winsor Mccay by Daniel Mckenna
Impression and Expression : Rethinking the Animated Image Through Winsor McCay by Daniel McKenna n July of 1927, Winsor McCay held a private exhibition of his animated works, during which he told his audience, according to a New York Times reviewer, that I“the art of animated cartoons had not progressed, and that its possibilities were unlimited”.1 McCay’s contentious statement dismissed contemporaries such as John Randolph Bray and Max Fleischer, who had pioneered the industrialization of the animated film and whose early successes paved the way for Disney’s eventual domination of the film industry. American cartoons circulated freely in mainstream venues on both sides of the Atlantic, while lively formal experiments in animation were undertaken by thriving European avant-garde movements. Considering the popularity and diversity of animation at the time, one must wonder exactly what McCay wished the animated image to progress towards, and what possibilities he longed for it to explore. Interestingly, an examination of his work reveals that McCay might have stumbled upon the answer almost two decades earlier in his first film, Little Nemo (1911), when an animated figure springs to life from the page on which he is drawn, exclaiming, “Watch me move!” Though film scholarship has traditionally marginalized animation, it has emerged in the digital age as a way of highlighting a decline of photochemical technology in cinema. The moving image has a tendency to be defined by the technology which produces it. For instance, to speak of a digitally animated production as a “film” in the familiar sense is perhaps a fallacy, as these productions do not use celluloid or the analog film camera, but the label persists, stemming from a history of defining cinema through photochemical technologies. -
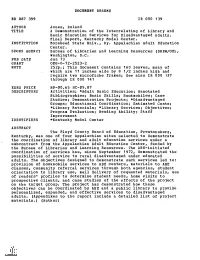
A Demonstration of the Interrelating of Library and Basic Education Services for Disadvantaged Adults
DOCUMENT RESUME ED 087 399 IR 000 139 AUTHOR Jones, Roland TITLE A Demonstration of the Interrelating of Library and Basic Education Services for Disadvantaged Adults. Final Report, Kentucky Model Center. INSTITUTION Morehead State Univ., Ky. Appalachian Adult Education Center. SPONS AGENCY Bureau of Libraries and Learning Resources (DREW /OE), Washington, D.C. PUB DATE Jun 73 GRANT OEG-0-72-2523-2 NOTE 252p.; This document contains 160 leaves, many of which are 11 inches wide by 8 1/2 inches high and require two microfiche frames; See also IR 000 137 through IR 000 141 EDRS PRICE MF-$0.65 HC-$9.87 DESCRIPTORS Activities; *Adult Basic Education; Annotated Bibliographies; Basic Skills; Bookmobiles; Case Studies; Demonstration Projects; *Disadvantaged Groups; Educational Coordination; Estimated Costs; *Library Materials; *Library Services; ObjectiVes; Program Evaluation; Reading Ability; Staff Improvement IDENTIFIERS *Kentucky Model Center ABSTRACT The Floyd County Board of Education, Prestonsburg, Kentucky, was one of four Appalachian sites selected to demonstrate the coordination of library and adult education services under a subcontract from the Appalachian Adult Education Center, funded by the Bureau of Libraries and Learning Resources. The ABE-initiated coordination of services has, since September 1972, demonstrated the possibilities of service to rural disadvantaged under educated adults. The objectives designed to demonstrate such services led to: provision of bookmobile services to ABE centers, materials to ABE classes, community referral services through both agencies, student orientation to library use, mail delivery of requested materials, use of readers' profiles to determine student needs, home visits to prospective clients, and case studies of the effects of the project on the target group. -

Screen, Simulation, Situation: an Archaeology of Early Film Animation, 1908-1921
Screen, Simulation, Situation: An Archaeology of Early Film Animation, 1908-1921. by Daniel McKenna A thesis submitted to the Faculty of Graduate and Postdoctoral Affairs in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Film Studies Carleton University Ottawa, Ontario © 2014 Daniel McKenna Abstract Recent film scholarship has turned to the kinetic element of cinema as a way of bridging analog and digital practice, often latching on to animation as the vehicle for describing this relationship. This study thus explores the origins of animation in cinema from 1908-1921 in an attempt to construct a meaningful connection between old and new animated media. Two filmmakers in particular pioneered the first animated films at this time: Winsor McCay and Emile Cohl. These graphic artists illustrated the ability of the animated image, even in its most nascent stages in film history, to negotiate a personalized expression of reality through a myriad of technological and sociocultural shifts which threatened to efface their artistry. Positioned between contemporary and archaic forms of animated media, their work functions as a paradigm of how to understand the animated image through the three cinematic components of screen, simulation, and situation. ii Table of Contents Abstract...................................................................................................................... ii Table of Contents ..................................................................................................... -

Great, Mad, New. Populärkultur, Serielle Ästhetik Und Der Frühe Amerikanische Zeitungscomic FRANK KELLETER & DANIEL STEIN 81
Stephan Ditschke, Katerina Kroucheva, Daniel Stein (Hg.) Comics 2009-08-10 09-20-36 --- Projekt: transcript.titeleien / Dokument: FAX ID 02be217789522662|(S. 1 ) T00_01 schmutztitel - 1119.p 217789522670 2009-08-10 09-20-36 --- Projekt: transcript.titeleien / Dokument: FAX ID 02be217789522662|(S. 2 ) T00_02 seite 2 - 1119.p 217789522790 Stephan Ditschke, Katerina Kroucheva, Daniel Stein (Hg.) Comics. Zur Geschichte und Theorie eines populärkulturellen Mediums 2009-08-10 09-20-37 --- Projekt: transcript.titeleien / Dokument: FAX ID 02be217789522662|(S. 3 ) T00_03 titel - 1119.p 217789522822 Gedruckt mit Hilfe der Geschwister Boehringer Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften in Ingelheim am Rhein. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © 2009 transcript Verlag, Bielefeld Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen. Umschlaggestaltung: Kordula Röckenhaus, Bielefeld Umschlagabbildung: Vorderseite: © Anjin Anhut; Rückseite: Ben Shahn »Greenwich Village (New York City)«, 1935, Harvard Art Museum, Fogg Art Museum, Gift of Bernarda Bryson Shahn, P1970.2771, © Imaging Department President and Fellows of Harvard College Lektorat & Satz: Stephan Ditschke, Katerina Kroucheva, Daniel Stein Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar ISBN 978-3-8376-1119-9 Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Besuchen Sie uns im Internet: http://www.transcript-verlag.de Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis und andere Broschüren an unter: [email protected] 2009-08-10 09-20-37 --- Projekt: transcript.titeleien / Dokument: FAX ID 02be217789522662|(S. -
Len Deighton, Funeral in Berlin
Len Deighton Funeral in Berlin ALLEN W. DULLES (then director C. I. A.): 'You, Mr Chairman, may have seen some of my intelligence reports from time to time?' MR KHRUSHCHEV: 'I believe we get the same reports - and probably from the same people?' MR DULLES: 'Maybe we should pool our efforts?' MR KHRUSHCHEV:'Yes. We should buy our intelligence data together and save money. We'd have to pay the people only once?' --News item, September 1959 'But what good came of it at last?' Quoth little Peterkin. "Why, that I cannot tell' said he:--'But 'twas a famous victory.' --SOUTHEY, After Blenheim 'If I am right the Germans will say I was a German and the French will say I was a Jew; if I am wrong the Germans will say I was a Jew and the French will say I was a German.' --ALBERT EINSTEIN Most of the people who engaged in this unsavoury work had very little interest in the cause which they were paid to promote. They did not take their parts too seriously, and one or the other would occasionally go over to the opposite side, for espionage is an international and artistic profession, in which opinions matter less than the art of perfidy. --DR R. LEWINSOHN, The Career of Sir Basil Zaharoff Players move alternately - only one at a time. CHAPTER 1 Saturday, October 5th IT was one of those artificially hot days that they used to call 'Indian summer'. It was no time to be paying a call to Bina Gardens, in south-west London, if there was a time for it. -

Download Ebook « Little Sammy Sneeze (Hardback
PY3N0QQWVUIE PDF > Little Sammy Sneeze (Hardback) Little Sammy Sneeze (Hardback) Filesize: 6.69 MB Reviews This created ebook is wonderful. I am quite late in start reading this one, but better then never. You may like the way the author compose this pdf. (Frederic Lang) DISCLAIMER | DMCA SNEIRLJQM45Z ^ Doc # Little Sammy Sneeze (Hardback) LITTLE SAMMY SNEEZE (HARDBACK) To download Little Sammy Sneeze (Hardback) PDF, make sure you access the web link listed below and download the file or get access to other information which are highly relevant to LITTLE SAMMY SNEEZE (HARDBACK) book. Sunday Press (CA), 2007. Hardback. Condition: New. Language: English . Brand New Book. Before his magnificent Little Nemo, Winsor McCay created two unique Sunday comics also starring young children: Little Sammy Sneeze and Hungry Henrietta. Sunday Press Books, publisher of the award- winning Little Nemo- Splendid Sundays, presents both of these historic and fascinating comic strips in one volume, featuring the complete color Sammy Sneeze (1904-1905) and the complete 27-episode run of Hungry Henrietta, all printed in their original size and colors. Most pages have never been reprinted! Little Sammy Sneeze presents a unique concept in classic comics reprints, where the back of each Sammy page features a strip that appeared on the back in the original Sunday comic section of the New York Herald. In 1905 that strip was Hungry Henrietta, but pages from 1904 showcase the unique Upside Downs by Gustav Verbeek, and the unknown nonsense masterpiece, The Woozlebeasts. Read Little Sammy Sneeze (Hardback) Online Download PDF Little Sammy Sneeze (Hardback) YRADQWKQWQGA ~ Doc \ Little Sammy Sneeze (Hardback) Other Books [PDF] Educating Young Children : Active Learning Practices for Preschool and Child Care Programs Click the link listed below to get "Educating Young Children : Active Learning Practices for Preschool and Child Care Programs" PDF document.