Lied Und Populäre Kultur 65.2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
35. Göttinger
35. göttinger 4.–11.11.12 Bild: Renate Bethmann Bild: Renate jazz_programm_2012End_.indd 1 08.08.12 17:19 Anlagelösungen mit individueller Ausstattung. Deka-Vermögenskonzept. Konfigurieren Sie Ihr Anlagemodell nach Ihren persönlichen Wünschen und genießen Sie exzellenten Service. Unser professionelles Vermögens- management sorgt für eine gute Fahrt. Jetzt in Ihrer DekaBank Deutsche Girozentrale, DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. www.deka.de jazz_programm_2012End_.indd 2 08.08.12 17:19 Editorial ie Vielseitigkeit und Aktualität des Jazz präsentieren auch in die- sem Jahr über 200 internationale, nationale und lokale Musikerinnen Dund Musiker in 34 Einzelveranstaltungen und Konzerten an den sie- ben Tagen des 35. Göttinger Jazzfestivals. Das Programm bietet nicht nur eine Reihe von erstklassigen Künstlern und Ensembles, sondern auch die Möglichkeit, verschiedene musikalische Ansätze im direkten Vergleich zu er- leben: Mit Kenny Garrett und Roy Hargrove stehen an zwei Abenden zwei große Amerikaner und einstige „Young Lions“ auf der Bühne, die sich sehr individuell mit der Hardbop-Jazztradition auseinandersetzen. Und mit den gleichermaßen ECHO-ausgezeichneten Gruppen Tingvall Trio und Michael Wollny’s [em] gelang es zwei junge, weg- weisende Piano-Trios mit ganz unter- schiedlicher Programmatik zu gewinnen. Wir danken Das Programm auf der Hauptbühne des allen mitwirkenden Deutschen Theaters wird abgerundet Musikerinnen und Musikern durch zwei grenzüberschreitende Acts: unseren Förderern und Sponsoren die Jazz-Metal-Band Panzerballett und die Stadt Göttingen, Norddeutscher portugiesische Ausnahmesängerin Maria Rundfunk – Musikförderung in João. Schon zuvor sind im Film der franzö- Niedersachsen, Landschaftsverband Südniedersachsen, Sparkasse sische Jazzpianist Michel Petrucciani, im Göttingen Gespräch der Jazzpublizist Karl Lippegaus unseren Kooperationspartnern und im Konzert die Jinling Dragon World Deutsches Theater, Lumière, Literarisches Zentrum, Musa, Basta Music Band aus Nanjing kennenzulernen. -

Tenor Saxophone Mouthpiece When
MAY 2014 U.K. £3.50 DOWNBEAT.COM MAY 2014 VOLUME 81 / NUMBER 5 President Kevin Maher Publisher Frank Alkyer Editor Bobby Reed Associate Editor Davis Inman Contributing Editors Ed Enright Kathleen Costanza Art Director LoriAnne Nelson Contributing Designer Ara Tirado Bookkeeper Margaret Stevens Circulation Manager Sue Mahal Circulation Assistant Evelyn Oakes ADVERTISING SALES Record Companies & Schools Jennifer Ruban-Gentile 630-941-2030 [email protected] Musical Instruments & East Coast Schools Ritche Deraney 201-445-6260 [email protected] Advertising Sales Associate Pete Fenech 630-941-2030 [email protected] OFFICES 102 N. Haven Road, Elmhurst, IL 60126–2970 630-941-2030 / Fax: 630-941-3210 http://downbeat.com [email protected] CUSTOMER SERVICE 877-904-5299 / [email protected] CONTRIBUTORS Senior Contributors: Michael Bourne, Aaron Cohen, John McDonough Atlanta: Jon Ross; Austin: Kevin Whitehead; Boston: Fred Bouchard, Frank- John Hadley; Chicago: John Corbett, Alain Drouot, Michael Jackson, Peter Margasak, Bill Meyer, Mitch Myers, Paul Natkin, Howard Reich; Denver: Norman Provizer; Indiana: Mark Sheldon; Iowa: Will Smith; Los Angeles: Earl Gibson, Todd Jenkins, Kirk Silsbee, Chris Walker, Joe Woodard; Michigan: John Ephland; Minneapolis: Robin James; Nashville: Bob Doerschuk; New Orleans: Erika Goldring, David Kunian, Jennifer Odell; New York: Alan Bergman, Herb Boyd, Bill Douthart, Ira Gitler, Eugene Gologursky, Norm Harris, D.D. Jackson, Jimmy Katz, Jim Macnie, Ken Micallef, Dan Ouellette, Ted Panken, Richard Seidel, Tom Staudter, -

Zakir Hussain & Masters of Percussion
CAL PERFORMANCES PRESENTS Sunday, March 23, 2014, 7pm Zellerbach Hall Zakir Hussain & Masters of Percussion with Zakir Hussain tabla Selvaganesh Vinayakram kanjira & ghatam Steve Smith Western drums Niladri Kumar sitar Dilshad Khan sarangi Deepak Bhatt dhol Vijay Chavan dholki and special guest Antonia Minnecola Kathak dancer PROGRAM Tonight’s program will be announced from the stage. There will be one intermission. Cal Performances’ – season is sponsored by Wells Fargo. PLAYBILL ABOUT THE ARTISTS The foremost disciple of his father, the leg- endary Ustad Allarakha, Mr. Hussain was a child prodigy who began his professional career at the age of twelve and had toured internation- ally with great success by the age of 18. He has been the recipient of many awards, grants and honors, including Padma Bhushan (2002), Padma Shri (1988), the Sangeet Natak Akademi Award (1991), Kalidas Samman (2006), the 1999 National Heritage Fellowship Award, the Bay Area Isadora Duncan Award (1998–1999), and Grammy Awards in 1991 and 2009 for Best World Music Album for Planet Drum and Global Drum Project, both collaborations with Mickey Hart. His music and extraordinary con- tribution to the music world were honored in April 2009, with four widely heralded and sold- out concerts in Carnegie Hall’s “Perspectives” series. Also in 2009, Mr. Hussain was named a Susana Millman Susana Member in the Order of Arts and Letters by AKIR HUSSAIN (tabla) is today appreciated France’s Ministry of Culture and Commun - Zboth in the field of percussion and in the ication. Most recently, the National Symphony music world at large as an international phe- Orchestra with Christoph Eschenbach com- nomenon. -

One Page Oregon Biography
O R E G O N B I O G R A P H Y Without a doubt O R E G O N is one of the finest groups l a t e r, O R E G O N moved to Elektra/Asylum Records. Its ever to paint a musical landscape of such global first release on that label, Out of the Woods, r e a c h e d proportions. For three decades O R E G O N has inspired a decidedly wider audience and was included in the 101 audiences in renowned concert halls including Best Jazz Albums list. They were enjoying imm e n s e Carnegie Hall, Lincoln Center, Berlin Philharmonic popularity when in November 1984, Walcott died in an H a l l, and Vienna’s Mozartsaal; in international jazz auto accident in the former East Germany, leaving the clubs and at major festivals on tour throughout ECM album C r o s s i n g as his final document. Over the every continent. next five years, percussionist Trilok Gurtu played on three albums with the band. Upon his departure the three original members continued their creative development as a trio. For the 1996 Intuition recording Northwest Passage, the group incorporated drummer MARK WALKER on the Indie Award winning record. He soon after became their newest member. In June 1999 the band traveled to Moscow to record the double CD O R E G O N I N M O S C O W for I n t u i t i o n. -

Paolo Fresu, Omar Sosa, Trilok Gurtu
Paolo Fresu, Omar Sosa, Trilok Gurtu Three unique and distinctive musical voices unite for a special Trio project, combining traditional and progressive musical elements from India, Italy, and Cuba. All three are master musicians with illustrious careers, virtuosi in their own rights, with penchants for expanding musical boundaries and exploring new cultures. All three are dazzling performers, seeking inspiration and challenge from each other, and seeking to share this with audiences. Enjoy the ride! Paolo Fresu Winner of a wide array of awards, professor, and director of various Italian and international institutions, Paolo Fresu has performed around the world with the most important names of Afro-American music over the past 30 years. He has participated in nearly 300 recordings, some as a leader, others as a sideman, and still other projects mixing ethnic, jazz, world music, contemporary, and ancient musics. Mr. Fresu is artistic director of the Berchidda Festival Time In Jazz, Bergamo Jazz, and the Jazz Seminars in Nuoro (Sardinia). He is also involved in the production of numerous multimedia projects, cooperating with actors, dancers, painters, sculptors, and poets, as well as writing music for film, documentary, video, ballet, and theater pieces. Mr. Fresu lives between Paris, Bologna and Sardinia. His unique trumpet sound is recognized as one of the most distinctive in the contemporary jazz scene. Omar Sosa Three-time GRAMMY-nominated Cuban composer and pianist Omar Sosa’s musical trajectory has taken him from Camagüey and Havana to touring in Angola, the Congo, Ethiopia, and Nicaragua in the 1980s; to a sojourn in the African-descent communities of Ecuador in the early 1990s; to an extended presence on the San Francisco Bay Area Latin jazz scene; to his current engagement with artists from Spain, France, Brazil, Cuba, the United States, and several North, West, and East African nations. -
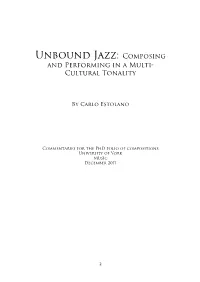
Unbound Jazz: Composing and Performing in a Multi- Cultural Tonality
Unbound Jazz: Composing and Performing in a Multi- Cultural Tonality By Carlo Estolano Commentaries for the PhD folio of compositions University of York Music December 2017 2 3 Unbound Jazz: Composing and Performing in a Multi-Cultural Tonality Thesis submitted in partial fulfilment of a PhD degree in Music at The University of York, December 2018 by Carlo Estolano. Abstract This folio is conceived to propose and demonstrate music realisation of original compositions throughout the employment of elements of mainly two distinct sources: a selection from the wide palette of Brazilian folk styles that have improvisation as a strong element, which is internationally acknowledged as Brazilian Jazz; and its intersections with a certain style of European Jazz represented by artists notable by their keenness to combine elements from distinct musical genres with their Classical background, such as Ralph Towner, Jan Garbarek, John Abercrombie, Eberhard Weber, Kenny Wheeler, Terje Rypdal, Keith Jarrett to name a few. Both Brazilian and European approaches to Jazz seem to share processes of appropriation of foreign musical languages, as well as utilising characteristic features of their own traditions. Another common ground is their relation with some elements and procedures of classical music. The methodology to accomplish an organized collection of musical material was to divide them in five major influences, part of them by composers and part by genres notable by having evolved through absorbing elements from distinct cultural sources. In five projects, fifteen original compositions are provided along with their recorded and/or filmed performances and commentaries about the compositional aspects, concerningthe style or composer focused on. -

Monterey Jazz Festival
DECEMBER 2018 VOLUME 85 / NUMBER 12 President Kevin Maher Publisher Frank Alkyer Editor Bobby Reed Reviews Editor Dave Cantor Contributing Editor Ed Enright Creative Director ŽanetaÎuntová Assistant to the Publisher Sue Mahal Bookkeeper Evelyn Oakes ADVERTISING SALES Record Companies & Schools Jennifer Ruban-Gentile Vice President of Sales 630-359-9345 [email protected] Musical Instruments & East Coast Schools Ritche Deraney Vice President of Sales 201-445-6260 [email protected] Advertising Sales Associate Grace Blackford 630-359-9358 [email protected] OFFICES 102 N. Haven Road, Elmhurst, IL 60126–2970 630-941-2030 / Fax: 630-941-3210 http://downbeat.com [email protected] CUSTOMER SERVICE 877-904-5299 / [email protected] CONTRIBUTORS Senior Contributors: Michael Bourne, Aaron Cohen, Howard Mandel, John McDonough Atlanta: Jon Ross; Austin: Kevin Whitehead; Boston: Fred Bouchard, Frank- John Hadley; Chicago: John Corbett, Alain Drouot, Michael Jackson, Peter Margasak, Bill Meyer, Mitch Myers, Paul Natkin, Howard Reich; Denver: Norman Provizer; Indiana: Mark Sheldon; Iowa: Will Smith; Los Angeles: Earl Gibson, Todd Jenkins, Kirk Silsbee, Chris Walker, Joe Woodard; Michigan: John Ephland; Minneapolis: Robin James; Nashville: Bob Doerschuk; New Orleans: Erika Goldring, David Kunian, Jennifer Odell; New York: Alan Bergman, Herb Boyd, Bill Douthart, Ira Gitler, Eugene Gologursky, Norm Harris, D.D. Jackson, Jimmy Katz, Jim Macnie, Ken Micallef, Dan Ouellette, Ted Panken, Richard Seidel, Tom Staudter, Jack Vartoogian, Michael Weintrob; -

Jazzandmore-1993-2017.Qxp Layout 1
JAZZ AND MORE Ein fotografischer Rückblick von Reinhard Dorn & Christian Pacher IMPRESSUM Diese Publikation erscheint zum 25-jährigen Jubiläum der Reihe „Jazz and More“ im Bürgerhaus/diagonal., Ingolstadt © 2017 Reinhard Dorn Satz und Gestaltung: Reinhard Dorn Fotografie: Christian Pacher: S. 6: (1,2,3,4) • S. 10: (2) • S. 12: (3,4) • S.13 S. 18 (2) • S. 21 (1) • S. 22 (2) • S. 24 (1,2) • S. 25 • S. 27 • S. 34 (1,2,3) S. 35 • S. 37 • S. 48 (2) • S. 50 (2) • S. 52 (3) • S. 53 • S. 54 (2) S. 56 (2) • S. 57 • S. 58 (1,2) • S. 62 (1,2,3) • S. 63 • S.64 (1) • S. 68 (1,2) Reinhard Dorn: alle anderen Aufnahmen Kontaktadressen: Bürgerhaus Ingolstadt Kreuzstraße 12, 85049 Ingolstadt Tel. 08 41/305 28 00, Fax 08 41/305 28 09 [email protected] www.buergerhaus-ingolstadt.de Jan Rottau/KaRo Music Rankestraße 9, 85049 Ingolstadt [email protected] Christian Pacher Münchener Str. 99, 85051 Ingolstadt Tel. 08 41/7 21 90 [email protected] Reinhard Dorn Gymnasiumstraße 6, 85049 Ingolstadt Tel. 08 41/3 70 76 37 [email protected] Veranstalter Kreuzstr. 12 • Ingolstadt • Tel. 08 41/3052800 Die Reihe wird gefördert von: Unterstützt durch: 2 1993 – 2017 JAZZ AND MORE Bürgerhaus|diagonal. Club Concerts Einleitung ............................................................ 4 1993 ................................................................ 6 1994 ................................................................ 10 John Scofield im Interview – März 1994 ................................ 14 Joe Zawinul im Interview – November 1994 ........................... -

Dominican Republic Jazz Festival @ 20
NOVEMBER 2016 VOLUME 83 / NUMBER 11 President Kevin Maher Publisher Frank Alkyer Editor Bobby Reed Managing Editor Brian Zimmerman Contributing Editor Ed Enright Creative Director ŽanetaÎuntová Design Assistant Markus Stuckey Circulation Manager Kevin R. Maher Assistant to the Publisher Sue Mahal Bookkeeper Evelyn Oakes Editorial Intern Izzy Yellen ADVERTISING SALES Record Companies & Schools Jennifer Ruban-Gentile 630-941-2030 [email protected] Musical Instruments & East Coast Schools Ritche Deraney 201-445-6260 [email protected] OFFICES 102 N. Haven Road, Elmhurst, IL 60126–2970 630-941-2030 / Fax: 630-941-3210 http://downbeat.com [email protected] CUSTOMER SERVICE 877-904-5299 / [email protected] CONTRIBUTORS Senior Contributors: Michael Bourne, Aaron Cohen, Howard Mandel, John McDonough Atlanta: Jon Ross; Austin: Kevin Whitehead; Boston: Fred Bouchard, Frank- John Hadley; Chicago: John Corbett, Alain Drouot, Michael Jackson, Peter Margasak, Bill Meyer, Mitch Myers, Paul Natkin, Howard Reich; Denver: Norman Provizer; Indiana: Mark Sheldon; Iowa: Will Smith; Los Angeles: Earl Gibson, Todd Jenkins, Kirk Silsbee, Chris Walker, Joe Woodard; Michigan: John Ephland; Minneapolis: Robin James; Nashville: Bob Doerschuk; New Orleans: Erika Goldring, David Kunian, Jennifer Odell; New York: Alan Bergman, Herb Boyd, Bill Douthart, Ira Gitler, Eugene Gologursky, Norm Harris, D.D. Jackson, Jimmy Katz, Jim Macnie, Ken Micallef, Dan Ouellette, Ted Panken, Richard Seidel, Tom Staudter, Jack Vartoogian, Michael Weintrob; North Carolina: Robin -
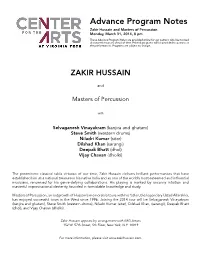
Advance Program Notes Zakir Hussain and Masters of Percussion Monday, March 31, 2014, 8 Pm
Advance Program Notes Zakir Hussain and Masters of Percussion Monday, March 31, 2014, 8 pm These Advance Program Notes are provided online for our patrons who like to read about performances ahead of time. Printed programs will be provided to patrons at the performances. Programs are subject to change. ZAKIR HUSSAIN and Masters of Percussion with Selvaganesh Vinayakram (kanjira and ghatam) Steve Smith (western drums) Niladri Kumar (sitar) Dilshad Khan (sarangi) Deepak Bhatt (dhol) Vijay Chavan (dholki) The preeminent classical tabla virtuoso of our time, Zakir Hussain delivers brilliant performances that have established him as a national treasure in his native India and as one of the world’s most esteemed and influential musicians, renowned for his genre-defying collaborations. His playing is marked by uncanny intuition and masterful improvisational dexterity, founded in formidable knowledge and study. Masters of Percussion, an outgrowth of Hussain’s memorable tours with his father, the legendary Ustad Allarakha, has enjoyed successful tours in the West since 1996. Joining the 2014 tour will be Selvaganesh Vinayakram (kanjira and ghatam), Steve Smith (western drums), Niladri Kumar (sitar), Dilshad Khan, (sarangi), Deepak Bhatt (dhol), and Vijay Chavan (dholki). Zakir Hussain appears by arrangement with IMG Artists 152 W. 57th Street, 5th Floor, New York, N.Y. 10019 For more information, please visit www.zakirhussain.com. Artist Biographies Zakir Hussain Zakir Hussain is appreciated both in the field of percussion and in the music world at large as an international phenomenon. A classical tabla virtuoso of the highest order, his consistently brilliant and exciting performances have not only established him as a national treasure in his own country, India, but gained him worldwide fame. -

Page 1 N E W R E L E a S E
NEW RELEASE O N I N T U I T I O N R E C O R D S R E C E I V E D 4 G R A M M Y N O M I N A T I O N S OREGON’s latest project, Oregon In Moscow, is a double CD with the Moscow Tchaikovsky Symphony Orchestra, and the group’s recorded debut of their orchestral repertoire—a prodigious body of work that has been developing over the life of the band, but never documented. In the thirty-year history of OREGON, there has always existed a strong kinship to orchestral music. The use of the double reeds alone has given the quartet an identity and expansive sound associated with the symphonic orchestra. This association isn’t confined only to their use of many orchestral instruments, but applies also to the composition and presentation of the music, including the careful attention to details such as articulation, dynamics, phrasing and tone production derived from their respective classical studies. Chief composer Ralph Towner explains, “OREGON came together as a group in New York City in 1970, and from the outset it was clear that our unusual instrumentation and collective musical experience invited a different approach to composition and improvisation. The jazz tradition of improvisation usually consists of the soloists taking turns improvising on the song’s harmonic structure, recycling the chord progressions and returning to the original melody only on the last repeat of the cycle. While still using and honoring this tradition, we began composing longer, more sectional forms that allowed each soloist to improvise on different material within the context of a single piece. -

International Herald Tribune: Thursday, February 8, 1996, Page 20)
John McLaughlin All in the Family Crazy By Mike Zwerin (Reprinted from International Herald Tribune: Thursday, February 8, 1996, page 20) PARIS — One thing John McLaughlin likes about being a member of the family of jazz musicians is that you can be as loony as you want. Being nuts is accepted. It goes with the music. He’d much rather get loonier than wiser with age. It’s even expected. All the brothers and sisters out there know that it’s really that other great big “sane” world that’s crazy. McLaughlin’s new album, The Promise (Verve), is a visit down a long and winding Memory Lane. Recorded in Tokyo, Paris, Milan, New York, London and Wiltshire, England, and Monaco (where he lives), it recalls his electric and acoustic jazz, rock, organ trio and classical and Indian musical incarnations back to the ’60s. Although he might be called a guitar hero’s guitar hero, behind that rock star persona is a serious player who, despite temptation right and left, just wants to get it on. Playing with Miles Davis taught him the value of silence (In A Silent Way). But his breakneck heroics do not put him in a position to advise young guitarists to play slower. He tries to overwhelm guitar players, he won’t deny it. Unlike competition between corporations and athletes, however, nobody loses here. It’s a matter of being worthy of the family. He remembers knocking on Davis’ dressing room door one sweaty, stomping Saturday night in New York. “John!” The trumpeter jumped up.