Die Sammlung Perthes Gotha – Vom Archiv Eines Verlages Zur Sammlung Einer Bibliothek
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

225 Jahre Atlanten & Kartographie Aus Gotha
225 Jahre Atlanten & Kartographie aus Gotha Vom historischen Stieler zum W 400381 (01/2010) Bildnachweis: Forschungsbibliothek, Gotha: S. 4, 5, 7, 11; kreaktor/karstenkoch.de, Hannover: 13, 14 modernen Haack Weltatlas. Kartennachweis: Forschungsbibliothek, Gotha: Titelbild, S. 3, 6, 8/9 ; PGM, 148 (2004/6): S. 2, 10/11; Haack Weltatlas, Gotha: S. 16 * 6 ct/Anruf, Fax im Festnetz T-Com, Mobilfunkpreise abweichend, eine Servicenummer der QSC AG Ernst Klett Verlag, Postfach 10 26 45, 70022 Stuttgart Telefon 01 80 · 2 55 38 82*, Telefax 01 80 · 2 55 38 83* www.klett.de 2|3 225 JAHRE ATLANTEN UND KARTOGRAPHIE AUS GOTHA Als die weißen Flecken Gestalt annahmen Sehr geehrte Damen und Herren, den Maßstab, die Himmelsrichtungen und das Konzept der Weltkarte haben einst die Babylonier entwickelt. Viele Wurzeln der modernen Kartographie liegen dagegen in Gotha. Plastische Geländedarstellungen, topographische Farben, Punktsignaturen – Elemente, die uns heute selbstverständlich erscheinen – entstanden einst im Gothaer Verlagshaus. Bereits im frühen 19. Jahrhundert spezialisierte sich der Verlag auf kartogra- phische Produkte. Sie begleiteten und visualisierten das Zeitalter der großen Entdeckungen, die Jahre, in denen sich das Wissen der Menschen über unseren Planeten präzisierte und ehemals weiße Flecken farbige Gestalt annahmen. Mit seinen Landkarten, Atlanten und Schulwandkarten erzielte der Verlag Justus Perthes Gotha zahlreiche Welterfolge. Auch heute konzentriert sich Klett-Perthes auf Atlanten und kartographische Produkte. Mit dem 2007 veröffentlichten neuen Haack Weltatlas führen wir die große Gothaer Kartographietradition ins 21. Jahrhundert. Kommen Sie mit uns auf eine Reise durch die traditionsreiche 225-jährige Geschichte unseres Hauses. Volker Streibel Programmbereichsleiter Klett-Perthes, Gotha Abbildung oben: Karte der Arktischen und Antarktischen Regionen von August Petermann aus dem Jahr 1865. -

Journalistic Cartography
ized course in cartography was offered on a regular ba- sis, a rarity at that time. During his career he published what he was to call “the six-six world map giving larger, better continents” (Jefferson 1930). This eliminated J much ocean, allowing larger landmasses, and became popular in the classroom. It is probable that Jefferson taught more than 10,000 Jefferson, Mark Sylvester William. Mark Sylvester students, of whom 80 percent became teachers who fur- William Jefferson was born the seventh child of Daniel ther spread the cartographic habit. Most distinguished and Mary Jefferson on 1 March 1863 in Melrose, Mas- among these students were Isaiah Bowman, R D Calkins, sachusetts. His father, a lover of literature, nurtured the Charles C. Colby, Darrell Haug Davis, William M. Greg- young Mark, who became a member of the class of 1884 ory, George J. Miller, and A. E. Parkins. Of these, Bow- at Boston University. Academic success led to his ap- man, Colby, and Parkins were elected to the presidency pointment (1883–86) as assistant to Benjamin Apthorp of the Association of American Geographers, an honor Gould, director and astronomer of the National Ob- accorded Jefferson in 1916. When Bowman became di- servatory of the Argentine Republic at Cordoba, mem- rector of the American Geographical Society in 1915, he bership in the Argentine Geographical Society (1885), corresponded vigorously with his former teacher, whom and management of a sugar estate in Tucuman Province he invited to head the 1:1,000,000-scale Hispanic map (1886–89). Jefferson returned to Massachusetts, taught project of the Society. -

Hopes, Hazards and a Haggle: Perthes' Ten Sheet “Karte Von Inner
International Symposium on “Old Worlds-New Worlds”: The History of Colonial Cartography 1750-1950 Utrecht University, Utrecht, The Netherlands, 21 to 23 August 2006 Working Group on the History of Colonial Cartography in the 19th and 20 th centuries International Cartographic Association (ICA-ACI) Hopes, Hazards and a Haggle: Perthes’ Ten Sheet “Karte von Inner-Afrika” Imre Josef Demhardt Privatdozent Dr. phil., Geographisches Institut der Technischen Universität Darmstadt [email protected] Abstract The rise to fame both of Petermanns Geographische Mitteilungen and its dynamic founding editor August Petermann justifiably is closest related to their contributions in unveiling the unknown interior of Africa. Against a background sketch of Petermann’s cartographical concept and working method this paper discusses a major map-series of the pre-colonial era jointly compiled with Bruno Hassenstein – the ten sheet “Karte von Inner-Afrika nach dem Stande der geographischen Kenntnis in den Jahren 1861 bis 1863”. Inaugurated as a guiding tool for the Deutsche Inner-Afrika Expedition (1861-62), propagated and organised by Petermann to salvage manuscripts of Eduard Vogel, who got lost in 1856 east of Lake Chad, however, the main purpose was to provide an up-to-date framework of all obtainable knowledge in the scale 1:2 millions supplemented by anticipated exclusive and extensive research exploration reports of the journal’s own expedition. Although the map-series remained a torso – the high hopes placed in the expedition failed with almost no cartographical gain due to inexperience and misfortune – it stands as arguably opus magnum of 19th century exploratory cartography of Central Africa drawing on many never before and never again constructed route itineraries. -

Chapter 11 Heinrich Berghaus's Map of Human Diseases
Chapter 11 Heinrich Berghaus's Map of Human Diseases JANE R CAMERINI The first major atlas ofworldwide thematic maps was completed in 1848, consisting of some 90 maps in two volumes. Created by Heinrich Berghaus at the Geographische Kunstschule in Potsdam, the Physikalischer Atlas (PhysicalAtlas) reflected the intense interest and activity in mapping a wide range of natural phenomena in the first part of the nineteenth century. The intent of this essay is to contextualize Berghaus's 1848 map of diseases, the earliest world map in an atlas showing the geographical distribution of epidemic and endemic human diseases (Figure 1).1 This world map of human diseases is a well-known landmark in the history of medical cartography, representing both a synthesis of the early period of medical mapping and a source from which popular and increasingly focused epidemiological maps developed.2 In situating the Berghaus disease map in the context of its makers and of the history of thematic cartography, I will argue that the map participated in a major shift in how natural phenomena were studied. This shift in conceptualizing and representing the natural world has been confounded with the notion of "Humboldtian science", and I hope to begin here to put Humboldt, Berghaus, and mid-nineteenth-century medical mapping in a larger perspective.3 In spite of the interest in place, climate, and disease dating back to the Hippocratic era (450-350 BC), the use of geographic maps to enhance the understanding of disease did not emerge until the late eighteenth century, with rapid development by Jane Camerini, Department of History of Science, University of Wisconsin, Madison, WI 53706, USA. -

Chapter 11 Heinrich Berghaus's Map of Human Diseases
Chapter 11 Heinrich Berghaus's Map of Human Diseases JANE R CAMERINI The first major atlas ofworldwide thematic maps was completed in 1848, consisting of some 90 maps in two volumes. Created by Heinrich Berghaus at the Geographische Kunstschule in Potsdam, the Physikalischer Atlas (PhysicalAtlas) reflected the intense interest and activity in mapping a wide range of natural phenomena in the first part of the nineteenth century. The intent of this essay is to contextualize Berghaus's 1848 map of diseases, the earliest world map in an atlas showing the geographical distribution of epidemic and endemic human diseases (Figure 1).1 This world map of human diseases is a well-known landmark in the history of medical cartography, representing both a synthesis of the early period of medical mapping and a source from which popular and increasingly focused epidemiological maps developed.2 In situating the Berghaus disease map in the context of its makers and of the history of thematic cartography, I will argue that the map participated in a major shift in how natural phenomena were studied. This shift in conceptualizing and representing the natural world has been confounded with the notion of "Humboldtian science", and I hope to begin here to put Humboldt, Berghaus, and mid-nineteenth-century medical mapping in a larger perspective.3 In spite of the interest in place, climate, and disease dating back to the Hippocratic era (450-350 BC), the use of geographic maps to enhance the understanding of disease did not emerge until the late eighteenth century, with rapid development by Jane Camerini, Department of History of Science, University of Wisconsin, Madison, WI 53706, USA. -
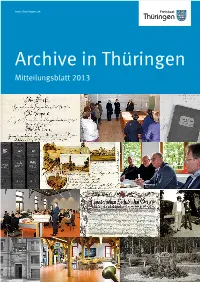
Archive in Thüringen
www.thueringen.de Archive in Thüringen Mitteilungsblatt 2013 Inhaltsverzeichnis Zum Stand der Langzeitarchivierung elektronischer Unterlagen in Thüringischen Beiträge Rudolf Benl Kommunalarchiven Das Schriftgut der „Deutschen Richard-Wetz- Björn Schmalz Gesellschaft“ im Stadtarchiv Erfurt 31 Björn Schmalz, Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Abteilung Magdeburg, Standort Wernigerode Zum Stand der Langzeitarchivierung elektronischer Steffen Arndt Unterlagen in Thüringischen Kommunalarchiven 3 Neue Erschließungsarbeiten im Staatsarchiv Gotha – Christel Gäbler Bestand des Departements C des Herzoglichen Vorbemerkung sitive Resonanz gewertet wird. Ein Großteil der 21 Fragen „Archivbilder von der Peripherie“ – Großherzoginnen und Staatsministeriums Gotha im Archivportal verfügbar 32 bot eine Auswahl möglicher Antworten, was eine statis- Großherzöge von Sachsen-Weimar-Eisenach Jens Riederer Die deutsche Archivlandschaft ist im Hinblick auf die tische Auswertung ermöglichte. Bei einzelnen Fragen in Auma (1815-1918) 6 Seltenste Zeugnisse eines Hitler-Gegners gesichert. Langzeitarchivierung elektronischer Unterlagen in Bewe- konnten zudem Standpunkte, Meinungen und Ansichten Petra Weigel Die NKFD-Flugblätter von Oberst Luitpold Steidleim gung geraten: Digitale Langzeitarchive sind im Aufbau geäußert werden. Das Archiv der Sammlung Perthes Gotha 12 im Stadtarchiv Weimar 34 begriffen, Kooperationsprozesse wurden angestoßen Uwe Grandke und teilweise umgesetzt, Kompetenzzentren haben sich Fragebogenauswertung Berichte Fördermittel des Bundes für die -

21 Tabelle in Der Reihenfolge Der Bearbeitung
Zeichner / Autor/ Entstanden / Bezeichnung Signatur der SBBPK Nr. Jahr Titel Herausgeber / gedruckt in des Meeres Gattung Drucker / Verlag Ritters geographisch- Japanisches KartLS3Bai10-1 1 1874 statistisches Lexikon über die Benjamin Ritter Deutschland Meer Lexikon, Stichwort Erdteile … Ritters geographisch- Japanisches HA14Db1749-1 2 1910 statistisches Lexikon über die Benjamin Ritter Deutschland Meer Lexikon, Stichwort Erdteile Ptolemäische Weltkarte der 2°Kart.28193 Faksimile 3 1477 Claudius Ptolemaeus Italien Kein Name Cosmographia Karte 1200, 2°Kart.28193 Faksimile 4 Tabula Peutingeriana unbekannt Deutschland Kein Name um Karte 2°Kart.28193 Faksimile 5 1076 Türkische Weltkarte Mahmud al-Kaschghari Türkei Kein Name Karte Ozean des Abu Abdallah 2°Kart.28193 Faksimile 6 1154 Charta Rogeriana Arabien Ostens (auf Muhammad Idrisi Karte arabisch) 2°Kart.28193 Faksimile 7 1364 Map oft the Five Indies Gotenjiku Zu Japan Kein Name Karte 2°Kart.28193 Faksimile 8 1502 Alberto Cantino-Weltkarte anonym Portugal Kein Name Karte Orbis typus universalis iuxta 2°Kart.28193 Faksimile 9 1513 Martin Waldseemüller Frankreich Kein Name hydrographorum traditionem Karte 2°Kart.28193 Faksimile 10 1529 Carta Uniuersal Diogo Ribeiro Spanien Kein Name Karte 2°Kart.28193 Faksimile 11 1567 Asiae orbis partium maximae Abraham Ortelius Belgien Kein Name Karte Asia ex magna orbis terrae 2°Kart.28193 Faksimile 12 1606 Gerhard Mercator jun. Niederlande Mare Cin descriptione Atlas 1598, Henricus Florentius van 2°Kart.28193 Faksimile 13 Asiae nova descriptio Niederlande -

AUTUMN 1997 ISSUE No. 70
AUTUMN 1997 ISSUE No. 70 Journal of the International Map Collectors' Society AUTUMN 1997 ISSUE No. 70 CONTENTS From the Editor's Desk 4 A ward for Francis Herbert 33 Cassell and Company 7 Warburg Lectures 1997-98 34 H. Berghaus & A. Petermann 19 IMCoS Meeting in June, 1997 35 Letters to the Editor 28 Report on the Valuation Desk 35 Where is this Mosaic? 29 IMCoS-Helen Wallis Award for 1997 37 Mercator Atlas acquired by BL 30 Book Reviews 43 International News & Events 31 List of Advertisers 46 Cover map: Detail from 'Hungariae Descriptio' by Wolfgang Lazius, from Abraham Ortelius: Theatrum Orbis Terrarum, 1570 (Courtesy of Laszl6 Gr6f). Copy and other material for our next issue (Winter) should be submitted by 1 November 1997. All items for editorial use should be sent to The Editor, Susan Gole, 3 Aylesbury Road, Wing, Leighton Buzzard LU7 OPD. Tel: 01296 681 071. Fax: 01296 682 671. For Advertising, contact the Journal Advertising Manager, Derek Allen, 25 St Margaret's Road, London SE4 1YL. Tel: 0181-469 3932. Chairman & Membership Secretary: Jenny Harvey, 27 Landford Road, Putney, London SW15 lAQ. Tel: 0181-789 7358. Fax: 0181-788 7819 Vice-Chairman: Valerie Scott, 48 High Street, Tring, Herts HP23 5BH. Tel: 01442-824 977 Gen. Secretary: W.H.S. Pearce, 29 Mount Ephraim Road, Streatham, London SW16 1NQ. Tel: 0181-769 5041. Fax: 0181-677 5417 Treasurer: Dr Cyrus Ala'i, 1 Golders Park Close, West Heath Avenue, London NW11 7QR. Publicity Officer: Yasha Beresiner, 43 Templars Crescent, London N3 3QR. Tel: 0181-349 2207. -

For People Who Love Early Maps Early Love Who People for 151 No
151 INTERNATIONAL MAP COLLECTORS’ SOCIETY WINTER 2017 No.151 FOR PEOPLE WHO LOVE EARLY MAPS JOURNAL ADVERTISING Index of Advertisers 4 issues per year Colour B&W Altea Gallery 64 Full page (same copy) £950 £680 Half page (same copy) £630 £450 Antiquariaat Sanderus 58 Quarter page (same copy) £365 £270 Barron Maps 33 For a single issue Full page £380 £275 Barry Lawrence Ruderman 2 Half page £255 £185 Cartographic Associates 12 Quarter page £150 £110 Flyer insert (A5 double-sided) £325 £300 Collecting Old Maps 11 Advertisement formats for print Clive A Burden 12 We can accept advertisements as print ready artwork Daniel Crouch Rare Books 67 saved as tiff, high quality jpegs or pdf files. Dominic Winter 11 It is important to be aware that artwork and files that have been prepared for the web are not of sufficient Frame 42 quality for print. Full artwork specifications are available on request. Jonathan Potter 65 Kenneth Nebenzahl Inc. 58 Advertisement sizes 34 Please note recommended image dimensions below: Kunstantiquariat Monika Schmidt Full page advertisements should be 216 mm high Librairie Le Bail 65 x 158 mm wide and 300–400 ppi at this size. Loeb-Larocque 33 Half page advertisements are landscape and 105 mm high x 158 mm wide and 300–400 ppi at this size. The Map House inside front cover Quarter page advertisements are portrait and are 105 Martayan Lan outside back cover mm high x 76 mm wide and 300–400 ppi at this size. Milano Map Fair 42 IMCoS website Web banner Mostly Maps 65 Those who advertise in our Journal have priority in taking a web banner also. -

Clemens Theodor Perthes
Werner M. Ruschke Clemens Theodor Perthes (1809 –1867) und die bleibende Bedeutung seines diakonischen Wollens www.perthes-stiftung.de Titelbild: Nach einer sich im Stadtmuseum von Köln befindenden Fotografie mit Bleistift gezeichnet (56 x 70 cm) von einem heute unbekannten Besu- cher der Herberge zur Heimat in Soest. Die Fotografie ist abgedruckt in Otto Perthes: Werden und Wirken von Clemens Theodor Perthes (1909), vordere innere Umschlagseite. Hintere Umschlagseite: Metallschild, Durchmesser 60 cm. Dieses Schild hing an der Herberge zur Heimat in Soest. Werner M. Ruschke Clemens Theodor Perthes (1809-1867) und die bleibende Bedeutung seines diakonischen Wollens 1 4. überarbeitete und erweiterte Auflage 2018. Die 1. und 2. Auflage dieses Heftes 2005 sowie die 3. Auflage 2009 erschienen unter dem Titel „Clemens Theodor Perthes (1809–1967) und das Fortwirken seines diakonischen Wollens im Evangelischen Perthes-Werk. Erweiterte Fassung eines am 17. März 2005 vor der Mitgliederversammlung des Evangelischen Perthes-Werkes in Münster gehaltenen Vortrags“. – Das Werk wurde am 18.10.2016 umbenannt in Evangelische Perthes-Stiftung e. V. Pastor Hans Bachmann gewidmet, der von 1973 bis 2000 erst als Geschäftsführer und dann als Vor- standsvorsitzender die Arbeit des Evangelischen Perthes-Werkes e. V. entscheidend mitgeprägt hat. 2 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung .................................................... 4 2. Perthes: Person und Werk ................................... 6 3. Perthes: Politisches Wirken ................................ -

Perthes Collection Gotha
Perthes Collection Gotha Bruno Hassenstein, Chart of Volcanoes Meru and Kilimanjaro, 1888 August Petermann, Polar Chart, before 1852 The collection´s takeover in 2003 made obvious that the previous storage and indexing of it did not meet today´s tography and geography and being unique in Europe as well expectation of permanent preservation and usage. Those as for its stock going back to the Middle Ages this collection conditions did not allow to present the collection to resear- shall be presented as an outstanding example at the Ducal chers and the public. Library of Friedenstein Castle, Gotha or “Perthes Forum” in the near future. Since 2003 thanks to generous promotion by the Thuringian Ministry of Education, several German cultural foundations like Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Cultural Foundation of German Laender, German Research Foundation and pri- vate sponsors. Erfurt University Library has made efforts to preserve and use “Perthes collection”. This includes various projects like recording the publishers´ products and library, Universitäts- und Forschungs- in a catalogue, cleaning and reorganization of the map coll- ection, conservation and indexing of both copperplates and bibliothek Erfurt/Gotha archives. The products and parts of the library can already be researched online. Representing Gotha´s tradition of car become one of the most important and leading publishers Universitäts- und Forschungsbibliothek in the market of cartography and geography in the 19th and Erfurt/Gotha 20th centuries. Forschungsbibliothek Gotha Outstanding cartographers and geographers of the 19th Sammlung Perthes century like Heinrich und Hermann Berghaus, Karl Spruner, Carl Vogel and Bruno Hassenstein worked for the company. Schloss Friedenstein Winning over August Petermann as an employee in 1854 D – 99867 Gotha can be seen as some stroke of luck. -

The History of Cartography, Volume 6
mattered little during the economic crisis of the 1930s, and production was terminated in 1931, leaving the fi rm solely dependent on the Baedeker maps. Since Debes had worked on Stieler’s Handatlas in Gotha, his interest in designing a large, modern gen- W eral reference atlas using multicolor lithography is not surprising. His fi rst such work appeared in 1895, with Wagner & Debes (Germany). The history of the car- fi fty map sheets. Although it went through four edi- tographic publishing house Wagner & Debes is inter- tions and remained on the market with the 1914 edition twined with four prominent names in German publish- until 1919, the project was only marginally profi table. ing: Eduard Wagner, Karl Baedeker, and his descendants A small fi rm like Wagner & Debes could not compete Ernst Debes and Paul Oestergaard. Wagner & Debes successfully with Velhagen & Klasing, which published began in 1841 as a collaboration between the lithogra- Andree’s Handatlases. In addition, Wagner & Debes pher Wagner and the bookseller-publisher Baedeker that printed its maps from stone plates, and even though the lasted over one hundred years, ending in 1943. Baedeker fi rm used fast stone plate presses, the process remained is well known for his extensive series of travel guides for uneconomical because its plates were engraved directly which Wagner’s fi rm produced all of the maps. Debes on stone and thus were not easily replaced. By contrast, became a partner of Wagner in 1872. maps for Stieler’s Handatlas were originally engraved on During their collaborative years the cartographic work copperplates and then transferred to stone by a process of the Wagner fi rm (later Wagner & Debes) fell into four that made it easy to replace worn or damaged plates main categories: city maps and illustrations for the Bae- (Espenhorst 2003).