Masterarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Авантура На Балкану, 1915. Adventure in the Balkans, 1915
Даглас Мериведер Долд АВАНТУРА НА БАЛКАНУ, 1915. Douglas Meriwether Dold ADVENTURE IN THE BALKANS, 1915 БИБЛИОТЕКА LIBRARY ПОСЕБНА ИЗДАЊА SPECIAL EDITIONS Главни и ооворни уреник Editor-in-Chief Др Небојша Кузмановић, директор Director Nebojša Kuzmanović, Ph.D. Уреник Editor Весна Башић Vesna Bašić Превела с енлеско језика Translated from English by Ивана Ђокић Саундерсон Ivana Đokić Saunderson Сручна реакура Professional editing енлеско екса in English Мср Драгана Катић Dragana Katić, MA Александар Бурсаћ Aleksandar Bursać Мср Александар Димитријевић Aleksandar Dimitrijević, МА © Copyright: 2018, Архив Војводине © Copyright: 2018, Archives of Vojvodina Даглас Мериведер Долд АВАНТУРА НА БАЛКАНУ 1915. Приреила Љиљана Дожић Превела с енлеско језика Ивана Ђокић Саундерсон Нови Сад, 2018. Садржај / Content Предговор (Кајл Ранолф Ска) ................................................ 7 Ратна сећања Дагласа Долда (мср Љиљана Дожић) .......................... 11 Авантура на Балкану, 1915. ..................................................... 27 Даглас Мериведер Долд (1888–1931) .......................................... 89 Сећање на америчке хероје из 1915. (р Неојша Кузмановић) ............ 91 Прилози / Addendum .............................................................. 97 Foreword (Kyle Randolph Scott) ................................................. 123 War Memories of Douglas Dold (Ljiljana Dožić, MA) ........................ 127 Adventure in the Balkans, 1915 .................................................... 143 Douglas Meriwether -

Christopher Alexander Murray
Order from Chaos when Chaos is the Order: Revising Historical Narratives on Britain’s Second World War Yugoslav Policy L'ordre du chaos quand Chaos est l'Ordre: Révision des récits historiques sur la politique Yougoslave Seconde Guerre mondiale en Grande-Bretagne A Thesis Submitted to the Division of Graduate Studies of the Royal Military College of Canada by Christopher Alexander Murray In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts – War Studies April 2016 © This thesis may be used within the Department of National Defence but copyright for open publication remains the property of the author. II Disclaimer The opinions and conclusions expressed herein are those of the individual student author and do not necessarily represent the views of the Royal Military College of Canada, the Department of National Defence, their staffs, or any other governmental agency. References to this study should include the foregoing statement. Any errors are solely the responsibility of the author. Legal / Copyright Quotation from, Abstraction from, or Reproduction of all or any part of this document is permitted provided proper acknowledgement is made. III To Jessica, my sounding board, my editor, my unofficial research assistant, my partner in crime, my friend, my love. Without your help and your limitless patience none of this would be possible. So you’re the one to blame. IV Abstract During the Second World War British support to occupied Yugoslavia’s resistance underwent an inexplicable and controversial about face that saw His Majesty’s Government (HMG) pivot support from Draža Mihailović’s Royalist Četniks to Josip Broz Tito’s Communist Partisans. -

Why Reunions Re Good for You: by JERRI DONOHUE 2) I Won't Know Anybody There
THE U.S. AIR FORCES ESCAPE & EVASION SOCIETY , TEXAS 76907-2501 March 4.2l4, 201 0 <www. a i rf o rceesca pe. c o m> NNH N NNAJ'N A,/INNIVNIN Why Reunions re good for you: By JERRI DONOHUE 2) I won't know anybody there. yes, that can Brecksville, Ohio be tough. But you probably will know somebody AFEES Fdend Member within about a half hour of your arrival. The people As a volunteer for the Library of Congress hosting the reunion want you to be there and they Veterans History Project (VHP),I have attended want you to have a sood time. numerous reunions of WW II vets. Despite different They look forward to meeting you because histories and customs, I have repeatedly observed you're all members of the same endangered species. that these events share something in colnmon: If you come to an AFEES reunion, you will be with Reunions are'{ood for those who attend. other evaders. No wife, child or friend, no matter Because of this, at the end of each VHp how loving, has experienced war as you have. But interview, I now ask the veteran if he/she other evaders have lived it and they understand you .,no,', participates in reunions. If the answer is I ask in a way nobody else can. why not. Here are some of the responses I get, and my rebuttal: 3) It's too expensive. It's a shame to realize some veterans pass on reunions because of finances. 1) r'm too dld to travel. -

Mckinley Honors Serbian Contributions in Two World Wars
September 16, 2010 Log # 10-52 For Immediate Release McKinley honors Serbian contributions in two world wars By Army Staff Sgt. Jim Greenhill National Guard Bureau MOUNT AVALA, Serbia - Honoring Serbian contributions in two world wars, Air Force Gen. Craig McKinley, the chief of the National Guard Bureau, placed a wreath at the Monument to the Unknown Hero here Sept. 11. "It was especially poignant today, on the anniversary of Sept. 11, 2001, when our nation was attacked, that I symbolically thanked the Serbian military for their support to the United States in World War I and World War II," McKinley said. McKinley is visiting Serbia with a delegation of Ohio National Guard members and observing National Guard State Partnership Program activities. Serbia is Ohio's SPP partner. "This is something which is very important to us," said Dragan Sutanovac, the Serbian Minister of Defense. "This is a message to the [Serbian] military. We appreciate it very much. This is something which, symbolically, means a lot." Sutanovac was the first Serbian defense minister to visit the Tomb of the Unknowns at Arlington National Cemetery in Virginia in February. Though estimates vary, Serbian casualties in World War I may have been as high as 1.2 million, the majority of whom were civilians. The war decimated the country, killing more than 25 percent of its people and more than half its males, said Serbian and other sources. At least one million more Serbians may have died during World War II, said Serbian and other sources. -more- Serbians helped save the lives of 500 downed U.S. -

Congressional Record—Senate S8711
December 9, 2010 CONGRESSIONAL RECORD — SENATE S8711 contributed tremendously to a number The Bronze Star is awarded to mili- and begging for visas before they fi- of highly advanced projects. tary service personnel for bravery, acts nally escaped from Nazi-occupied Eu- Fiber Materials was established in of merit or meritorious service. When rope. the southern Maine town of Biddeford awarded for bravery, it is the fourth- I was excited that someone with a in 1969 and has become a global leader highest combat award of the U.S. name like mine was such a hero and in the design, manufacture, and testing Armed Forces. Captain Vujnovich’s de- was the genesis of my interest in Yugo- of a variety of advanced composites in termination to rescue and save the slavia. In fact it left such an impres- its 40 years of operation. The company trapped airmen and subsequent partici- sion on me that my first paper in produces a wide range of materials, pation in the planning and execution of undergrad school was titled ‘‘How the from carbon/carbon composites used in Operation Halyard—resulted in one of U.S. sold out Yugoslavia at Yalta and the construction of heatshields and the most successful air force rescue Tehran’’. missile nosetips, to quartz products de- missions in history; and an operation Captain Vujnovich made it his per- signed for printed circuit boards or so secret that the records were only de- sonal crusade to get the airmen home. electrical and thermal insulation. classified in 1997. From the outset though, Operation Fiber Materials now employs roughly I was made aware of the Halyard Mis- Halyard encountered opposition from 180 employees at its facilities in Bidde- sion as a boy in 1946. -

Congressional Record—Senate S915
February 22, 2016 CONGRESSIONAL RECORD — SENATE S915 Unit was a precursor to the U.S. Navy aided by the networks established and infor- There being no objection, the Senate SEALs. The OSS Operational Groups and mation acquired by the OSS to guide Allied proceeded to consider the resolution. Jedburghs were forerunners to U.S. Army landings. Mr. MCCONNELL. Mr. President, I Special Forces. The 801st/492nd Bombard- (15) OSS Operation Halyard rescued more ment Group (‘‘Carpetbaggers’’) were pro- than 500 downed airmen trapped behind ask unanimous consent that the reso- genitors to the Air Force Special Operations enemy lines in Yugoslavia, one of the most lution be agreed to, the preamble be Command. The Marines who served in the daring and successful rescue operations of agreed to, and the motions to recon- OSS, including the actor Sterling Hayden (a World War II. sider be considered made and laid upon Silver Star recipient), Col. William Eddy (a (16) OSS ‘‘Mercy Missions’’ at the end of the table with no intervening action or Distinguished Service Cross recipient who World War II saved the lives of thousands of debate. was described as the ‘‘nearest thing the Allied prisoners of war whom it was feared The PRESIDING OFFICER. Without United States has had to a Lawrence of Ara- would be murdered by the Japanese. objection, it is so ordered. bia’’), and Col. Peter Ortiz (a two-time Navy (17) The handful of surviving men and Cross recipient), were predecessors to the women of the OSS whom General Donovan The resolution (S. Res. 371) was Marine Special Operations Command. -

EXTENSIONS of REMARKS March 3, 1987 EXTENSIONS of REMARKS
4686 EXTENSIONS OF REMARKS March 3, 1987 EXTENSIONS OF REMARKS TRIBUTE TO WILLIE J. FULTON munity to believe in strong and worthy values, saving the lives of American servicemen in even in the hardship of a sometimes reluctant World War II. Again, the State Department has HON. JAMES A. TRAFICANT, JR. society. For what he has chosen to give to his proven to be a major force of opposition. OF OHIO community in the way of guidance and patient Hopefully, someday the State Department will leadership for so many years, I join the many IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES officially recognize the role General Mihailo grateful people of Warren in appreciating Mr. vich played and allow these American service Tuesday, March 3, 1987 Fulton's dedication. I wish Willie and Barbara men to finally honor the man who saved their Mr. TRAFICANT. Mr. Speaker, it is with the best in his retirement and look forward to lives. Until then, however, all Americans can great pleasure that I rise today to honor Willie his further contributions in making Warren, remember ·with gratitude the service that Lt. J. Fulton, retired councilman of the sixth ward OH, an even better place to live. Col. George Musulin gave to his country, and in Warren, OH. Tonight he will be honored, his part in bringing these former MIA's home. and his distinguished career recognized, by TRIBUTE TO LT. COL. GEORGE I have included an article from the Washing the Black Elected Officials of Ohio. MUSULIN ton Times that summarizes the accomplish Mr. Fulton has chosen as a life-long pursuit ments of Colonel Musulin. -

Operation Halyard
Operation Halyard George Vujnovich led what has been called "one of the greatest rescue missions of World War II." He passed away of natural causes in New York City on 24 APR at age 96. Vujnovich orchestrated Operation Halyard, also known as the Halyard Mission, which rescued 512 airmen whose B-17 Flying Fortresses and B-24 Liberators had been attacked by Nazi Luftwaffe aircraft during World War II. He served as an agent for the Office of Strategic Services (OSS), a U.S. intelligence organization that preceded the CIA. Vujnovich orchestrated Operation Halyard in 1944, stealthily rescuing a group of U.S. airmen who were stranded in Nazi-occupied Yugoslavia during the final years of World War II. But those who don't know his name can be forgiven, as the story of Vulnovich's greatest triumph was kept under wraps for over 60 years. A book about Operation Halyard, called "The Forgotten 500," was written by Gregory A. Freeman in 2007. In 2010, Vujnovich received a Bronze Star Medal of Honor for his work. Despite these recognitions, there was relatively little public knowledge about this Pittsburgh-born veteran. Now, Vujnovich's death has occasioned new interest in his extraordinary story. George Vujnovich Lt. 1944 Vujnovich was born to Serbian immigrants in 1915. He traveled to Belgrade for university studies, where he met his wife Mirjana. When Germany bombed the city in 1941, Vujnovich witnessed the carnage in person. He and his wife decided to flee Belgrade. On their way to Bulgaria, an outlandish coincidence helped them make their escape. -
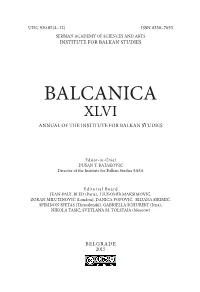
On a One-Sided Interpretation of the Yugoslav Past
UDC 930.85(4–12) ISSN 0350–7653 SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES BALCANICA XLVI ANNUAL OF THE INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES Editor-in-Chief DUŠAN T. BATAKOVIĆ Director of the Institute for Balkan Studies SASA Editorial Board JEAN-PAUL BLED (Paris), LJUBOMIR MAKSIMOVIĆ, ZORAN MILUTINOVIĆ (London), DANICA POPOVIĆ, BILJANA SIKIMIĆ, SPIRIDON SFETAS (Thessaloniki), GABRIELLA SCHUBERT (Jena), NIKOLA TASIĆ, SVETLANA M. TOLSTAJA (Moscow) BELGRADE 2015 Miloš Mišić http://www.balcanica.rs Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia doctoral research holder On a One-sided Interpretation of the Yugoslav Past Marie-Janine Calic, Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert. Munich: C.H. Beck, 2010; Serb. ed. Istorija Jugoslavije u 20. veku. Belgrade: Clio, 2013, 490 p. he author of this synthesis is the German historian of Croatian origin Marie-Janine Calic, daughter of the historian and writer Eduard Calic. PriorT to her current position as professor of history at Ludwig Maximilian University in Munich, she was a researcher at the German Institute for International and Security Affairs in Ebenhausen and Berlin (1992–2004). She also served as political advisor to the UN Special Representative for the former Yugoslavia in Zagreb (1995) and to the Special Coordinator of the Pact for the Stability of South-East Europe Bodo Hombach in Brussels (1999–2002). Calic also served as expert/consultant of the ICTY in The Hague. She is already known to Serbian readership by her book Social his- tory of Serbia 1815–1941. Sluggish progress in industrialisation (2004) derived from her doctoral thesis. -

7369 Hon. Richard E. Neal Hon. Patrick J. Murphy Hon. Dale E. Kildee
March 16, 2009 EXTENSIONS OF REMARKS, Vol. 155, Pt. 6 7369 BEAN of Illinois and DAN BURTON of Indiana, in German Luftwaffe bombed Belgrade in Oper- Jon E. Cutler—the only Jewish Chaplain cur- honoring a treasured constituent of mine and ation Punishment. Mr. Vujnovich was a first- rently serving in western Iraq. And as a former one of the unsung heroes of World War II, re- hand witness to the bombing, nearly losing his paratrooper in the 82nd Airborne Division who tired Major George Vujnovich. Major life when a falling bomb destroyed a nearby served in Baghdad 5 years ago and the first Vujnovich, a proud Serbian-American, was in- streetcar. After the bombing, Mr. and Mrs. Iraq war veteran to serve in this great body, it strumental in ‘‘Operation Halyard’’ and one of Vujnovich fled Yugoslavia, and he accepted a fills me with tremendous pride to be Rabbi the last surviving members of that successful job in Ghana as assistant airport manager Cutler’s Congressman. Rabbi Cutler has set wartime mission. while Mirjana moved to Washington, DC to an example for all of us—not just through his In the summer of 1944, Americans and Al- work at the Yugoslav Embassy. When the US spiritual leadership—but through selfless serv- lied airmen flew hundreds of sorties over Eu- entered the war, Mr. Vujnovich received a ice to our community and our nation. rope with the aim of disrupting the Ploesti oil commission as a second lieutenant and as- In Iraq, Rabbi Cutler serves as the 3rd Ma- complex, Adolf Hitler’s most important oil pipe- sumed command of an airbase in Nigeria. -

7369 Hon. Richard E. Neal Hon. Patrick J
March 16, 2009 EXTENSIONS OF REMARKS, Vol. 155, Pt. 6 7369 BEAN of Illinois and DAN BURTON of Indiana, in German Luftwaffe bombed Belgrade in Oper- Jon E. Cutler—the only Jewish Chaplain cur- honoring a treasured constituent of mine and ation Punishment. Mr. Vujnovich was a first- rently serving in western Iraq. And as a former one of the unsung heroes of World War II, re- hand witness to the bombing, nearly losing his paratrooper in the 82nd Airborne Division who tired Major George Vujnovich. Major life when a falling bomb destroyed a nearby served in Baghdad 5 years ago and the first Vujnovich, a proud Serbian-American, was in- streetcar. After the bombing, Mr. and Mrs. Iraq war veteran to serve in this great body, it strumental in ‘‘Operation Halyard’’ and one of Vujnovich fled Yugoslavia, and he accepted a fills me with tremendous pride to be Rabbi the last surviving members of that successful job in Ghana as assistant airport manager Cutler’s Congressman. Rabbi Cutler has set wartime mission. while Mirjana moved to Washington, DC to an example for all of us—not just through his In the summer of 1944, Americans and Al- work at the Yugoslav Embassy. When the US spiritual leadership—but through selfless serv- lied airmen flew hundreds of sorties over Eu- entered the war, Mr. Vujnovich received a ice to our community and our nation. rope with the aim of disrupting the Ploesti oil commission as a second lieutenant and as- In Iraq, Rabbi Cutler serves as the 3rd Ma- complex, Adolf Hitler’s most important oil pipe- sumed command of an airbase in Nigeria. -

The OSS Society Journal
SUMMER/FALL 2010 THE OSS SOCIETY JOURNAL OSS IN MANCHURIA SAUL STEINBERG “It’s a tribute to General Donovan that his OSS had the intelligence and imagination to employ art- ists who served around the world and produced outstanding art. Saul Steinberg, who served in China, Italy, and North Africa, drew 1,200 cartoons and 90 covers for The New Yorker. Henry Koerner created pro- paganda posters for the OWI and was the OSS chief illustrator at the Nuremberg Trials, photographed post-World War II Austria and Ger- many, and created many covers for Time. Dong Kingman served in the OSS along with other notable artists and designers such as Georg Olden, who designed the CBS logo, and Donal McLaughlin, the designer of the United Nations logo.” From Dan Pinck’s review of Dr. Seuss & Co. Go to War: The World War II Editorial Cartoons of America’s Leading Comic Art- ists by Andre Schiffrin on page 44. THE OSS SOCIETY JOURNAL TABLE OF CoNTENts OSS NEWS 6 Joint Special Operations 3 Ross Perot to Receive the William J. Donovan Award® University Holds OSS 4 MG Eldon Bargewell Receives Bull Simons Award Symposium 5 With Modesty, A Hero Gets His Due in New York Ceremony 12 6 Joint Special Operations University: Irregular Warfare The 48-Star American Flag and the OSS Model Studied for Future Strategy Waves Once More in France 8 New Members Elected to Board of Directors 9 Glorious Amateurs Needed in War with Terrorists Long Overdue Premiere for 12 The 48-Star American Flag Waves Once More in France 16 14 Lt.