Geschlechtergerechte Sprache in Kulturbetrieben
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gender-Sternchen, Binnen-I Oder Generisches Maskulinum, … (Akademische) Textstile Der Personenreferenz Als Registrierungen?*
Gender-Sternchen, Binnen-I oder generisches Maskulinum, … (Akademische) Textstile der Personenreferenz als Registrierungen?* Helga Kotthoff (Freiburg) Abstract For more than 40 years, a debate on gender-related person references has been taking place in the German-speaking world. My contribution starts with a differentiation of four registers, which are currently practiced in writing and have developed specific reasoning discourses and specific social contexts of usage, as I try to show. I am going to examine these four styles of gendered person reference as “registers” in the sense of anthropological linguistics (Agha 2007). This concept of “enregisterment” implies that the producers connect themselves to a socio-symbolic cosmos and can be perceived with cultural evaluations (in production and re- ception), for example, as conservative, feminist, queer, liberal (Kotthoff 2017). Here I shall explore their (socio)linguistic underpinnings within conceptions of language ideology in order to grasp the communication-reflexive charges of these discourses. 1 Einleitung Seit über 40 Jahren findet im deutschsprachigen Raum eine Debatte um geschlechterbezogene Personenreferenzen statt. Mein Beitrag setzt bei einer Binnendifferenzierung von vier Registern an, die sich inzwischen mit spezifischen sozialen Verortungen herausgebildet haben, was ich zu zeigen versuche. Die traditionelle Schreibpraxis mit einem generisch gemeinten, ge- schlechtsübergreifenden Maskulinum1 (Typ 1), wie sie etwa von Eisenberg (2017), Glück (2018) oder dem Verein für Deutsche -

Graphemic Methods for Genderneutral
Graphemic Methods for GenderNeutral Writing Yannis Haralambous & Joseph Dichy Abstract. In this paper we present a model and a classification of graphemic genderneutral writing methods, we explore current practices in French, Ger man, Greek, Italian, Portuguese and Spanish languages, and we investigate in teractions between genderneutral writing forms and regular expressions. 1. Introduction: The General Issue of, and behind, Gender Neutral Writing The issue behind genderneutral writing is that of the representation of intergender relations carried by languages. What is at stake is the representation of equality, or not, between genders. The issue is also re ferred to as “inclusive writing,” which apparently refers to human rights, but does not cover all cases, i.e., lesbian, gay, bisexual and transgender persons. The term “GenderNeutral Writing” is, in fact, both clearer and more inclusive. Generally speaking, languages are conservative, if not archaic. A sig nificant example is that of the idea of time, which is traditionally repre sented as a dot sliding along a straight line in a continuous movement. This has been a philosophical image of time since ancient Greek philoso phers and throughout the Middle Ages both in Arabic and European phi losophy, but can no longer be considered as a valid representation after 20th century existentialist philosophers and Heidegger’s Sein und Zeit. Yannis Haralambous 0000-0003-1443-6115 IMT Atlantique & LabSTICC UMR CNRS 6285 Brest, France [email protected] Joseph Dichy Professor of Arabic linguistics Lyon, France [email protected] Y. Haralambous (Ed.), Graphemics in the 21st Century. -

Specimen · © 2020 Fontwerk · Fontwerk.Com · 1/19
Fontwerk Case Micro™ Type Specimen · © 2020 Fontwerk · fontwerk.com · 1/19 Case Micro Fontwerk Case Micro™ Credits & Details · fontwerk.com · 2/19 Case Micro™ For small print that is supposed to be read. The typographical proof that size does matter. Design Design Contributions Trademarks Licensing, Pricing Modifications, Erik Spiekermann Andreas Frohloff Case Micro™ is a trademark of Trial Free Test license Extensions Anja Meiners Fontwerk GmbH Standard Combined Print, Web, Available on request Ralph du Carrois Mastering, Production App and eBook license, Andreas Frohloff Design Period; Release starting at €50 Recommended Use Christoph Koeberlin 2019–2020; October 12, 2020 ExtendedLarger license Advertising & Packaging volume and additional Broad‐ Editorial & Publishing Marketing Latest Update casting, starting at €500 Small Text Ivo Gabrowitsch(Naming, Version 1.001; October 26, 2020 Further types of license Software & Gaming Conceptual Contribution, available on request Responsive Designs Copywriting, Imagery, Languages Specimen) 94 Latin (see page 8) Formats Contact Lucy Beckley (English otf, woff, woff2; Further Fontwerk GmbH Translation) Glyphs Per Font formats available on request Prenzlauer Allee 186 Loris Olivier(Graphic Design) 789 (see page 9) 10405 Berlin, Germany Variable Fonts [email protected] Styles Included in the Superfamily 8: four upright weights and package at no extra cost. Available exclusively corresponding italics Axis: weight, optical size from fontwerk.com/ (see page 5) fonts/case-micro. File sizes (woff/woff2): 170/136 kb Upright; 172/136 kb Italic Bold 50 pt, Medium 16 pt, Regular 16 pt, Bold 8.5 pt, Regular 8.5 pt Fontwerk Case Micro™ Samples · fontwerk.com · 3/19 End-to-end encryption Berlin Grammar Metoprolol 100–1A SIGNATURE institut pasteur de lille 1899 Freelancer From $29.95/mo. -

CHRISTIAN METZ and the CODES of CINEMA Analysis and Later with Enunciation Theory
EDITED BY MARGRIT TRÖHLER FILM THEORY FILM THEORY CHRISTIAN METZ IN MEDIA HISTORY IN MEDIA HISTORY AND GUIDO KIRSTEN AND THE CODES OF CINEMA FILM SEMIOLOGY AND BEYOND EDITED BY MARGRIT TRÖHLER AND GUIDO KIRSTEN A pioneering figure in film studies, Christian MARGRIT TRÖHLER is a professor in Metz proposed countless new concepts for the Department of Film Studies at the reflecting on cinema from the 1960s to the University of Zurich. 1980s. Rooted in a phenomenological struc GUIDO KIRSTEN is a postdoctoral re turalism, he worked out a film semiology searcher in the Department of Media which he then confronted with psycho Studies at Stockholm University. CINEMA OF CODES THE AND METZ CHRISTIAN analysis and later with enunciation theory. He also played a key role in establishing film studies as a scholarly discipline, making major contributions to its institutionaliza tion in universities worldwide. This book brings together a stellar roster of contribu tors to present a close analysis of Metz’s writings, their theoretical and epistemologi cal positions, and their ongoing influence today. ISBN 978-90-896-4892-1 AUP.nl 9 789089 648921 AUP_FtMh_KIRSTENe.a._(CMETZ)_rug28mm_v05.indd 1 18-01-18 12:16 Christian Metz and the Codes of Cinema Film Theory in Media History Film Theory in Media History explores the epistemological and theoretical foundations of the study of film through texts by classical authors as well as anthologies and monographs on key issues and developments in film theory. Adopting a historical perspective, but with a firm eye to the further development of the field, the series provides a platform for ground-breaking new research into film theory and media history and features high-profile editorial projects that offer resources for teaching and scholarship. -

Ironic Transitions: Conflicting Results of Greater Visibility During the Last 20 Years of Transgender Experience in the United States
SCSU Journal of Student Scholarship Volume 1 Issue 2 Special Issue 2: 10th Annual Minnesota State Conference of Undergraduate Scholarly Article 1 and Creative Activity June 2021 Ironic Transitions: Conflicting Results of Greater Visibility During the Last 20 Years of Transgender Experience in the United States Brianna M. Pace St. Cloud State University Follow this and additional works at: https://repository.stcloudstate.edu/joss Part of the History of Gender Commons Recommended Citation Pace, Brianna M. (2021) "Ironic Transitions: Conflicting Results of Greater Visibility During the Last 20 Years of Transgender Experience in the United States," SCSU Journal of Student Scholarship: Vol. 1 : Iss. 2 , Article 1. Available at: https://repository.stcloudstate.edu/joss/vol1/iss2/1 This Article is brought to you for free and open access by The Repository at St. Cloud State. It has been accepted for inclusion in SCSU Journal of Student Scholarship by an authorized editor of The Repository at St. Cloud State. For more information, please contact [email protected]. Pace: Ironic Transitions: 20 Years of Transgender History from 2000 Ironic Transitions: Conflicting Results of Greater Visibility During the Last 20 Years of Transgender Experience in the United States Brianna M. Pace Mentor: Dr. Jeffrey Mullins Department of History, St. Cloud State University Abstract The spread of internet and social media access in the 21st century led to increased visibility of transgender persons in the U.S., especially within such popular culture venues as art, music, literature, television, and movies. The rapid communication facilitated by the internet also allowed for the formation of larger, more widespread trans communities. -

Trash Is Truth: Performances of Transgressive Glamour
TRASH IS TRUTH: PERFORMANCES OF TRANSGRESSIVE GLAMOUR JON DAVIES A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Graduate Programme in Film and Video, Critical and Historical Studies. York University Toronto, Ontario June 2004 1 2 3 Abstract I will examine several transgressive and transformative performances of glamour in American queer cinema. Primarily, I will look at Mario Montez in the films of Andy Warhol and of Jack Smith (1960s), Divine in the films of John Waters (1970s), and George Kuchar in his own video diaries (1980s). These performances are contradictory, messy, abject, and defiant; they are also profoundly moving to identifying spectators. The power of these performances lies in their harnessing of the experience of shame from queer childhood as a force to articulate deviant queer subjectivities. By forging a radical form of glamour based on a revaluation of trash and low culture, these performances refuse to value authenticity over artifice, beauty over ugliness, truth over trash. This trash glamour is intimately connected to the intense star identification of Hollywood cinematic spectacle that was a survival strategy for queer male children in post-World War Two America. 4 Table of Contents Abstract 4 Table of Contents 5 Introduction 6 1. Theoretical Context 15 2. Super-Fans: Warhol, Smith, Montez 34 3. Divine Shame 62 4. Kuchar’s Queer “Kino-Eye” 97 Conclusion 122 Works Cited 126 Filmography 136 Videography 137 5 Introduction “As Walter Benjamin argued, it is from the ‘flame’ of fictional representations that we warm our ‘shivering lives’” – Peter Brooks I would like to begin with an anecdote that will serve as a point of origin for the connections and resonances among queer childhood, shame, Hollywood fandom, abjection, trash, glamour, and performance that I will develop in this thesis. -
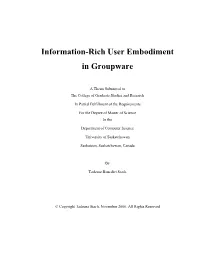
Information-Rich User Embodiment in Groupware
Information-Rich User Embodiment in Groupware A Thesis Submitted to The College of Graduate Studies and Research In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Master of Science In the Department of Computer Science University of Saskatchewan Saskatoon, Saskatchewan, Canada By Tadeusz Benedict Stach © Copyright Tadeusz Stach, November 2006. All Rights Reserved Permission to Use In presenting this thesis in partial fulfillment of the requirements for a Postgraduate degree from the University of Saskatchewan, I agree that the Libraries of this University may make it freely available for inspection. I further agree that permission for copying of this thesis in any manner, in whole or in part, for scholarly purposes may be granted by the professor or professors who supervised my thesis work or, in their absence, by the Head of the Department or the Dean of the College in which my thesis work was done. It is understood that any copying, publication, or use of this thesis or parts thereof for financial gain shall not be allowed without my written permission. It is also understood that due recognition shall be given to me and to the University of Saskatchewan in any scholarly use which may be made of any material in my thesis. Requests for permission to copy or to make other use of material in this thesis in whole or part should be addressed to: Head of the Department of Computer Science University of Saskatchewan Saskatoon, Saskatchewan S7N 5A9 i Abstract Embodiments are virtual personifications of the user in real-time distributed groupware. Many embodiments in groupware are simple abstract 2D representations such as avatars and telepointers. -

Leitfaden Geschlechtergerechte Sprache
Leitfaden geschlechtergerechte Sprache Eine Information der Gleichstellungsstelle Hochschule Emden/Leer Vorwort Sehr geehrte Hochschulangehörige, für viele von Ihnen ist es kein Experiment mehr sondern gelebter Alltag, auch in der Sprache Ihre per- sönliche Haltung zu einem geschlechtergerechten Miteinander an der Hochschule auszudrücken. So- mit zeigen Sie, dass ein weiteres Geschlecht nicht nur "mitgemeint" ist - wie es zum Teil noch in Fuß- noten von Texten zu lesen ist - sondern Sie als Schreiber_in bzw. Sprecher_in ein deutliches und akti- ves Bemühen zeigen, Ihre Leser_innenschschaft bzw. Zuhörer_innenschschaft möglichst zielgerichtet und respektvoll zu adressieren. Dies werten wir als Beitrag zur Umsetzung des Gleichstellungsauftra- ges an der Hochschule und als wichtiges Signal an das Hochschulumfeld. Um die verschiedenen Möglichkeiten aber auch Klippen der Nutzung der geschlechtergerechten Spra- che zu verdeutlichen, hat die Gleichstellungsstelle den vorliegenden Leitfaden erstellt. Er soll Ihnen als Orientierung dienen und den konstruktiven Austausch fördern. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den Kolleg_innen, die uns Texte zur Verfügung gestellt haben, anhand derer wir gemeinsam kon- krete Beispiele aus dem Hochschulalltag bearbeiten konnten. Folgen Sie nun gerne unserer Einladung in die Vielfalt und Bedeutung der Sprache, und lassen Sie sich gleichzeitig gewarnt sein: Einmal sensibilisiert, wird es Ihnen schwer fallen, weiter Texte zu le- sen, ohne sich zu fragen, ob tatsächlich alle Personen in gleichem Maße berücksichtigt -

From Law in Blackletter to “Blackletter Law”*
LAW LIBRARY JOURNAL Vol. 108:2 [2016-9] From Law in Blackletter to “Blackletter Law”* Kasia Solon Cristobal** Where does the phrase “blackletter law” come from? Chasing down its origins uncov- ers not only a surprising turnabout from blackletter law’s original meaning, but also prompts examination of a previously overlooked subject: the history of the law’s changing appearance on the page. This history ultimately provides a cautionary tale of how appearances have hindered access to the law. Introduction .......................................................181 What the Law Looked Like: The Lay of the Land .........................185 Handwriting .....................................................185 Print ...........................................................187 Difficulties in Reading the Law ........................................189 Handwriting .....................................................190 Print ...........................................................193 Why Gothic Persisted Longest in the Law ...............................195 Gothic’s Symbolism ...............................................196 State Authority .................................................198 National Identity ...............................................199 The Englishness of English Law ...................................201 Gothic’s Vested Interests. .203 Printers .......................................................204 Clerks ........................................................205 Lawyers .......................................................209 -

Kompendium Gender Sensible Sprache Strategien Zum Fairen Formulieren
KOMPENDIUM GENDER SENSIBLE SPRACHE STRATEGIEN ZUM FAIREN FORMULIEREN EINE PUBLIKATION DES IMPRESSUM Herausgeber Bundesverband der Kommunikatoren e. V. (BdKom), Oberwallstraße 24, 10117 Berlin, www.bdkom.de, V.i.S.d.P.: Marco Vollmar (Pressesprecher BdKom) 1. Auflage November 2020 Konzeption und redaktionelle Leitung Jeanne Wellnitz (Freie Journalistin und Redakteurin beim „Human Resources Manager“) Beratung Tinka Beller (Diversity-Expertin), Gabriel_Nox Koenig (Bundesverband Trans*), Dr. Sabine Krome (Rat für deutsche Rechtschreibung), Volker Lenk (Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e. V.), Christine Olderdissen (genderleicht.de), Noah Rieser (TransInterQueer e. V.) Lektorat Hannah Petersohn Korrektorat Dr. Roland Kroemer Gestaltung Marcel Franke Urheberrecht Das Kompendium einschließlich all seiner Bestandteile wie Texte und Bilder, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung unzulässig. Eine entgeltliche Weitergabe der Inhalte an Dritte ist nicht gestattet. Bildnachweise Die Hoffotografen GmbH Berlin (S. 3), Matthias Haack (S. 4, oben), wissen media (S. 4, unten), Ann-Christine Sebesteny, (S. 5, oben), Anton Wieland (S. 5, unten), Oliver Roesler (S. 7, oben), Stefanie Stein (S. 7, unten), privat (S. 8, oben), Sabine Kristan (S. 8 unten), Alexander Klebe (S. 9, oben), Barbara Dietl (S. 9, unten), Rea Papke Photography (S. 11), Matthias Haack (S. 13), Barbara Dietl (S. 20), privat (S. 23), Eva Hehemann (S. 24), Michael Kappeler (S. 25), Wilfried Hockmann (S. 27), Niklas Brochhagen (S. 32), Marcel Prusco (S. 33), Hochschule Hannover (S. 34), privat (S. 35), leonarto.de (S. 37), privat (S. 41), Deutschlandradio Bettina Straub (S. 42), DBSV Oliver Ziebe (S. 43), wissen media (S. 45), Ann-Christine Sebesteny (S. 47), Stephanie Brinkkoetter (S. -

Specimen · © 2020 Fontwerk · Fontwerk.Com · 1/20
Fontwerk Case Text™ Type Specimen · © 2020 Fontwerk · fontwerk.com · 1/20 Case Text Fontwerk Case Text™ Credits & Details · fontwerk.com · 2/20 Case Text™ A modern Neo-Grotesque with exceptional legibility. The bigger sister’s perfect body text side-kick. Design Design Contributions Trademarks Licensing, Pricing Modifications, Erik Spiekermann Andreas Frohloff Case Text™ is a trademark of Trial Free Test license Extensions Anja Meiners Fontwerk GmbH Standard Combined Print, Available on request Ralph du Carrois Mastering, Production Web, App and eBook license, Andreas Frohloff Design Period; Release starting at €50 Recommended Use Christoph Koeberlin 2016–2020; October 12, 2020 ExtendedLarger license Advertising & Packaging volume and additional Broad‐ Editorial & Publishing Marketing Latest Update casting, starting at €500 Film & TV Ivo Gabrowitsch(Conceptual Version 1.001; October 26, 2020 Further types of license Logo, Branding & CI Contribution, Naming, available on request Software & Gaming Copywriting, Imagery, Languages Responsive Designs Specimen) 94 Latin (see page 8) Formats Lucy Beckley (English otf, woff, woff2; Further Contact Translation) Glyphs Per Font formats available on request Fontwerk GmbH Loris Olivier(Graphic Design) 795 (see page 9) Prenzlauer Allee 186 Jana Kühl(Imagery) Variable Fonts 10405 Berlin, Germany Styles Included in the Superfamily [email protected] 8: four upright weights and package at no extra cost. corresponding italics Axis: weight, optical size Available exclusively (see page 5) File sizes (woff/woff2): -

Afrofuturism, Critical Race Theory, and Policing in the Year 2044 I
Brooklyn Law School BrooklynWorks Faculty Scholarship 4-2019 Afrofuturism, Critical Race Theory, and Policing in the Year 2044 I. Bennett aC pers Brooklyn Law School, [email protected] Follow this and additional works at: https://brooklynworks.brooklaw.edu/faculty Part of the Law and Race Commons Recommended Citation 94 N.Y.U. L. Rev. 1 (2019) This Article is brought to you for free and open access by BrooklynWorks. It has been accepted for inclusion in Faculty Scholarship by an authorized administrator of BrooklynWorks. NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW VOLUME 94 APRIL 2019 NUMBER 1 ARTICLES AFROFUTURISM, CRITICAL RACE THEORY, AND POLICING IN THE YEAR 2044 I. BENNETr CAPERS* In 2044, the United States is projected to become a "majority-minority" country, with people of color making up more than half of the population. And yet in the public imagination-from Robocop to Minority Report, from Star Trek to Star Wars, from A Clockwork Orange to 1984 to Brave New World-the future is usu- ally envisioned as majority white. What might the future look like in year 2044, when people of color make up the majority in terms of numbers, or in the ensuing years, when they also wield the majority of political and economic power? And specifically, what might policing look like? This Article attempts to answer these questions by examining how artists, cybertheorists, and speculative scholars of color-Afrofuturists and Critical Race Theorists-have imagined the future. What can we learn from Afrofuturism, the term given to "speculative fiction that treats African-American themes and addresses African-American concerns [in the con- text of] techno culture?" And what can we learnfrom Critical Race Theory and its "father" Derrick Bell, who famously wrote of space explorers to examine issues of race and law? What do they imagine policing to be, and what can we imagine policing to be in a brown and black world? * Copyright @ 2019 by I.