Im Gebiet Der Mittelelbe, Sachsen-Anhalt (Araneida: Pisauridae)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve, Periodic Review 2005-2015
This Periodic Review can also be downloaded at www.vattenriket.kristianstad.se/unesco/. Title: Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve. Periodic Review 2005-2015 Authors: This review is produced by the Biosphere Office, Kristianstads kommun: Carina Wettemark, Johanna Källén, Åsa Pearce, Karin Magntorn, Jonas Dahl, Hans Cronert; Karin Hernborg and Ebba Trolle. In addition a large number of people have contributed directly and indirectly. Cover photo: Patrik Olofsson/N Maps: Stadsbyggnadskontoret Kristianstads kommun PERIODIC REVIEW FOR BIOSPHERE RESERVE INTRODUCTION The UNESCO General Conference, at its 28th session, adopted Resolution 28 C/2.4 on the Statutory Framework of the World Network of Biosphere Reserves. This text defines in particular the criteria for an area to be qualified for designation as a biosphere reserve (Article 4). In addition, Article 9 foresees a periodic review every ten years The periodic review is based on a report prepared by the relevant authority, on the basis of the criteria of Article 4. The periodic review must be submitted by the national MAB Committee to the MAB Secretariat in Paris. The text of the Statutory Framework is presented in the third annex. The form which follows is provided to help States prepare their national reports in accordance with Article 9 and to update the Secretariat's information on the biosphere reserve concerned. This report should enable the International Coordinating Council (ICC) of the MAB Programme to review how each biosphere reserve is fulfilling the criteria of Article 4 of the Statutory Framework and, in particular, the three functions: conservation, development and support. It should be noted that it is requested, in the last part of the form (Criteria and Progress Made), that an indication be given of how the biosphere reserve fulfils each of these criteria. -

Arachnologische Mitteilungen
5 © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; Arachnol.Mitt. 37: 1-8 Nürnbergjuli 2009 Neue Nachweise der Gerandeten Wasserspinne Dolomedes plantarius in Brandenburg (Araneae: Pisauridae) DanMo Harms, Jason A. Dunlop & Karin Schütt Abstract: New records of the great raft spider Dolomedes plantarius in Brandenburg (Araneae: Pisauridae). The great raft spider, Dolomedes plantarius (Clerck, 1757), is a rare and endangered species in Germany and other European countries. Current data on its distribution and ecology are briefly reviewed. Five new (or overlooked) localities for this spider from the Spreewald-region of Brandenburg in eastern Germany are provided, together with an updated distribution map. One record, based on the authors' own collections, is described and figured in detail, with the egg-carrying female discovered in reeds at the edge of a fairly large body of open water. Both direct and indirect protective measures for the habitats of this species in the Spreewald-region are recommended. Key words: distribution, Germany, red list Die Jagdspinnengattung Dolomedes (Araneae: aus evolutionsbiologischer Sicht natürlich auch Pisauridae) ist in Deutschland mit nur zwei Arten um eine Jagdspinne (Pisauridae) handelt und der vertreten (RENNER 1987, HEIMER & NENTWIG Trivialname „Wasserspinne“ ausschließlich Bezug 1991). Während die Gerandete Jagdspinne Dolo- auf die Ökologie von D. plantarius nimmt. medes fimbriatus (Clerck, 1757) in Mitteleuropa Aufgrund ihres seltenen Auftretens wird D. plan- weit verbreitet und gebietsweise recht häufig ist, tarius in der Roten Liste der gefährdeten Tierarten wurde die sehr ähnliche Art Dolomedes plantarius Deutschlands momentan in der Kategorie 1 „vom (Clerck, 1757) bisher nur wenige Male gefunden Aussterben bedroht“ geführt (PLATEN et al. -

Wetland Wildlife Cards
Wetland wildlife cards • To make the cards, cut the line across the width of your paper then fold each half in half again so you end up with a picture on one side and the information on the other. Stick the two sides together with glue. Cut Fold Fold Stickleback Diet: Insects, crustaceans, tadpoles and smaller fish Wetland adaptations: Some sticklebacks have adapted to be able to cope with both fresh and saltwater meaning they can live in both rivers and the sea Classification: Vertebrate - Fish Habitat: Ponds, lakes, ditches and rivers Did you know? The male develops a bright red throat and belly and performs a courtship dance to attract a mate. The male also builds and protects the nest Cut Cut Eel Diet: Plants, dead animals, fish eggs, invertebrates and other fish Wetland adaptations: Long, narrow body enables it to get into crevices Classification: Vertebrate - Fish Habitat: Rivers and ditches Did you know? Adult eels migrate 3,000 miles (4,800 km) to the Sargasso Sea to spawn. It then takes the young eels two or three years to drift back to their homes here in the UK Fold Fold Smooth newt Diet: Insects, caterpillars, worms and slugs while on land; crustaceans, molluscs and tadpoles when in the water Wetland adaptations: Can breathe through their skin Classification: Vertebrate - Amphibian Habitat: Ponds in spring; woodland, grassland, hedgerows and marshes in summer and autumn; hibernates underground, among tree roots and under rocks and logs over winter Did you know? Their body gives out a poisonous fluid when they feel threatened -
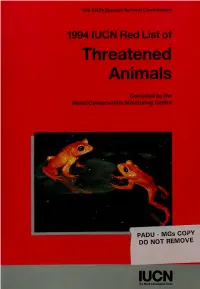
1994 IUCN Red List of Threatened Animals
The lUCN Species Survival Commission 1994 lUCN Red List of Threatened Animals Compiled by the World Conservation Monitoring Centre PADU - MGs COPY DO NOT REMOVE lUCN The World Conservation Union lo-^2^ 1994 lUCN Red List of Threatened Animals lUCN WORLD CONSERVATION Tile World Conservation Union species susvival commission monitoring centre WWF i Suftanate of Oman 1NYZ5 TTieWlLDUFE CONSERVATION SOCIET'' PEOPLE'S TRISr BirdLife 9h: KX ENIUNGMEDSPEaES INTERNATIONAL fdreningen Chicago Zoulog k.J SnuicTy lUCN - The World Conservation Union lUCN - The World Conservation Union brings together States, government agencies and a diverse range of non-governmental organisations in a unique world partnership: some 770 members in all, spread across 123 countries. - As a union, I UCN exists to serve its members to represent their views on the world stage and to provide them with the concepts, strategies and technical support they need to achieve their goals. Through its six Commissions, lUCN draws together over 5000 expert volunteers in project teams and action groups. A central secretariat coordinates the lUCN Programme and leads initiatives on the conservation and sustainable use of the world's biological diversity and the management of habitats and natural resources, as well as providing a range of services. The Union has helped many countries to prepare National Conservation Strategies, and demonstrates the application of its knowledge through the field projects it supervises. Operations are increasingly decentralised and are carried forward by an expanding network of regional and country offices, located principally in developing countries. I UCN - The World Conservation Union seeks above all to work with its members to achieve development that is sustainable and that provides a lasting Improvement in the quality of life for people all over the world. -

Poland in Spring
Poland in Spring Naturetrek Tour Report 12 - 19 May 2019 Aquatic Warbler by Richard Short Barred Warbler by Rob Campbell Red-necked Grebe by Rob Campbell Savi’s Warbler by Peter Dunn Report compiled by Peter J Dunn Images courtesy of Rob Campbell, Richard Short & Peter Dunn Naturetrek Mingledown Barn Wolf's Lane Chawton Alton Hampshire GU34 3HJ UK T: +44 (0)1962 733051 E: [email protected] W: www.naturetrek.co.uk Tour Report Poland in Spring Tour participants: Peter Dunn (Leader) & Piotr Tadeusz (local guide) with 11 Naturetrek Clients Day 1 Sunday 12th May Arrival Day Part of the group travelled with Peter from Heathrow on the early, non-eventful flight to Warsaw, arriving at around 11am European time, and met up with the remaining members and guide Piotr. We quickly located our midi-coach driven by Tomek (Thomas), loaded and set off out of Warsaw. The roads were quiet, being a Sunday and we made good speed, arriving at the Karmiza Restaurant earlier than expected so we sat and enjoyed a drink in the sunshine whilst our lunch was being prepared. This was a fine meal with a, ‘ham-hock’ main course and chocolate lava cake with ice cream to finish. An hour later and feeling well satisfied, we were on the road again, heading east. We started to see White Storks, Common Buzzard and Marsh Harriers as we drove along, and our first stop was a viewpoint to the Bug River near Brok. It had been a dry winter and spring, so water levels were down, but we still heard and saw Golden Orioles, Common Whitethroats, displaying Common Snipe, both Black and Common Redstart and heard a Wryneck. -

The Cambridge Film Festival
5-15 JULY 2007 www.cambridgefilmfestival.org.uk FUNDED BY: SPONSORED BY: MEDIA PARTNERS: WELCOME TO THE CAMBRIDGE FILM FESTIVAL CONTENTS NEWS 6 Well, another fine mess! Or, alternatively, another eclectic One really positive sign is the quality Heffer’s Award L Festival online L collection of world cinema, celebrating and highlighting new of our Festival submissions this Young Person’s Jury Festival Daily independent cinema and filmmakers working in a rapidly year. We have received over 800 THE PEOPLE’S FAVOURITE FILM AWARD 7 changing climate... films to view – shorts, features and SPECIAL EVENTS 8-13 documentaries. So many, in fact, The Festival once again brings together a huge range of OPENING AND CLOSING NIGHT FILMS 14 that we’ve decided to have a second films and related events: a programme of new German NEW FEATURES 16-39 event in late September to present a further collection from filmmakers’ work, curated by long time Festival filmmaker new filmmakers. We’re incredibly pleased that so many TIMETABLE 41-43 colleague, Monika Treut; five new titles from the London filmmakers are attending the Festival, so please give them NEW GERMAN CINEMA 44-45 Lesbian and Gay Festival; an enlarged, expanded your support – updated information will be in daily emails, Microcinema section covering artists’ films and events and DOCUMENTARIES 46-49 the Festival Daily, and the podcasts. a symposium at both the Junction and the Picturehouse. As CINECOLOGY 50-53 last year, we are also presenting a number of programmes Finally, it has been a challenge. Putting this Festival on MICROCINEMA 54-57 under FUTURE LANDSCAPE, free of charge and daily requires huge commitment from a team of people and REVIVALS 58-59 between Monday 9 and Friday 13 at 1.00 and 5.00pm. -

Dragonflies of La Brenne & Vienne
Dragonflies of La Brenne & Vienne Naturetrek Tour Report 14 - 21 June 2017 Orange-spotted Emerald female Southern Skimmer male Yellow-spotted Whiteface male Yellow Clubtail male Report compiled by Nick Ransdale Images courtesy of Graham Canny Naturetrek Mingledown Barn Wolf's Lane Chawton Alton Hampshire GU34 3HJ UK T: +44 (0)1962 733051 E: [email protected] W: www.naturetrek.co.uk Tour Report Dragonflies of La Brenne & Vienne Tour participants: Nick Ransdale (leader) & Cora Ransdale (driver) with ten Naturetrek clients Summary This two-centre holiday in central-western France gives an excellent insight into not only the dragonflies but also the abundant butterflies, birds and other wildlife of the region. The first two days are spent in the southern Vienne before we move on to the bizarre landscape of the Pinail reserve, and finally to Mezieres, where we spend three days in the Brenne; 'land of a thousand lakes'. The weather this year was remarkably hot: 37°C on the last two days - in the shade! Hot years often trend towards a good odonata list, and this year was no exception. Due to the sharp eyes, enthusiasm, flexibility and optimism of group members, the tour was a resounding success, scoring a total of 44 species (tour average 40), the vast majority seen by all members of the group. 97 bird species and 39 butterfly species were also found, together with a wide range of other insects and plants that the combined talents of the group helped to find and identify. Amongst the ‘star finds’ were both whitefaces, both 'spotted' emerald dragonflies, Lesser Emperor, Dusk Hawker, and Southern Skimmer. -

Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve Appendices
Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve Appendices APPENDICES Appendix 1. General location map 3 Appendix 2. Biosphere Reserve zonation map 5 Appendix 3. Land cover map 7 3a. Map: Land cover and vegetation for the northern part of the proposed biosphere reserve 7 3b. Map: Land cover and vegetation for the southern part of the proposed biosphere reserve 9 3c. Map: Land cover and vegetation for the Helgeån Ramsar Site 11 Appendix 4. List of legal documents 13 4a. Nature reserves, Natura 2000 sites and areas of national interest within the proposed biosphere 13-15 reserve 4b. Habitat protection areas and nature conservation agreements 17 Appendix 5. List of land use and management plans 19 Appendix 6. Species list 21-32 6a. Red List categories 21 6b. Globally red-listed species 22 6c. EU listed species 23 6d, 6e, 6f Nationally red-listed species 25-31 6g. Economically important species 32 Appendix 7. List of main bibliographic references 33 Appendix 8. Summary of environmental monitoring activities 35-40 Appendix 9. Photographs 41-48 Appendix 10. Letters of endorsement 10a. Letter of Endorsement from the Swedish MAB National Committee 49 10b. Letter of Endorsement from the Municipality of Kristianstad 53 10c. Letter of Endorsement from the County Administrative Board of Skåne 57 10d. Letter of Endorsement from the Swedish Environmental Protection Agency 61 10e. Letter of Endorsement from Region Skåne 65 10f. Letter of Endorsement from the Regional Forestry Board of Södra Götaland 69 10g. Letter of Endorsement from the Consultation Group for Nature Conservation in Kristianstads 73 Vattenrike 10h. Letter of Endorsement from Kristianstad University 77 10h. -

Government of Belarus (GOB)
UNDP Project Document Government of Belarus (GOB) United Nations Development Programme (UNDP) Global Environment Facility (GEF) Atlas Award ID: 00042261 Atlas Project ID: 00048429 Catalyzing sustainability of the wetland protected area system in Belarusian Polesie through increased management efficiency and realigned land use practices This project aims to enhance Belarus’ capacity to conserve wetland biodiversity harbored in its network of wetland reserves by enhancing the management efficiency of reserves, while at the same time integrating biodiversity conservation concerns in agricultural, forestry and flood protection activities that occur in and around wetland reserves, to ensure sustainability of conservation efforts. This will be achieved through the demonstration of this approach at four wetland reserves in the Polesie lowland, which is a unique biogeographical area spanning southern Belarus, Northern Ukraine and parts of Poland and Russia. These demonstrations will lead to the development of policies, tools, and methodologies, and these will be institutionalized within the ongoing planning and policy framework of key government bodies. In order to secure biodiversity values of wetland reserves and reduce threats emanating from unsustainable land use practices, the project approach will be twofold: (1) the project will build up management effectiveness and capacities of the reserves, and (2) it will also help realigning land use regulations and practices in and around wetland protected areas towards conservation-oriented and sustainable land use. In doing so, the project will work with national and regional decision-makers, land users and local communities, as well as counterparts in Ukraine. Finally, the project will develop and implement a viable replication strategy. By demonstrating the feasibility of integrating biodiversity considerations and economic activities in Polesie reserves, Government of Belarus will be able to strengthen the overall system, 60-75% of which consists of protected areas facing similar challenges. -

Management of Water and Trees on Raised Bogs Papers and Transcripts from a Lowland Peatland Workshop Held at Hanmer, 10-12 June 1997 No
Management of water and trees on raised bogs Papers and transcripts from a lowland peatland workshop held at Hanmer, 10-12 June 1997 No. 407 - English Nature Research Reports working today for nature tomorrow English Nature Research Reports No. 407 Management of water and trees on raised bogs Papers and transcripts from a conference held at Hanmer 10-12th June 1997 Edited by Sarah Whild, Roger Meade and Joan Daniels You may reproduce as many additional copies of this report as you like, provided such copies stipulate that copyright remains with English Nature, Northminster House, Peterborough PE1 1UA ISSN 0967-876 © English Nature 2001 2 Contents Introduction............................................................................................................................................................... 3 The context – Paper 1: Setting the scene for what follows (Roger Meade)................................................................................... 4 1 Theme: Stopping the gaps - techniques for controlling water · The Welsh Perspective (Peter Jones)................................................................................................................. 7 · The Scottish Perspective (Neil Wilcox).............................................................................................................. 7 · The English Perspective (John Bacon).............................................................................................................. 8 Fenn’s Whixall and Bettisfield Mosses NNR visit (Joan Daniels)........................................................................ -

Documentation Training Course Broads 2002
Documentation of the Training Course WETLANDS FOR LIFE A Training Course in Wetland Management and Restoration Norwich, Great Britain 30 September - 5 October 2002 With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Community Content 1 Introduction.....................................................................................................................3 2 Presentations..................................................................................................................3 2.1 Welcome and Introduction to the Trainings course: A National Park - Dr John Packman, Broads Authority ............................................................................................3 2.2 Introduction to the Broads - Andrea Kelly, Broads Authority ..........................................7 2.3 Understanding the hydrology of wetlands - Dr Kevin Hiscock, University of East Anglia............................................................................................................................10 2.4 Water quality and its restoration ...................................................................................14 2.4.1 Cleaning up after nutrient enrichment - Rory Sanderson, Environment Agency ..........14 2.4.2 Biomanipulation and the way forward - Andrea Kelly, Broads Authority.......................19 2.5 Fen and drained marshes: their management and restoration.....................................22 2.5.1 History of fens and their management - Rob Andrews, Broads Authority ....................22 2.5.2 -

Herpetological Bulletin
The HERPETOLOGICAL BULLETIN Number 78 — Winter 2001 Obituary: HUBERT SAINT-GIRONS, 1926-2001 • An early herpetological document by Georg Segerus, physician to the Polish Kings • Project Anuran: a multi-species monitoring project in Belize • A case study in the evolution of Crested Newt conservation • Death from pesticides reviewed among amphibians in sub-Saharan Africa • Effects of flood on an isolated population of Sand Lizards in Poland • Unusual mortality among Sand Lizards in Dorset, U.K. THE HERPETOLOGICAL BULLETIN The Herpetological Bulletin (formerly the British Herpetological Society Bulletin) is produced quarterly and publishes, in English, a range of articles concerned with herpetology. These include full-length papers of mostly a semi-technical nature, book reviews, letters from readers, society news, and other items of general herpetological interest. Emphasis is placed on natural history, conservation, captive breeding and husbandry, veterinary and behavioural aspects. Articles reporting the results of experimental research, descriptions of new taxa, or taxonomic revisions should be submitted to The Herpetological Journal (see inside back cover for Editor's address). ISSN 1473-0928 The British Herpetological Society. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without the permission of the Editor. Printed by Metloc Printers Limited, Old Station Road, Loughton. Essex. Information for contributors 1. Contributions should be submitted in hard copy form (2 copies of manuscript, double-spaced) AND on computer diskette in Windows format only. The Bulletin is typeset directly from the author's diskette, so wherever possible all manuscripts should be prepared using a word-processor. Please indicate word-processing software used, and if possible also include a text-only version of the file.