Selbstporträt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dark Side of the Boom
dark side of the boom The Excesses of the Art Market in the Twenty-first Century Georgina Adam dark side of the boom First published in 2017 by Lund Humphries Office 3, 261a City Road London ec1v 1jx UK www.lundhumphries.com Copyright © 2017 Georgina Adam isbn Paperback: 978-1-84822-220-5 isbn eBook (PDF): 978-1-84822-221-2 isbn eBook (ePUB): 978-1-84822-222-9 isbn eBook (ePUB Mobi): 978-1-84822-223-6 A Cataloguing-in-Publication record for this book is available from the British Library. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electrical, mechanical or otherwise, without first seeking the permission of the copyright owners and publishers. Every effort has been made to seek permission to reproduce the images in this book. Any omissions are entirely unintentional, and details should be addressed to the publishers. Georgina Adam has asserted her right under the Copyright, Designs and Patents Act, 1988, to be identified as the Author of this Work. Designed by Crow Books Printed and bound in Slovenia Cover: artwork entitled $ made from reflector caps, lamps and an electronic sequencer, by Tim Noble and Sue Webster and One Dollar Bills, 1962 and Two Dollar Bills by Andy Warhol, hang on a wall at Sotheby’s in London on June 8, 2015. Photo: Adrian Dennis/AFP/Getty Images. For Amelia, Audrey, Isabella, Matthew, Aaron and Lucy Contents Introduction 9 Prologue: Le Freeport, Luxembourg 17 PART I: Sustaining the Big Bucks market 25 1 Supply 27 2 Demand: China Wakes 51 Part II: A Fortune on your Wall? 69 3 What’s the Price? 71 4 The Problems with Authentication 89 5 A Tsunami of Forgery 107 Part IiI: Money, Money, Money 127 6 Investment 129 7 Speculation 149 8 The Dark Side 165 Postscript 193 Appendix 197 Notes 199 Bibliography 223 Index 225 introduction When my first book, Big Bucks, the Explosion of the Art Market in the 21st Century, was published in 2014 the art market was riding high. -

FOE Issue Special May-16.Indd
FAMILY OFFICE ELITE SPECIAL EDITION BNY Mellon Cory McCruden FAMILY OFFICES - UHNWI - WEALTH - PHILANTHROPY- FINE ART - LUXURY - LIFESTYLE Subscription $100 per year www.familyoffi ceelite.com DOMOS FINE ART FINE ART DOMOS CONSULTANTS DOMOS FINE ART has a portfolio of very Fine Art on sale (Off Market) on behalf of our clients which include works by Caravaggio, Renoir, Monet, Van Gogh, Matisse, Rembrandt, Picasso, Rouault, Bonnard, Raphael and more. DOMOS FINE ART is experienced in dealing We off er the following services with rare off -market Valuation and Sale of Fine Art collections of fi ne art. Locate specifi c pieces of Fine Art Assist in verifying provenance of Art Auction representation UK Offi ce | TEL: + 44 (0) 29 2125 1994 | SKYPE: domosfi neart | [email protected] | www.domos.co.uk FAMILY OFFICEELITE MAGAZINE WHAT IS A FINE ART FAMILY OFFICE US CONGRESS INVESTING ENACT NEW TAX FOR FAMILY OFFICES EXAMINATION 03CAPLIN & DRYSDALE 37 ROLLS ROYCE BERNIE MADOFF BLACK BADGE THE INSIDE STORY ON 25 EXPOSING MADOFF FRANK CASEY 11 43 VIDEO ADVERTS MAYBACH THE FUTURE OF ADVERTISING SESURITY & PROTECTION WITH THE 600 GUARD 17 53 IMPACT INVESTING FAMILY OFFICE IN THE FAMILY OFFICE MULTI-FAMILY OFFICE SELECTION HOLLAND & HOLLAND 21 EXPLORE THE WORLD OF 57 ANTIQUE WEAPONS AFRICA THE SAFRA OPPORTUNITIES FOR FOUNDATION FAMILY OFFICES SAFRA FOUNDATION MAKES ING BANK DONATION TO CLINATEC 25 35 61 1 FAMILY OFFICE ELITE MAGAZINE GULF STREAM 63 100TH G-560 COREY McCRUDEN Cory McCruden BNY Mellon HADHUNTERS 71 Wealth Management, Advisory Services PROPER EXECUTIVE PLACEMENT SUPERYACHT 73 CHARTER - LUXURY VACATION FAMILY OFFICE 7 WHAT TO DO WITH CASH 77 MAN-VS-MACHINE INVESTMENT MANAGEMENT 79 PRIVATE BANKS 83 WITH AN INVESTMENT FLOVOUR AUTHENTICITY IN THE ART MARKET 95 IMPACT AND 101 PHILANTHROPY OTHER STORIES.. -

«Beauty Is the True Scandal in Today's Art»
6/28/2018 "Beauty is the true scandal in today's art" | NZZ INTERVIEW «Beauty is the true scandal in today's art» Wolfgang Beltracchi has made a career as an art forger and was convicted. Now he leads a second life as an artist with his own handwriting. He keeps little of the genius cult - as well as of the international art scene, which celebrates the ugly above all. In a big interview he disenchanted the myths of the art business. René Scheu 26.6.2018, 05:30 clock Mr. Beltracchi, when you perform or exhibit, people come in droves. Then fall reliably the predicates "master counterfeiters" or "century counterfeiters". What sound do these words have for you? Oh. Hm. "Master" is not bad. (Consider.) Look: I see myself as a master painter, that's how I really understand myself, as a master of my craft. I have, I believe, sufficiently proven that I master the subject. ADVERTISING inRead invented by Teads Alone, art is more than painting – or has the 20th century not taken place in your eyes? https://www.nzz.ch/feuilleton/schoenheit-ist-in-der-heutigen-kunst-das-wahre-skandalon-ld.1397738 1/15 6/28/2018 "Beauty is the true scandal in today's art" | NZZ Yes, yes, something has already happened. And art history is also one of my hobbyhorses. Only, I'm not one of those who think that art has to be ugly and repulsive so that it turns out to be art. That would mean that fine art is not art. -

Expert Found Liable for Opinion on Fake Max Ernst Painting Peter Bert Posted on May 28, 2013
AUTHENTICATION IN ART Art News Service Art Law: Expert Found Liable For Opinion On Fake Max Ernst Painting Peter Bert Posted on May 28, 2013 Le Monde reported yesterday that art historian and former Centre George Pompidou director Werner Spies had been ordered to pay damages in the order of EUR 650,000 to the purchaser of a painting. Tremblement de terre purportedly was a work of Max Ernst. Spies, a world-leading expert on Max Ernst and Pablo Picasso, had, according to the Tribunal de grande instance de Nanterre, authenticated the painting and delivered an expert opinion on which the purchaser had relied. Tremblement de terre, however, turned out to be fake. It had been produced by Wolfgang Beltracchi, the man at the centre of Germany’s biggest art scandal for decades. The Economist, in an article at the end of last year, concluded that “fear of litigation is hobbling the art market“. The Economist looked at the reactions of various foundations and authentication boards to the rising litigation risk, with most of the examples being drawn from the United States. There, the Andy Warhol Foundation dissolved its authentication board as a result of enormous legal costs incurred in defending claims by collectors. The Keith Haring Foundation stopped authenticating works, as did the Roy Lichtenstein Foundation. This new French judgment and a similar judgment by the District Court (Landgericht) Cologne of September 2012 which held auction house Lempertz liable over a fake Heinrich Campendonk painting, also by Beltracchi, appear to indicate that in Europe, in the wake of the Beltracchi scandal, the legal risks to experts and auction houses are also increasing. -
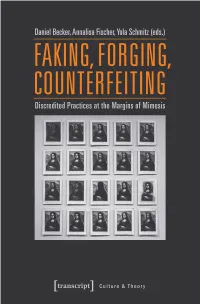
Faking, Forging, Counterfeiting
Daniel Becker, Annalisa Fischer, Yola Schmitz (eds.) Faking, Forging, Counterfeiting Daniel Becker, Annalisa Fischer, Yola Schmitz (eds.) in collaboration with Simone Niehoff and Florencia Sannders Faking, Forging, Counterfeiting Discredited Practices at the Margins of Mimesis Funded by the Elite Network of Bavaria as part of the International Doctoral Program MIMESIS. An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libraries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access for the public good. The Open Access ISBN for this book is 978-3-8394-3762-9. More information about the initiative and links to the Open Access version can be found at www.knowledgeunlatched.org. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommer- cial-NoDerivs 4.0 (BY-NC-ND) which means that the text may be used for non- commercial purposes, provided credit is given to the author. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. To create an adaptation, translation, or derivative of the original work and for commercial use, further permission is required and can be obtained by contac- ting [email protected] © 2018 transcript Verlag, Bielefeld Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Na- tionalbibliografie; detailed bibliographic data are available in the Internet at http://dnb.d-nb.de Cover concept: Maria Arndt, Bielefeld -

Beltracchi - Die Kunst
Präsentiert BELTRACCHI - DIE KUNST DER FÄLSCHUNG Ein Film von Arne Birkenstock Kinostart: 06. März 2014 PRESSEHEFT Beltracchi - Die Kunst der Fälschung 1 PRESSEBETREUUNG: Panorama Entertainment Senator Film Verleih GmbH Amélie Linder Antje Pankow (Leitung Publicity) Elena Schäfer Thalkirchner Straße 45 Schönhauser Allee 53 80469 München 10437 Berlin Tel: 089 / 30 90 679 – 33 /34 Tel: 030 / 880 91 - 799 Fax: 089 / 30 90 679 -11 Fax: 030 / 880 91 - 703 E-Mail: [email protected], E-Mail: [email protected] [email protected] VERTRIEB: Central Film Verleih GmbH Keithstr. 2-4 10787 Berlin Tel: 030 / 214922-00 MATERIAL / INFORMATIONEN: Über unsere Homepage www.senator.de haben Sie die Möglichkeit, sich für die Presse-Lounge zu akkreditieren. Dort stehen Ihnen alle Pressematerialien, Fotos und viele weitere Informationen als Download zur Verfügung. EPK und APK werden nach vorheriger Anmeldung unter www.digital-epk.de zum Download bereitgestellt. Beltracchi - Die Kunst der Fälschung 2 INHALT STAB & MITWIRKENDE TECHNISCHE DATEN KURZINHALT & PRESSENOTIZ INHALT INTERVIEW MIT ARNE BIRKENSTOCK BIOGRAFIEN / STAB Arne Birkenstock Markus Winterbauer Katja Dringenberg Der Protagonist Wolfgang Beltracchi KLEINES LEXIKON EUROPÄISCHER KUNSTFÄLSCHER Beltracchi - Die Kunst der Fälschung 3 STAB Regie ARNE BIRKENSTOCK Produzenten ARNE BIRKENSTOCK THOMAS SPRINGER HELMUT G. WEBER Koproduzenten THOMAS WEYMAR HELGE SASSE Kamera MARCUS WINTERBAUER Montage KATJA DRINGENBERG Ton PATRICK VEIGEL LUDWIG BESTEHORN Mischung MALTE -

Greatest Fakers in the World | Counterfeit
Worlds most famous fakes, Famous art forgers, famous fakes, famous fakers, Fake paintings, fake signatures, fake drawings, fake picasso, Worlds Greatest Forgers, Copyists & Fakers - Art Fraud, Art forgery- forgers, faking art - fake paintings, art crime, The world's most famous and greatest art forgers and fakers HOME PROFILE CONTACT The Fine Art of Faking The faces of the world's greatest art fakers forgers and fraudsters ART FRAUD AND FORGERY INFORMATION ARCHIVE FROM INTERNATIONAL ART AUTHENTICATION EXPERTS THE FREEMANART CONSULTANCY ___________________________________________________________________________________________________________________ Arty-Fact: Art fraud and forgery dates back more than 2000 years. Arty-Fact: The Freemanart Consultancy who specialise soley in art authentication and art fraud investigations, see more FAKE Pablo Picasso drawings, prints watercolors and oil paintings than any other artists work. On average, about a dozen a week! All about the Worlds Greatest Forgers, Copyists & Fakers (Arranged here by time frame) The Romans. CONTENTS: The Romans. Assiduously copied Greek sculptures, many of which were sold believed to be originals by their purchasers. The Chinese. 14C Italian stone carvers. Jacopo di The Chinese generally! Poggibonsi'. Faking in China dates from at least the Sung Dynasty (960-1280) when the wealthy began to collect art. Forged paintings were Piero del Pollaiuolo. mostly made by students seeking to imitate the masters. It still seems a common practice! Michelangelo. Giovanni Cavino. Pirro Ligorio. 14th century, Italian stone carvers: Hendrik Goltzius. The stone carvers lead the way in commercially forgery, faking works of art by imitating Greek and Roman master craftsmen and Pieter Brueghel the creating sculptures which could and were to be sold to the rich as authentic antiques! Much the same tale as that of their Roman Younger. -

A Not-Quite-Great Documentary About the Greatest Art Forger of Our Time by Benjamin Sutton on August 21, 2015
AiA Art News-service A Not-Quite-Great Documentary About the Greatest Art Forger of Our Time by Benjamin Sutton on August 21, 2015 Wolfgang Beltracchi in Arne Birkenstock’s documentary ‘Beltracchi: The Art of the Forgery’ (all photos © Fruitmarket / Wolfgang Ennenbach, courtesy of KimStim) “I think I can paint anything,” says Wolfgang Beltracchi, the infamous German art forger, in Arne Birkenstock’s 2014 documentary Beltracchi: The Art of Forgery, which opened Wednesday at Film Forum in New York. And he did, at least by his own account, which is the one that gets the most traction here. In addition to the 14 fakes he admitted to painting during his trial in 2011 — attributed to André Derain, Kees van Dongen, Max Ernst, Fernand Léger, Heinrich Campendonk, and Max Pechstein — he claims that nearly 300 more he made remain in circulation as authentic works by modern masters. Beltracchi and his wife, Helene, became the subjects of a media frenzy in 2010, as their scheme to sell the paintings — strategically created to fill gaps in desirable artists’ catalogues or resemble works they might have painted — unravelled. If you followed the story then, you won’t learn much from this very engrossing but disorganized documentary by the son of the Beltracchis’ legal counsel; if you didn’t, you will emerge with many questions. But what it lacks in clarity and chronological cohesion, The Art of Forgery makes up for in access. Interviews with the Beltracchis and footage of Wolfgang working in his studio make up the bulk of the film. Birkenstock evidently spent years visiting the couple, first at their estates in Mèze in the south of France and Freiburg in Germany (both since seized and sold off to repay the people they deceived) and later at the art studio in Cologne where they met during the day while serving out their respective sentences (six years for him, four for her) at night in open prisons. -

The Secret of the Forest
The Secret of The Forest About ten days before Christmas in 2003, Werner Spies, one of the world’s pre-eminent experts on 20th-century art, took the train from Paris to the picturesque port of Sète on the Mediterranean coast. Spies, a specialist in the works of the painter Max Ernst, was coming to look at and hopefully authenticate an Ernst painting that had been unknown to him – and thus unknown to the art world – until earlier that year. The painting was La Forêt (The Forest) and, although it was undated, Spies thought it had been painted in 1927. Ernst produced a number of ‘forest’ paintings around that time; they are considered among his most important works. Spies had previously authenticated another Ernst work, Oiseau en Hiver, which was then sold for €500,000. But the scientific analysis suggested that there was some doubt about La Forêt. It apparently included traces of two pigments which had generally only been used by artists after 1945. Spies, however, preferred to trust his own judgement and because La Forêt was not dated, he believed Ernst might have used the pigments at an early experimental stage. But he wanted to look at the painting to make sure. English File third edition Advanced • Student’s Book • Unit 7B, pp.70–71 © Oxford University Press 20 15 1 Helene and Wolfgang Beltracchi in their studio The following morning, Helene Beltracchi picked up Spies and drove him to the beautiful Beltracchi estate. Helene was 45 and a striking woman – intelligent, cultured, animated, with thick, blonde hair almost to her waist. -

The Art of Forgery
BELTRACCHI The Art of Forgery A FILM BY ARNE BIRKENSTOCK US distribution KimStim 417 13th Street #2 Brooklyn, NY 11215 www.kimstim.com [email protected] Press Contact For NYC screening Adam Waker [email protected] Tel: 212.627.2035 x306 A mesmerizing, thought-provoking yet surprisingly amusing documentary on the life and times of Wolfgang Beltracchi, who tricked the international art world for nearly 40 years by forging and selling paintings of early 20th-century masters. A larger-than-life personality who was responsible for the biggest art forgery scandal of the postwar era. Synopsis: For nearly 40 years, Wolfgang Beltracchi fooled the international art world and was responsible for the biggest art forgery scandal of the postwar era. An expert in art history, theory and painting techniques, he tracked down the gaps in the oeuvres of great artists – Max Ernst, Fernand Léger, Heinrich Campendonk, André Derain and Max Pechstein, above all – and filled them with his own works. He and his wife Helene would then introduce them to the art world as originals. What makes these forgeries truly one-of-a-kind is that they are never mere copies of once-existing paintings, but products of Beltracchi’s imagination, works “in the style of” famous early 20th-century artists. With his forgeries, he fooled renowned experts, curators and art dealers. The auctioneers Sotheby’s and Christie’s were hoodwinked, just like Hollywood star Steve Martin and other collectors throughout the world. It was ultimately Beltracchi’s own success that brought him down. Passed off as an original Heinrich Campendonk and regarded by specialists as a “key work of modern- ism,” Beltracchi’s “Red Painting with Horses, 1914” was sold at auction for a record 2.8 million Euros. -
Falsificação E Autenticidade: a Arte Como Convenção
UNESP – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO CAMPUS DE SÃO PAULO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES MARLON JOSÉ ALVES DOS ANJOS FALSIFICAÇÃO E AUTENTICIDADE: A ARTE COMO CONVENÇÃO São Paulo 2016 MARLON JOSÉ ALVES DOS ANJOS FALSIFICAÇÃO E AUTENTICIDADE: A ARTE COMO CONVENÇÃO Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Artes, do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista – Unesp, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Artes Visuais, área de concentração: processos e procedimentos artísticos. Orientador: Prof. Dr. Sérgio Mauro Romagnolo São Paulo 2016 Ficha catalográfica preparada pelo Serviço de Biblioteca e Documentação do Instituto de Artes da UNESP A599f Anjos, Marlon José Alves dos, 1988- Falsificação e autenticidade: a arte como convenção / Marlon José Alves dos Anjos. - São Paulo, 2016. 149 f. : il. color. Orientador: Prof. Dr. Sérgio Mauro Romagnolo Dissertação (Mestrado em Artes) – Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, Instituto de Artes. 1. Arte - Falsificações. 2. Arte - Filosofia. 3. Arte – análise, apreciação. I. Romagnolo, Sérgio Mauro. II. Universidade Estadual Paulista, Instituto de Artes. III. Título. MARLON JOSÉ ALVES DOS ANJOS FALSIFICAÇÃO E AUTENTICIDADE: A ARTE COMO CONVENÇÃO Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Artes, do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista – Unesp, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Artes Visuais, área de concentração: processos e procedimentos artísticos. Orientador: Prof. Dr. Sérgio Mauro Romagnolo Defesa apresentada em, 30 junho de 2016 BANCA EXAMINADORA __________________________________________ Orientador Prof. Dr. Sérgio Mauro Romagnolo UNESP __________________________________________ Prof. Dr. José Leonardo Nascimento UNESP __________________________________________ Prof. Dr. Luiz César Marques Filho UNICAMP São Paulo 2016 AGRADECIMENTOS Muitos amigos me ajudaram a escrever esta dissertação. -

Gula, Eller Bukformationer Hos Bosch Och Bruegel
http://www.diva-portal.org Postprint This is the accepted version of a chapter published in What Images Do. Citation for the original published chapter: Bäcklund, J. (2019) The Invisible Image and the Index of an Imaginary Order In: Jan Bäcklund, Henrik Oxvig, Michael Rennes, Martin Søberg (ed.), What Images Do (pp. 265-282). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag N.B. When citing this work, cite the original published chapter. Permanent link to this version: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-92416 The Invisible Image and the Index of an Imaginary Order Jan Bäcklund The most conspicuous feature of any Old Master Exhibition or scholarly monograph on an Old Master Painter today is the abundance of transilluminations of the picture surface. X-ray, Infra-red, raking-light photographs, dendrochronological—or thread-count—diagrams, pigment analysis through Scanning Electron Microscopes and many other physical and chemical methods of dismemberment and analysis of the picture are used to determine the correct attribution. This is said to be done in conjunction with another measurement: traditional connoisseurship, which is just another art historical self-delusion. In reality, the technical investigation of art works has everything to say and connoisseurship nothing. No visual argument can be upheld against technical data, whereas the opposite happens all the time; technical data always, without exception, trumps connoisseurship. This is because the display of technical data is not in itself a visual form of knowledge, but visualized logical arguments. Examples of this feature are countless, but one of the best articulated attempts in this regard was the Vienna exhibition of Giorgione in 2004, “Giorgione.