Die Zeitgenössische Landschaftsmalerei In
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Waldlandschaft Mit Reiter Waldlandschaft Mit Einem Wehr
Ferdinand Kobell (?) oder Ferdinand Kobell (?) oder Nachfolger Nachfolger Waldlandschaft mit Reiter Waldlandschaft mit einem Wehr Pr381 / M165 / Kasten 7 Pr382 / M166 / Kasten 7 Pr381 / Waldlandschaft mit Reiter Pr382 / Waldlandschaft mit einem Wehr Historisches Museum Frankfurt (15.04.2021) 1 / 6 Ferdinand Kobell Mannheim 1740–1799 München Bruder des Franz (1749–1822), Vater von ĺ Wilhelm von Kobell. Zunächst Studium der Rechte an der Heidelberger Universität 1756–60 mit dem Abschluss des juristischen Staatsexamens, danach Sekretär im Hofdienst des Kurfürsten Carl Theodor in Mannheim. Möglicherweise erste Unterweisungen durch den Mannheimer Galeriedirektor ĺ Philipp Hieronymus Brinckmann. Ab 1762 Befreiung vom Hofdienst und Studium an der Mannheimer Zeichnungs-Akademie unter Pieter Antonie von Verschaffelt (1710–1793). 1764 Heirat mit Maria Theresia Lederer. 1768 bis 1770 Reise nach Paris, wo er sich bei Johann Georg Wille (1715–1808) in der Technik des Radierens unterrichtete. 1771 Ernennung zum Kabinetts-Landschafts-Maler. 1793 Umzug nach München, wo er 1798 zum Direktor der aus Mannheim überführten Gemäldegalerie ernannt wurde. Sein Spezialgebiet sind Landschaften (sowohl ideale als auch Veduten) und Gernemalerei. Vorbildlich war die niederländische Kunst des Goldenen Zeitalters, insbesondere die Italianisanten wie ĺ Nicolaes Berchem oder ĺ Jan Both, aber auch Allart van Everdingen (1621–1675) oder ĺ Antonie Waterloo. Neben Galerie- und Kabinettbildern schuf Kobell Supraporten und andere Raumausstattungen, daneben ein reiches Œuvre an Zeichnungen und Radierungen, wobei sein Schaffensdrang in den Münchner Jahren fast gänzlich zum Erliegen kam. Werke im Prehn'schen Kabinett Pr381, Pr382 Literatur Stengel 1822 (Wvz. Radierungen); Nagler, Bd. 7 (1839), S. 91–99 (mit Wvz. Radierungen); Biedermann 1973 (Wvz. Gemälde); Gesche 1993/94, bes. -

Revision and Exploration German Landscape
REVISION AND EXPLORATION GERMAN LANDSCAPE DEPICTION AND THEORY IN THE LATE 18TH CENTURY Ph.D. Thesis History of Art University College London Mark A. Cheetham June, 1982 THESIS ABSTRACT "Revision and Exploration: German Landscape Depiction and Theory in the Late Eighteenth Century" My thesis focuses on the work of German painters in Italy c.l770-1800, and addresses issues raised by their complex relationship with the 17th century Italianate landscape tradition. Jakob Philipp Hackert (1737-1807), Johann Christian Reinhart (1761-1847), and Joseph Anton Koch (1768- 1839) worked in Italy precisely because they considered them- selves to be thg inheritors of the 17th century landscape style of Claude, Dughet, Rosa, and Nicolas Poussin. But while the German paintings do resemble the earlier works, they also revise the 17th century programme of representing Ideal nature. They are more detailed and precise in their depiction of natural phenomena; they also represent natural events and sites not included in the traditional canon. Extrapolating from 18th century critical terminology, I have developed the term "particularity" to focus attention on this unprecedented attentiontt the details of nature. I argue that the late 18th century German landscapes revise the Italianate landscape tradition so that it embodies particularity, and that the impetus for this change comes from two contemporary sources: natural history -- especially the nascent sciences of geology and biology -- and art theory. My argument is divided into three sections. In the first, I establish the existence and visual characteristics of particu- larity first by contrasting 17th century versions of the famous cascades at Tivoli (by Claude, Dughet, and others) with depic- tions of the same site by late 18th century German artists, and second, by describing the new sites which were explored and depicted by Hackert, Reinhart, and Koch. -
Engraving and Etching; a Handbook for The
CORNELL UNIVERSITY LIBRARY GIFT OF Geoffrey Steele FINE ARTS Cornell University Library NE 430.L76 1907 Engraving and etching; a handbook for the 3 1924 020 520 668 Cornell University Library The original of tiiis book is in tine Cornell University Library. There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text. http://www.archive.org/details/cu31924020520668 ENGRAVING AND ETCHING ENGRAVING AND ETCHING A HANDBOOK FOR THE USE OF STUDENTS AND PRINT COLLECTORS BY DR. FR. LIPPMANN LATE KEEPER OF THE PRINT ROOM IN THE ROYAL MUSEUM, BERLIN TRANSLATED FROM THE THIRD GERMAN EDITION REVISED BY DR. MAX LEHRS BY MARTIN HARDIE NATIONAL ART LIBRARY, VICTORIA AND ALBERT MUSEUM WITH 131 ILLUSTRATIONS ^ „ ' Us NEW YORK: CHARLES SCRIBNER'S SONS^;.,j^, 153—157 FIFTH AVENUE 1907 S|0 PRINTED BY HAZELL, WATSON AND VINEY, LD. LONDON AND AYLESBURY, ENGLAND. PREFACE TO THE FIRST EDITION '' I ^HE following history of the art of engraving closes -*• approximately with the beginning of the nine- teenth century. The more recent developments of the art have not been included, for the advent of steel- engraving, of lithography, and of modern mechanical processes has caused so wide a revolution in the repro- ductive arts that nineteenth-century engraving appears to require a separate history of its own and an entirely different treatment. The illustrations are all made to the exact size of the originals, though in some cases a detail only of the original is reproduced. PREFACE TO THE THIRD EDITION FRIEDRICH LIPPMANN died on October 2nd, to 1903, and it fell to me, as his successor in office, undertake a fresh revision of the handbook in preparation for a third edition. -
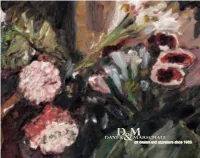
Daxer & M Arschall 20 17
XXIV Daxer & Marschall 2017 Recent Acquisitions, Catalogue XXIV, 2017 Barer Strasse 44 | 80799 Munich | Germany Tel. +49 89 28 06 40 | Fax +49 89 28 17 57 | Mob. +49 172 890 86 40 [email protected] | www.daxermarschall.com 2 Paintings, Oil Sketches and Sculpture, 1760-1940 My special thanks go to Simone Brenner and Diek Groenewald for their research and their work on the text. I am also grateful to them for so expertly supervising the production of the catalogue. We are much indebted to all those whose scholarship and expertise have helped in the preparation of this catalogue. In particular, our thanks go to: Paolo Antonacci, Helmut Börsch-Supan, Thomas le Claire, Sue Cubitt, Eveline Deneer, Roland Dorn, Christine Farese Sperken, Stefan Hammenbeck, Kilian Heck, Gerhard Kehlenbeck, Rupert Keim, Cathrin Klingsöhr-Leroy, Isabel von Klitzing, Anna-Carola Krausse, Marit Lange, Bjørn Li, Philip Mansmann, Verena Marschall, Sascha Mehringer, Werner Murrer, Hans-Joachim Neidhardt, Max Pinnau, Klaus Rohrandt, Annegret Schmidt-Philipps, Anastasiya Shtemenko, Gerd Spitzer, Talabardon & Gautier, Niels Vodder, Vanessa Voigt, Diane Webb, Gregor J. M. Weber, Wolf Zech. Our latest catalogue Oil Sketches, Paintings and Unser diesjähriger Katalog Oil Sketches, Paintings and Sculpture, 2017 Sculpture, 2017 comes to you in good time for this erreicht Sie pünktlich zum Kunstmarktereignis des Jahres, TEFAF, The year’s TEFAF, The European Fine Art Fair in Maas- European Fine Art Fair, Maastricht, 9. - 19. März 2017. tricht. TEFAF is the international art market high point of the year. It runs from 9 to 19 March 2017. Der Katalog präsentiert Werke, die unseren qualitativen und ästhetischen Maßstäben gerecht werden. -

Daxer & M Arschall 20 18
Daxer & Marschall 2018 Marschall & Daxer Barer Strasse 44 - D-80799 Munich - Germany Tel. +49 89 28 06 40 - Fax +49 89 28 17 57 Mobile +49 172 890 86 40 [email protected] - www.daxermarschall.com XXV Recent Acquisitions, Catalogue XXV, 2018 Barer Strasse 44 | 80799 Munich | Germany Tel. +49 89 28 06 40 | Fax +49 89 28 17 57 | Mob. +49 172 890 86 40 [email protected] | www.daxermarschall.com Paintings, Oil Sketches and Sculpture, 1480-1930 2 My special thanks go to Simone Brenner and Diek Groenewald for their research and their work on the texts. I am also grateful to them for so expertly supervising the production of the catalogue. We are much indebted to all those whose scholarship and expertise have helped in the preparation of this catalogue. In particular, our thanks go to: Leena Ahtola-Moorhouse, Hermann Arnhold, Peter Axer, Gerd Bartoscheck, Brigitte Buberl, Dieter Cöllen, Sue Cubitt, Jürgen Ecker, Daniel Hess, Wouter Kloek, Valentin Kockel, Anna-Carola Krausse, Marit Lange, Georg Laue, Bjørn Li, Angelika & Bruce Livie, Philipp Mansmann, Verena Marschall, Petra Marx, Sascha Mehringer, Werner Murrer, Claudia Nordhoff, Marco Pesarese, Christina Pucher, Hermann A. Schlögl, Annegret Schmidt-Philipps, Ines Schwarzer, Gerd Spitzer, Andreas Stolzenburg, Jesper Svenningsen, Thea Vignau-Wilberg, Vanessa Voigt, Diane Webb, Michelle Wittmann, Wolf Zech. 4 Our latest catalogue – Paintings, Oil Sketches, and Unser diesjähriger Katalog Paintings, Oil Sketches, and Sculpture, 2018 Sculpture, 2018 – comes to you in good time for erreicht Sie rechtzeitig vor dem wichtigsten Kunstmarktereignis des Jahres, this year’s TEFAF, The European Fine Art Fair in TEFAF, The European Fine Art Fair, Maastricht, 10. -

Die Historische Ausstellung Zur Jahrhundertfeier Der Freiheitskriege Breslau 1913
DIE HISTORISCHE AUSSTELLUNG ZUR JAHRHUNDERTFEIER DER FREIHEITSKRIEGE BRESLAU 1913 IM AUFTRAGE DER KÖNIGLICHEN HAUPT= UND RESIDENZSTADT BRESLAU HERHUSGEGEBEN VON KHRL MHSNER u n d ERWIN HINTZE 100 TAFELN UND VIELE ABBILDUNGEN IM TEXTE SELBSTVERLAG DER STADT BRESLAU VERTRETEN DURCH FERDINAND HIRT, KÖNIGLICHE UNIVERSITÄTS* UND VERLAGSBUCHHANDLUNG IN BRESLAU, KÖNIGSPLATZ 1 BRESLHU IM KRIEGS JAHRE 1916 ¡M IVlGcô, e . r t * f i -128985 INHALTSVERZEICHNIS Geschichte der Ausstellung .................................................................Seite 1 Rundgang durch die Ausstellung................................................. 5 Beschreibung der Tafeln ........................................................... 41 Tafeln I— C VERZEICHNIS DER TAFELN 1 Friedrich Wilhelm III., Bild von Lawrence 23 Henckel von Donnersmarck, Miniatur von 2 Friedrich Wilhelm III., Bild von Lieder Schmeidler 3 Friedrich Wilhelm III., Büste von Rauch 24 Hedemann, Bild von K. von Steuben 4 Königin Luise, Bild von Böttner 25 Miniaturbildnisse: 5 Königin Luise, Bild von Macco a. Prinzessin Marianne, von Müller 6 Königin Luise, Bild von Ternite b. Prinz Ludwig von Hessen »Homburg, —7 Prinzessin Charlotte, Bild von G. v. Kügelgen unbezeichnet 8 Prinz Wilhelm d. R., Bild von Gérard c. Erbprinz Friedrich von Hessen »Horn» 9 Prinz Friedrich, Bild von G. von Kügelgen bürg, unbezeichnet 10 Prinz August, Bild von Kretschmar d. Prinz Philipp August von Hessen» 11 Prinzessin Luise, Bild von Darbes Homburg, unbezeichnet '-12 Blücher, Bild von Gröger 26 Prinz Gustav Adolf von Hessen-Homburg, Bild von Beck 13 Blüchers Tochter, Bild von Rincklake Prinz Leopold von Hessen »Homburg, 14 Miniaturbildnisse: Miniatur, unbezeichnet a. Kronprinz Friedrich Wilhelm, von Hau» 27 Wilhelm von Roeder, Bild, unbezeichnet singer 28 Mitglieder des Lützowschen Freikorps, b. Scharnhorst, von Tangermann Bleistiftzeichnungen c. Dohna, von Tangermann 29 Mitglieder des Lützowschen Freikorps, d.