Linux Einführungskurs
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Everyone and His Brother Is Speaking About Linux (Ie Ne
Everyone and his brother is speaking about Linux (i.e. ne ho davvero bisogno nella mia azienda?) [Logo Linux Guide for Managers] di Marco Iannacone - [email protected] Versione 1.0f Introduzione Nell'attuale contesto informatico sono poche le persone che non hanno ancora sentito parlare di Linux. È la parola chiave del momento: non passa giorno in cui una grande azienda (anche del calibro di IBM, COMPAQ, SGI, HP, ecc.) non rilasci una dichiarazione con la quale annunci il supporto di questa piattaforma o l'inizio del porting di un prodotto su questo Sistema Operativo (OS). Linux promette bassi costi, robustezza, potabilità su molteplici piattaforme hardware, disponibilità di sorgenti, supporto gratuito, ecc. Eppure Linux non identifica univocamente una sola azienda: Caldera, Debian, Mandrake, MkLinux, Prosa, Penguin Computing, Red Hat, Slackware, Stampede, Suse, TurboLinux, Trinux, VA Linux Systems e Yellow Dog sono solo un piccolo campione delle aziende che ne vendono una distribuzione, senza parlare di quelle che producono applicazioni per Linux o che ruotano comunque intorno al mondo Opensource. La disponibilità dei codici sorgenti rende molto semplice le modifiche a questo sistema che da alcuni viene catalogato come freeware, ma che in realtà sarebbe meglio definire opensources. Solo un anno e mezzo fa, tuttavia, se aveste chiesto all'lT manager di una grande azienda la sua opinione sul free software, vi avrebbe risposto che la sua azienda non lo usa. Avrebbe probabilmente aggiunto che non vi è supporto, che non è sufficientemente robusto e non raggiunge la qualità dei prodotti commerciali. Improvvisamente però nel 1998 questa percezione è cambiata (http://www.lwn.net/1999/features/1998timeline/) come mai? Esistono siti sulla Rete dove è possibile scaricare una versione completa di Linux (non una demo, bensì il prodotto completo) gratuitamente.. -
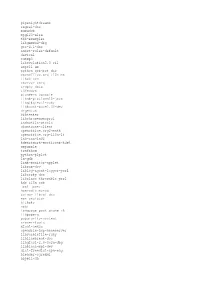
Pipenightdreams Osgcal-Doc Mumudvb Mpg123-Alsa Tbb
pipenightdreams osgcal-doc mumudvb mpg123-alsa tbb-examples libgammu4-dbg gcc-4.1-doc snort-rules-default davical cutmp3 libevolution5.0-cil aspell-am python-gobject-doc openoffice.org-l10n-mn libc6-xen xserver-xorg trophy-data t38modem pioneers-console libnb-platform10-java libgtkglext1-ruby libboost-wave1.39-dev drgenius bfbtester libchromexvmcpro1 isdnutils-xtools ubuntuone-client openoffice.org2-math openoffice.org-l10n-lt lsb-cxx-ia32 kdeartwork-emoticons-kde4 wmpuzzle trafshow python-plplot lx-gdb link-monitor-applet libscm-dev liblog-agent-logger-perl libccrtp-doc libclass-throwable-perl kde-i18n-csb jack-jconv hamradio-menus coinor-libvol-doc msx-emulator bitbake nabi language-pack-gnome-zh libpaperg popularity-contest xracer-tools xfont-nexus opendrim-lmp-baseserver libvorbisfile-ruby liblinebreak-doc libgfcui-2.0-0c2a-dbg libblacs-mpi-dev dict-freedict-spa-eng blender-ogrexml aspell-da x11-apps openoffice.org-l10n-lv openoffice.org-l10n-nl pnmtopng libodbcinstq1 libhsqldb-java-doc libmono-addins-gui0.2-cil sg3-utils linux-backports-modules-alsa-2.6.31-19-generic yorick-yeti-gsl python-pymssql plasma-widget-cpuload mcpp gpsim-lcd cl-csv libhtml-clean-perl asterisk-dbg apt-dater-dbg libgnome-mag1-dev language-pack-gnome-yo python-crypto svn-autoreleasedeb sugar-terminal-activity mii-diag maria-doc libplexus-component-api-java-doc libhugs-hgl-bundled libchipcard-libgwenhywfar47-plugins libghc6-random-dev freefem3d ezmlm cakephp-scripts aspell-ar ara-byte not+sparc openoffice.org-l10n-nn linux-backports-modules-karmic-generic-pae -

Curso De Linux
LINUX BÁSICO Curso de Linux M Angeles Arqueros Molto Meli Delgado Calot Beatriz Cabrera Figuerez 1 LINUX BÁSICO ÍNDICE Primera parte: ªPresentación del sistemaº 1. Introducción histórica 2. Software Libre 1. Licencia GPL 3. ¿Por qué usar Linux? 4. Distribuciones 1. Distribuciones comerciales 1. Red Hat (Fedora) 2. SUSE (openSUSE) 3. Mandriva (Mandrake) 4. Slackware 2. Distribuciones no comerciales 1. Debian 2. Ubuntu, kubuntu, xubuntu y edubuntu 3. Gentoo 3. Distribuciones Live 1. Ubuntu, kubuntu, xubuntu y edubuntu 2. Knoppix 3. Gentoo-LIVE 4. Otras distribuciones 5. Árbol de directorios 6. Sistemas de ficheros Segunda parte: ªInstalando por primera vez... ¿Qué hay que saber?º 1. Introducción 2. Particionar y formatear 1. Creando y modificando particiones: cfdisk 2. Creación de un sistema de ficheros en una partición 3. Particiones especiales 4. Consideraciones sobre sistemas de ficheros de Windows 3. Montaje 1. El comando mount 2. El comando umount 3. El fichero fstab 4. dmesg 4. Chequeo y reparación 1. Para particiones ext2 y ext3 2. Para particiones reiser 3. Testdisk Tercera parte: ªConocimientos básicos generalesº 1. Login, prompt, shell 2. Instalación de paquetes 3. Configuración de red 4. Impresión 5. Comandos Cuarta parte: ªSistema gráfico y aplicaciones de usuarioº 1. Introducción 2. Gestores de ventanas y entornos 1. Gnome 2. KDE 3. Xfce 4. fluxbox 5. Beryl/compiz 3. Aplicaciones de usuario Agradecimientos Diciembre 2007 2 LINUX BÁSICO ________________________________________________________________________________________________ PRIMERA PARTE: Presentación del sistema 1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA: La historia de Linux se remonta a los orígenes del sistema operativo Unix, del que ha evolucionado. En los años sesenta, los laboratorios Bell de la compaía American Telephone & Telegraph (AT&T) intentaron el desarrollo de un complejo sistema operativo llamado Multics. -

Linuxvilág 5. Évf. 4. Sz. (2004 Április)
Fogadó a Linuxhoz Munkaasztalból soha nem elég! Fedezzük fel az új asztali környezeteket anélkül, hogy szokásos felületünket ehhez el kellene hagynunk. Szakácsunk azt mutatja be, hogyan ágyazhatunk egymásba X-munkafolyamatokat. © Kiskapu Kft. Minden jog fenntartva rançois, úgy látom, a Window Maker használata mellett döntöttél – nagyszerû! Az egy remek ablak- kezelõ, élvezni fogod vele a munkát. Két héttel eze- Flõtt a Gnome-ot futtattad, a múlt héten a KDE volt teríté- ken, most pedig a Window Maker. Örülök, hogy megfogad- tad a tanácsomat és más ablakkezelõket is kipróbálsz. Végtére is a Linux használatának az egyik legnagyszerûbb vonása, hogy mindig van választási lehetõségünk. Quoi? Hogy én melyiket használom? Ezek mindegyikét és még vagy féltucatot, mon ami! Nem, François, nem ugratlak. Az elsõdleges munkafelületem a KDE, de itt van a Gnome, amott az XFCE, és azon a virtuális asztalon a Window Makert futtatom. Sõt Window Maker-munkafolya- matomban még az IceWM is fut. Nem, mon ami, egyáltalán nem bonyolult a dolog, és meg is fogom mutatni neked, mihelyt megérkeznek a vendégeink. De már itt is vannak. François! Vite! A pincébe, gyorsan! Mivel a mai menü 1. kép Egy meglehetõsen nehézkes inkább desszert, mint fõétkezés, menj le a 2001-es Niagara és csupasz X-képernyõ egyetlen X-terminállal Peninsula rizling jégborért és hozd fel tout de suite! Isten hozott titeket Chez Marcelnél, foglaljatok helyet! vagy F6. Amennyiben az X-et a parancssorból indítottuk Éppen arra próbálom rávenni hûséges pincérünket, hogy (és nem valamilyen beléptetõprogramból, mint a gdm próbálja ki a különféle munkaasztalokat (desktop). Mindig vagy a kdm), látnunk kell a képernyõn a munkafolyamattal érdekes próbára tenni valami újat, ezért változtatjuk a kapcsolatos párbeszédet, ahogy megnyomjuk a CTRL-ALT- menüt is állandóan, non? Ugyanez áll az asztali környeze- F1 billentyûkombinációt és az X eseménynaplójának a tünkre is. -
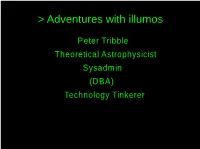
Adventures with Illumos
> Adventures with illumos Peter Tribble Theoretical Astrophysicist Sysadmin (DBA) Technology Tinkerer > Introduction ● Long-time systems administrator ● Many years pointing out bugs in Solaris ● Invited onto beta programs ● Then the OpenSolaris project ● Voted onto OpenSolaris Governing Board ● Along came Oracle... ● illumos emerged from the ashes > illumos key differentiators ● ZFS – reliable and easy to manage ● Dtrace – extreme observability ● Zones – lightweight virtualization ● Standards – pretty strict ● Compatibility – decades of heritage ● “Solarishness” ● No systemd ;-) > Diverse distributions ● OpenIndiana – OpenSolaris ● OmniOS – server focus ● SmartOS – Joyent's cloud ● Delphix/Nexenta/+ – storage focus ● DilOS, osdyson – debian ● Tribblix – one of the small fry > Distro differences ● Packaging – IPS: OI, Omnios, XStreamOS – SVR4: OpenSXCE, Tribblix – Deb: DilOS, osdyson – Pkgsrc: SmartOS – Storage vendors don't have (exposed) packaging – (No active rpm distro – Belenix is inactive) > Distro differences ● X86/X64 – Pretty much everything ● SPARC – OpenSXCE or Tribblix ● X64 only – SmartOS ● Minimum memory depends on packaging – IPS needs > 1G – Others happy in 512M > Distro focus ● OpenIndiana – copy OpenSolaris ● OmniOS – server, supported ● OpenSXCE – copy Solaris 10 ● XStreamOS – modern OpenIndiana ● SmartOS – foundation for cloud ● Tribblix – what OpenSolaris should have been > Why do it yourself? ● Challenging and interesting ● Understand the inner workings ● Satisfy the target audience ● Make a flexible platform for development -

X Window System Architecture Overview HOWTO
X Window System Architecture Overview HOWTO Daniel Manrique [email protected] Revision History Revision 1.0.1 2001−05−22 Revised by: dm Some grammatical corrections, pointed out by Bill Staehle Revision 1.0 2001−05−20 Revised by: dm Initial LDP release. This document provides an overview of the X Window System's architecture, give a better understanding of its design, which components integrate with X and fit together to provide a working graphical environment and what choices are there regarding such components as window managers, toolkits and widget libraries, and desktop environments. X Window System Architecture Overview HOWTO Table of Contents 1. Preface..............................................................................................................................................................1 2. Introduction.....................................................................................................................................................2 3. The X Window System Architecture: overview...........................................................................................3 4. Window Managers..........................................................................................................................................4 5. Client Applications..........................................................................................................................................5 6. Widget Libraries or toolkits...........................................................................................................................6 -

Curso Guadalinex
CURSO GUADALINEX Juan Alonso - Fermín Rubio - Paco Villegas 14 de octubre de 2004 Thales-CICA 2004 Página 2 Curso Guadalinex Juan Alonso - Fermín Rubio - Paco Villegas Índice general I Linux no es ventanas 13 1. Linux no es ventanas 15 1.1. Introducción. 16 1.2. Una breve historia de Linux . 16 1.3. Posibilidades de Linux . 18 1.4. Distribuciones de Linux . 19 1.5. Estructura del sistema operativo. 21 1.5.0.1. ¯ Para practicar . 22 2. Guadalinex e Internet: fuentes de información y programas. 25 2.1. ¿Dónde encuentro información? . 25 2.1.1. Documentos y manuales . 26 2.1.1.1. Linux HOWTO y mini-HOWTO . 26 2.1.1.2. Listas de FAQ . 27 2.1.1.3. Libros del LDP . 27 2.1.1.4. Tutoriales disponibles en Lucas . 28 2.1.2. Web interesantes sobre Linux . 28 2.1.3. News. 29 2.1.4. Revistas sobre Linux . 29 2.1.4.1. En formato electrónico. 29 2.1.4.2. En castellano . 30 2.1.5. Direcciones de Linux y educación. 30 3. Instalación de Guadalinex 31 3.1. Antes de la instalación. 31 3.2. Instalación de Guadalinex. 33 3.2.1. Arranque desde el CD-ROM. 33 3.2.2. Instalando GuadaLinex. 35 3.2.3. Gestión de usuarios y configuración de la autentificación. 41 3.2.4. Red. 42 3.2.5. Finalizando la instalación. 43 3.2.6. Reiniciando por primera vez: el GRUB. 44 3.2.7. Configuración de GRUB. 45 4. Conexión a Internet: RTB y ADSL. -

VALUE ENGINEERING in This Issue
Vol: 2 No: 1 June 1969 VALUE ENGINEERING In this issue Editorial - Lt. Col. Bert Decker - Value Visibility Setting up a Value Programme by R. Dick-Larkam The Challenge of V.E. - Value Training bv Frank Bowyer Developing and Organising an Effective Value Engineering Programme Part 3: A Case History on the Largest Scale by B. G. Matossian Theoretical Evaluation of Function by Arthur Garratt Purchase Cost Estimating and Analysis by K. F. Boddy Negotiation and Specification Checklists An Introduction to Value Management by D. 1. Speirs An Analysis of the Method of Value Analysis by C. F. Graham Change is a Challenge by K. R. Whyles The Value Engineer's Bookshelf Selected Abstracts of Recent Literature on Value Analysis/Engineering Pergamon Press The Operational Research Quarterly is an Some papers from recent issues international journal which examines the broad scope Operational research as Genesis. E. C. Williams of operational research as the application of scientific Operational research and innovation in management analysis to management problems. This important methods. J. Banbury publication covers all aspects of management Decision trees and the Second law. F. S. Drechsler Repeat-buying of textile garments. A. S. C. Ehrenberg including administration, organisation, economics, Investment decisions under uncertainty and variability— work flow, measurement, and productivity, which Some practical experiences of using forecasts and are directly related to man's technological probabilities. W. T. Thorneycroft, J. W. Greener environment. and H. A. Patrick Operations research has an established position in Advertising response functions and media planning. M. H. J. Webb industrial fields, such as building, health, engineering, construction, fuel, power, management information and An econometric approach to short-run analysis of the local government problems policy. -

Tiles Download Blackboxl
Tiles Download Blackboxl 1 / 4 Tiles Download Blackboxl 2 / 4 3 / 4 The application contains a bitmap editor for creating tiles and sprites and a map ... Download the newest version from SourceForge or simply replace your ts.exe .... The dwm window manager with the screen divided into four tiles. In computing, a tiling window manager is a window manager with an organization of the screen ... AfterStep · amiwm · Blackbox · cwm · Fluxbox · FVWM · IceWM · JWM · Matchbox · mwm · Openbox ... Create a book · Download as PDF · Printable version .... Tiles Download noDVD af BlackBox. ... Tiles is a fast-paced action puzzle game that will both convolute your mind and burn your finger tips!. Download and install your service as a tile. Configure your service ... blackbox derives from the directory that syslog-release forwards logs into.. Running on NetBSD 3.0 using blackbox. ... NetHack With Tiles (aka NeWT) looks and behaves like the TTY version, while still allowing tiles.. Lowell RPAK-810-72 8" Ceiling Speaker, Blackbox, Tile Bridge Combo ... speakers with factory-mounted transformers, grilles, enclosures, tile-bridges. ... shall be 23.75 in. long galvanized steel with holes for seismic anchoring. Download .... Get the Matrix Blackbox today. An IOT Tracking Microchip that can Track, Network, Secure & Recover your laptop,using GPS, GPRS, Wifi, Bluetooth, GSM mesh .... A generic tile-based interface is proposed to navigate 3D parameter spaces. ... Download high-res image (95KB) · Download full-size image ... As member of the BlackBox project (sponsored by the European Research Council), he develops .... Download this app from Microsoft Store for Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Windows Phone 8. -

NATO), 223 Southwest Asia and the Middle East, 229 East Asia and the Pacific, 237 Western Hemisphere, 240 Africa, 243 G
Report of the Secretary of Defense Caspar W. Weinberger to the Congress on the FY 1986 Budget, FY 1987 Authorization Request and FY 1986.90 Defense Programs February 4, 1985 This Report Reflects the FY 1985 Defense Budget as of January 30, 1985 For sale by the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office Washington, D.C. 20402 TO THE CONGRESS OF THE UNITED STATES We are now completing four years of steady progress toward fulfilling President Reagan's 1980 mandate to strengthen America's defenses. With the bipartisan support of the Congress and the American people, we have begun redressing the neglect of the 1970s and restoring our nation's strength, confidence, and position of leadership in the world. The FY 1986 Annual Report to the Congress highlights our progress and details the challenges that remain. The defense programs and budget recommended herein are based on our analysis of the threats facing the United States, our allies, and our interests worldwide. The military capabilities we seek are intended to counter these threats, to provide a safer deterrent, and to ensure peace. Defense spending is unique, being the only part of the total U.S. budget determined solely by factors external to our nation. The continued Soviet military buildup, as well as the growing menace of international terrorism, regional instabilities, and geopolitical uncertainties around the world, dictate that our nation maintain its commitment to rebuild its deterrent capability. We know that a strong America requires a healthy economy and financial integrity. To that extent, consistent with our global responsibilities, we have scaled back budget requests significantly to help reduce the federal deficit. -

Linux - Friheden Til at Vælge Grafisk Brugergrænseflade
Linux - Friheden til at vælge grafisk brugergrænseflade Version 1.2.20050118 - 2020-12-31 Hanne Munkholm, Kristian Vilmann, Peter Makholm, Henrik Grove, Gitte Wange, Henrik Størner, Jacob Sparre Andersen og Peter Toft Linux - Friheden til at vælge grafisk brugergrænsefladeVersion 1.2.20050118 - 2020-12-31 af Hanne Munkholm, Kristian Vilmann, Peter Makholm, Henrik Grove, Gitte Wange, Henrik Størner, Jacob Sparre Andersen og Peter Toft Ophavsret © 2003-2005 Forfatterne har ophavsret til bogen, men udgiver den under "Åben dokumentlicens (ÅDL) - version 1.0". Denne bog omhandler en række grafisk brugergrænseflader til UNIX-systemer, såsom Linux. Indholdsfortegnelse Forord.........................................................................................................................................................x 1. Linux-bøgerne................................................................................................................................x 2. Ophavsret.......................................................................................................................................x 1. Generelt om håndtering af window-managere...................................................................................1 1.1. Overblik.......................................................................................................................................1 1.2. Hvad er en windowmanager?......................................................................................................1 1.3. Hvad er et skrivebordsmiljø........................................................................................................2 -

LPI Linux LPIC1
LPI Linux LPIC1 Module 6 Module Contents • 1 Evans Ikua Lead Editor Kenya [email protected] • 2 Chris Brown Content Author UK [email protected] • 3 Mark Clarke Content Author RSA [email protected] • 4 Brian Ssennoga Content Author Uganda [email protected] • 5 Trust Zifa Material co-editor Zimbabwe [email protected] • 6 John Matogo Material co-editor Kenya john [email protected] • 7 Ken Mutua Material co-editor Kenya [email protected] • 8 Bernard Owuor Material co-editor Kenya [email protected] • 9 Sisay Adugna Material co-editor Ethiopia [email protected] • 10 Balthas Seibold Senior Project • Manager - GIZ • Germany [email protected] • 11 Petra Hagemann Project Manager - GIZ Germany [email protected] • 12 George Nyambuya Africa Coordinator - • ict@innovation • RSA [email protected] • 13 David Paulus Intern - GIZ Germany [email protected] Module Contents User Interfaces and Desktops • Install and configure X11 • Set up a display manager • Accessibility Module Contents Configuring X11R6 Two of the configuration utilities provided with the Xfree86 software (which is a raw Xwindow system) are the XF86Setup and xf86config scripts. Other vendors have specific utilities such as: • Xconfigurator, • redhat-config-xfree86 (RedHat) • XFdrake (Mandrake) • sax (Suse) Once the server has been configured one can change the horizontal and vertical settings for the monitor with xvidtune. Module Contents Configuring X11R6 Basic X configuration specifies features such as the mouse used, the keyboard layout, the screen resolution, the video refresh rate, the display colour depth, and the video card you’re using. Some of these options require telling X about what hardware you have installed, whereas others enable you to adjust settings on your hardware.