Der Walenstein an Der Strasse in Die Sommerau
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Verordnung Des Bundesdenkmalamtes Betreffend Den Pol
Verordnung des Bundesdenkmalamtes betreffend den pol. Bezirk Wolfsberg, Kärnten Auf Grund des § 2a des Denkmalschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 170/1999, wird verordnet: § 1. Folgende 127 unbewegliche Denkmale des pol. Bezirkes Wolfsberg, Ger. Bez. Wolfsberg, die gemäß § 2 oder § 6 Abs. 1 leg.cit. kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stehen, werden unter die Bestimmungen des § 2a Denkmalschutzgesetz gestellt: Bezeichnung Adresse EZ Gst.Nr. KG Gemeinde 9462 Bad Sankt Leonhard Stadtbefestigung (Gesamtanlage) Stadtanlage/ Bad St. Leonhard im 61; 92, 93; 95, 96, 99, Stadtmauer Lavanttal 144 121, 122, 124 77011 Bad St. Leonhard Bad St. Leonhard im Kath. Filialkirche hl. Kunigunde Lavanttal 137 .72 77011 Bad St. Leonhard Bad St. Leonhard im Kreuzwegkapelle, Ölbergkapelle Lavanttal 161 295 77011 Bad St. Leonhard Bad St. Leonhard im Friedhof christlich Lavanttal 295 546/1 77011 Bad St. Leonhard Kath. Pfarrkirche hl. Leonhard und Friedhof mit Bad St. Leonhard im Karner Lavanttal 295 .102 77011 Bad St. Leonhard Mariensäule Hauptplatz 744 942/1 77011 Bad St. Leonhard Bad St. Leonhard im Figur Christus im Leid Lavanttal 744 918 77011 Bad St. Leonhard archäologisches Kleindenkmal/ römischer Grabstein Hauptplatz 744 942/2 77011 Bad St. Leonhard Pfarrhof Hauptplatz 59 765 .67 77011 Bad St. Leonhard Bad St. Leonhard im Ehem. Spitalskirche/Zur lieben Frau Maria Lavanttal 766 .126 77011 Bad St. Leonhard Pfarrhof Schiefling 9 13 23 77013 Schiefling Kath. Pfarrkirche hl. Ägidius und Friedhof Schiefling 31 1/1 77013 Schiefling Aussichtswarte Kärntner Sonnenturm Schönberg 88 227/2 77017 Twimberg Gemeinde 9400 Frantschach-Sankt Gertraud Kath. Pfarrkirche hl. Nikolaus und Friedhof Kamp 42 12/2 77214 Kamp Kath. -

Regional Intermediate Report Carinthia / Austria Test Areas Feldkirchen and Wolfsberg
Work package 5 « Regional studies » : Regional intermediate report Carinthia / Austria Test areas Feldkirchen and Wolfsberg Eva Favry Birgit Janach Eva Karpf-Fortin 30 November 2005 Klagenfurt, Vienna WP5 REGIONAL INTERMEDIATE REPORT CARINTHIA 051130 1 Regional intermediate report Carinthia / Austria Table of content 1. Introduction ...................................................................................................4 1.1 PUSEMOR: A general overview ............................................................4 1.2 Workpackage 5 Regional Studies: Goals, objectives and activities ......5 2. Country profile...............................................................................................9 2.1 Territorial organisation ...........................................................................9 2.2 Spatial policies in Carinthia....................................................................9 2.3 Roles and responsibilities in public services........................................10 Transport..............................................................................................10 Public administration............................................................................10 Health care and care for elderly...........................................................11 Child care, education and culture ........................................................11 Telecommunication..............................................................................12 Every day needs ..................................................................................13 -

Quo Vadis Lavanttal?« Menschen – Themen – Perspektiven
Verein Lavanttaler Wirtschaft »Quo vadis Lavanttal?« Menschen – Themen – Perspektiven Sankt Andrä Frantschach-Sankt Gertraud Sankt Georgen Lavamünd Bad Sankt Leonhard Sankt Paul Preitenegg Reichenfels Wolfsberg » ein unternehmer Das Wichtigste ist, dass es einfach eine Vorwärtsentwicklung im Tal gibt und dass alle das erkennen. 4 Vorwort des Vereins Lavanttaler Wirtschaft Dr. Wolfgang Sattler, DI-HTL-Ing. Horst Jöbstl 6 Grußworte der Förderstellen Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds, Entwicklungsagentur Kärnten 8 »Quo vadis Lavanttal?« Ausgangslage und Zielsetzung 14 Nachhaltige Wirtschaft Utopisches Konzept oder strategische Chance für kmu? 20 Jugend schafft Zukunft Schülerinnen und Schüler diskutieren die Lebens- und Arbeitsqualität im Lavanttal 26 Internationale Netzwerke mit Lavanttaler Wurzeln Große Töchter | Große Söhne 30 Zukunftskonferenz Lavanttal 2020 36 Abend der Lavanttaler Wirtschaft Zwischenergebnisse und Ausblick Vorwort Verein Lavanttaler Wirtschaft » mission statement vlw Der Verein Lavanttaler Wirtschaft verfolgt die Vision, das Lavanttal zu einer wirtschaftlichen Vorzeigeregion in Europa zu machen. »Quo vadis Lavanttal?« soll dabei eine Navigationshilfe geben. 4 der verein lavanttaler wirtschaft (vlw) wurde vor mehr als zehn Jahren mit dem Ziel gegründet, als überparteiliche und überin- stitutionelle Plattform die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Region Lavanttal zu verbessern und den Wirtschaftsstandort nach- haltig zu stärken. Der Verein hat mit seinen Aktivitäten dazu beige- tragen, dass das Lavanttal den -
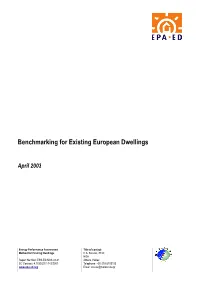
Benchmarking for Existing European Dwellings
Benchmarking for Existing European Dwellings April 2003 Energy P erformance A ssessment T itle of contact: M ethod for Existing Dwellings C .A. B a la ra s , Ph .D. NOA Report Number: EPA-ED NOA 03-01 Ath en s , H ella s EC C on tra c t: 4.1030/Z /01-142/2001 T eleph on e: + 30-210-8109152 www.epa-ed .org Ema il: c os ta s @ meteo.n oa .g r Benchmarking for Existing European Dwellings A uthor/s Date: www.epa-ed .org C .A. B a la ra s , Ph .D. April 16, 2003 NOA P roject co-ord inator Ath en s , H ella s R eport N umb er: EB M -c on s ult, Arn h em, T eleph on e: + 30-210-8109152 EPA-ED NOA 03-01 T h e Neth erla n d s Ema il: c os ta s @ meteo.n oa .g r EC C ontract M r. B a rt Poel E. Da s c a la k i, Ph .D. 4.1030/Z /01-142/2001 b poel@ eb m-consult.nl NOA Ath en s , H ella s T eleph on e: + 30-210-8109143 Ema il: ed a s k @ meteo.n oa .g r S . G eis s ler Ö Ö I V ien n a , Aus tria T eleph on e: + 43-15-236105 Ema il: g eis s ler@ ec olog y .a t K .B . W ittc h en DB U R H oers h olm, Den ma rk T eleph on e: + 45-45742395 Ema il: k bw @ by -og -by g .d k G . -

Glued Laminated Timber – Bilam and Trilam Beams – Duo Structural
Glued laminated timber – Bilam and trilam beams – Duo structural timber Ceiling elements – Log-house planks – Bilam forte – primolam® weinberger-holz gmbh · [email protected] www.weinberger-holz.at · www.bestofwood.eu Carinthia factory: Bamberger Straße 4, 9463 Reichenfels, Austria T: +43.4359.2228-0 · F: +43.4359.2228-18 Salzburg factory: Schratten 44, 5441 Abtenau, Austria T: +43.6243.440 50-0 · F: +43.6243.440 50-1 02 Contents 04_05 Wood – the material that success is carved from 06_07 Weinberger – the making-of 08_09 Best of wood – products and highlights 10_11 Special effects at a glance 12_13 Vertical and horizontal finger jointing 14_15 Best of wood comes from Carinthia and Salzburg 16_17 Glued laminated timber 18_19 Bilam and trilam beams 20_21 Duo structural timber 22_23 Ceiling elements 24_25 Log-house planks 26_27 Bilam forte. The log-house plank that doesn’t settle 28_31 primolam® – solid-wood wall/ceiling system by Weinberger 32_33 Certificates 03 Wood – the material that success is carved from The uses of wood are endless. Be it furniture, houses, industrial halls, bridges or towers – wood has accompanied humankind for many thousands of years. And not without reason. Because its advantages over other materials are beyond dispute. Here are just a few examples: Foto: Griffner Haus 04 Non-ageing qualities Wood that has been protected against weathering will not age. That’s why – with correct maintenance – buildings will not lose their value. You only need to think of old half-timbered structures dating from the 13th century. Great heat-retention capacities Its special cell structure makes wood a poor conductor. -

Regional Action Plan for Improving Cross-Border PT Carinthia
REGIONAL ACTION PLAN FOR IMPROVING CROSSBORDER PUBLIC TRANSPORT CARINTHIA – KOROŠKA BASED ON REGIONAL ANALYSIS Final 2nd Progress Report D.T2.1.4 11 2018 Prepared by: Peter Zajc, MsC, RRA Koroška (PP8) Aleš Rupreht, RRA Koroška (PP8) Table of content 1. Motivation and initial situation ....................................................................................... 2 1.1. Regional analysis ....................................................................................................... 2 1.2. Cross border commuting ............................................................................................. 3 1.2.1. Work ................................................................................................................... 3 1.2.2. Education ............................................................................................................. 6 1.2.3. Survey among residents of selected settlements in Koroška region .................................... 7 1.3. Existing cross border public transport ........................................................................... 11 2. Approach .................................................................................................................. 15 3. Measures .................................................................................................................. 18 4. Next steps ................................................................................................................. 18 Page 1 1. Motivation and initial situation 1.1. -

Frantschach SEAT Report 2018 Contents
Mondi Group Frantschach SEAT Report 2018 www.mondigroup.com Contents Section 1: Introduction 1 Background: Who we are and why our SEATs are important 1 About this report 1 Section 2: Assessment objectives and methodology 2 Objectives 2 Methodology 2 SEAT team 2 Key stakeholders 3 Acknowledgements 3 Section 3: Overview of surroundings 4 Section 4: About Mondi Frantschach 5 Introduction 5 Social management systems 5 People management 5 Gender diversity 6 Employee survey 6 Communication practices 6 Safety at work 7 Social activities for employees 8 Community engagement 8 Government and business relations 8 Environmental footprint and management 9 Energy and carbon footprint 10 Waste management 10 Air and water emissions 11 International certification standards 12 Wood supply 13 Section 5: Results of the assessment 14 General observations 14 SEAT Attendance and process 14 Positive findings 14 Employment 14 Safety and health 14 Training 15 Communication 15 Contractors 15 Environmental management 15 Community- and social investments 15 Mondi as a business partner 15 Challenges identified and stakeholders’ further comments and expectations 16 Employment 16 Environmental issues 21 Community interaction 23 Communication 24 Glossary of terms 26 Contact details IBC Mondi Group Frantschach SEAT Report 2018 Section 1: Introduction Background: Who we are and why our SEATs The SEAT approach was introduced in 2005. The intention was are important to support our pulp and paper mills and forestry operations in creating open and transparent dialogue with their local Mondi is a global leader in packaging and paper, delighting communities. Through the SEAT process we’re able to its customers and consumers with innovative and sustainable Introduction strengthen our understanding of where our impacts are and what packaging and paper solutions. -

AUSTRIA Vienna
EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR ENERGY DIRECTORATE D – Nuclear energy, safety and ITER D.3 – Radiation protection and nuclear safety Verification under the terms of Article 35 of the Euratom Treaty Technical Report AUSTRIA Vienna Routine and emergency radioactivity monitoring arrangements Monitoring of radioactivity in drinking water and foodstuffs 30 September – 2 October 2020 Reference: AT 20-02 Art. 35 Technical Report – AT 20-02 VERIFICATIONS UNDER THE TERMS OF ARTICLE 35 OF THE EURATOM TREATY FACILITIES Routine and emergency radioactivity monitoring arrangements Monitoring of radioactivity in drinking water and foodstuffs LOCATIONS Vienna, Austria DATES 30 September -2 October 2020 REFERENCE AT 20-02 TEAM MEMBERS Mr V. Tanner (team leader) Ms E. Diaconu REPORT DATE 24 February 2021 SIGNATURES V. Tanner E. Diaconu Page 3 of 49 Art. 35 Technical Report – AT 20-02 Page 4 of 49 Art. 35 Technical Report – AT 20-02 TABLE OF CONTENTS 1 INTRODUCTION 9 2 PREPARATION AND CONDUCT OF THE VERIFICATION 9 2.1 PREAMBLE 9 2.2 DOCUMENTS 9 2.3 PROGRAMME OF THE VISIT 10 3 LEGAL FRAMEWORK FOR RADIOACTIVITY MONITORING IN AUSTRIA 11 3.1 LEGISLATIVE ACTS REGULATING ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY MONITORING 11 3.2 LEGISLATIVE ACTS REGULATING RADIOLOGICAL SURVEILLANCE OF FOOD AND DRINKING WATER 11 3.3 LEGISLATIVE ACTS REGULATING RADIOACTIVITY MONITORING IN EMERGENCIES 11 3.4 INTERNATIONAL LEGISLATION AND GUIDANCE DOCUMENTS 11 4 BODIES HAVING COMPETENCE IN RADIOACTIVITY MONITORING 13 4.1 FEDERAL MINISTRY FOR CLIMATE ACTION, ENVIRONMENT, ENERGY, MOBILITY, -

Strategy Building Process Final D.T1.3.3
BEST PRACTICE OF CROSS-BORDER PUBLIC T TRANSPORT IN CENTRAL EUROPE TO TEN-T NODES Strategy building process Final D.T1.3.3 Page 1 This document was developed in the partnership of TRANS-BORDERS Contact: Petra Ludewig, Project manager Saxon State Ministry for Economic Affairs, Labour and Transport Division 66 Public Transport Wilhelm-Buck-Straße 2 | D-01097 Dresden Page 2 Table of content 1. What this document is for .............................................................................................. 5 2. The Cross-Border Transport Planning Process ..................................................................... 6 2.1. Saxony (Germany) ..................................................................................................... 6 2.2. Lower Silesia (Poland) ................................................................................................ 7 2.3. Carinthia (Austria) ..................................................................................................... 9 2.4. Koroška (Slovenia) .................................................................................................... 11 3. Establishing Partnership ............................................................................................... 12 3.1. Saxony (Germany) .................................................................................................... 12 3.1.1. Authorities ........................................................................................................... 12 3.1.2. Operators ........................................................................................................... -

Presentation of E.164 National Numbering for Country Code 43
Presentation of E.164 National Numbering For Country Code 43, Austria Date: 30.03.2011 (a) Overview The minimum number length (excluding the country code) is 4 digits. The maximum number length (excluding the country code) is 13 digits (b) Detail of numbering scheme Last updates are marked in red NDC N(S)N Number Length National maximum minimum Usage of E.164 Destination Additional Information length length number Code 1 13 4 local network code Area code for Wien 2142 13 7 local network code Area code for Gattendorf 2143 13 7 local network code Area code for Kittsee 2144 13 7 local network code Area code for Deutsch Jahrndorf 2145 13 7 local network code Area code for Prellenkirchen 2146 13 7 local network code Area code for Nickelsdorf 2147 13 7 local network code Area code for Zurndorf 2160 13 7 local network code Area code for Jois 2162 13 7 local network code Area code for Bruck an der Leitha 2163 13 7 local network code Area code for Petronell-Carnuntum 2164 13 7 local network code Area code for Rohrau 2165 13 7 local network code Area code for Hainburg a.d. Donau 2166 13 7 local network code Area code for Parndorf 2167 13 7 local network code Area code for Neusiedl am See 2168 13 7 local network code Area code for Mannersdorf am Leithagebirge 2169 13 7 local network code Area code for Trautmannsdorf an der Leitha 2172 13 7 local network code Area code for Frauenkirchen 2173 13 7 local network code Area code for Gols 2174 13 7 local network code Area code for Wallern im Burgenland 2175 13 7 local network code Area code for Apetlon