Naturheilbewegung, Vegetarismus, Lebensreform
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
![Water-Cures [Moss-2]](https://docslib.b-cdn.net/cover/2187/water-cures-moss-2-122187.webp)
Water-Cures [Moss-2]
Fountains ofYouth NEW JERSEY’S WATER-CURES his is a story about the bustling medical by Sandra W. marketplace in nineteenth-century New Moss M.D., M.A. T Jersey, and, in particular, the establishments known as water-cures. What we now call alternative, complementary, or holistic medicine was once referred to as sectarian medicine and its Sandra Moss. M.D., M.A. (History) practitioners as irregulars. Most regular or orthodox is a retired internist and past president of the Medical History Society of New Jersey. Dr. Moss writes and speaks physicians, often called "allopaths" by their critics, about the history of medicine in New Jersey. viewed the endless parade of irregular sectarian Acknowledgements: This paper is dedicated to the memory practitioners as either ignorant quacks or educated, of Professor David L. Cowen (1909-22006), New Jersey’s premier medical historian. Archivist Lois Densky-WWolff, but deluded, quacks. In order to get our bearings, Special Collections, University of Medicine and Dentistry of New Jersey, provided expert research assistance, as did we must look briefly at botanical and homeopathic the staff at Rutgers University Archives and Special sects before turning to the hydropaths, hygeio- Collections. therapists, and naturopaths. Fountains of Youth O Sandra W. Moss, MD, MA O GardenStateLegacy.com Issue 2 O December 2008 FROM JERSEY TEA struggling to make a living. Repeatedly TO JERSEY CURE stymied in its efforts to control Botanical medicine was a mainstay in practice through state licensing, the New Jersey from colonial times. “Herb regular medical establishment dithered “Water” and root” doctors and genuine (or for decades over the problem of by A.S.A. -

Print This Article
Cómo referenciar este artículo / How to reference this article Németh, A., & Pukánszky, B. (2020). Life reform, educational reform and reform pedagogy from the turn of the century up until 1945 in Hungary. Espacio, Tiempo y Educación, 7(2), pp. 157-176. doi: http://dx.doi.org/10.14516/ete.284 Life reform, educational reform and reform pedagogy from the turn of the century up until 1945 in Hungary András Németh email: [email protected] Eötvös Loránd University. Hungary / János Selye University Komárno. Slovakia Béla Pukánszky email: [email protected] University Szeged. Hungary / János Selye University Komárno. Slovakia Abstract: Since the end of the 19th century, the modernisation processes of urbanisation and industrialisation taking place in Europe and the transatlantic regions have changed not only the natural environment but also social and geographical relations. The emergence of modern states changed the traditional societies, lifestyles and private lives of individuals and social groups. It is also characteristic of this period that social reform movements appeared in large numbers – as a «counterweight» to unprecedented, rapid and profound changes. Some of these movements sought to achieve the necessary changes with the help of individual self-reform. Life reform in the narrower sense refers to this type of reform movement. New historical pedagogical research shows that in the major school concepts of reform pedagogy a relatively close connection with life reform is discernible. Reform pedagogy is linked to life reform – and vice versa. Numerous sociotopes of life reform had their own schools, because how better to contribute than through education to the ideal reproduction and continuity of one’s own group. -

KATALOG 12 Versandantiquariat Hans-Jürgen Lange Lerchenkamp
KATALOG 12 Versandantiquariat Hans-Jürgen Lange Lerchenkamp 7a D-29323 Wietze Tel.: 05146-986038 Email: [email protected] Bestellungen werden streng nach Eingang bearbeitet. Versandkosten (u. AGB) siehe letzte Katalogseite. Alchemie u. Alte Rosenkreuzer 1-45 Astrologie 46-77 Freimaurer, Templer u.a. Geheimbünde 78-104 Grenzwissenschaften 105-163 Heilkunde u. Ernährung 164-190 Hypnose, Suggestion u. Magnetismus 191-214 Lebensreform, völkische Bewegungen u. Ariosophie 215-301 Okkultismus u. Magie 302-363 Spiritismus u. Parapsychologie 364-414 Theosophie u. Anthroposophie 415-455 Utopie u. Phantastik 456-507 Volkskunde, Aberglaube u. Zauberei 508-530 Varia 531-666 Weitere Angebote - sowie PDF-Download dieses Katalogs (mit Farbabbildungen) - unter www.antiquariatlange.de . Wir sind stets am Ankauf antiquarischer Bücher aller Gebiete der Grenz- und Geheimwissenschaften interessiert! Gedruckt in 440 Exemplaren. Ein Teil der Auflage wurde mit einem Umschlag Liebe Kunden, die Bücher in unseren Katalogen sind Exklusivangebote . Das heisst, sie werden zunächst nur hier im Katalog angeboten! Erst etwa ein/zwei Monate nach Erscheinen des Katalogs, stellen wir die unverkauften Bücher auch online (Homepage, ZVAB & Co.). 2 – www.antiquariatlange.de Alchemie und Alte Rosenkreuzer 1. [Sod riqqavon we-serefa] i.e. Das Geheimnuß der Verwesung und Verbrennung aller Dinge, nach seinen Wundern im Reich der Natur und Gnade, Macro Et Microcosmice, als die Schlüssel: Dadurch der Weeg zur Verbesserung eröffnet, das verborgene der Creaturen entdecket, und die Verklärung des sterblichen Leibes gründlich erkant wird [...]. Dritte und mit vielen curiösen Obersvationibus vermehrte Auflage. (3. verm. Aufl.) Franckfurt am Mayn, In der Fleischerischen Buchhandlung, 1759. 109 S., Kl.-8°, Pappband d. Zt. 1000,00 € Caillet 6743; Ferguson I,306 u. -

World Naturopathic Federation Report June 2015
June 2015 World Naturopathic Federation Report Findings from the 1st World Naturopathic Federation survey www.worldnaturopathicfederation.org World Naturopathic Federation Report June 2015 Acknowledgements The World Naturopathic Federation (WNF) greatly appreciates the participation of naturopathic organizations around the world (outlined in the document) in providing the details required for this World Naturopathic Federation Report. This survey initiative was led by Dr. Iva Lloyd, ND. Other naturopathic doctors instrumental in this report include Jonathan Wardle, Tabatha Parker, Tina Hausser and Phillip Cottingham, as well as other members of the WNF Interim Board. We appreciate those individuals that assisted by reviewing this document and providing comments and advice on the content. WNF Interim Board Members include naturopaths / naturopathic doctors: Iva Lloyd – President (Canada) Tabatha Parker – Vice President (United States) Jonathan Wardle - Treasurer (Australia) Tina Hausser – Secretary (Spain) Phillip Cottingham – New Zealand Anne-Marie Narboni – France Yannick Pots – Belgium Dhananjay Arankalle – India © World Naturopathic Federation June 2015 All rights reserved. Publications of the World Naturopathic Federation can be obtained from their website at www.worldnaturopathicfederation.org. Requests for permission to reproduce or translate WNF publications – whether for sale or for noncommercial distribution – should be addressed to [email protected] All reasonable precautions have been taken by the World Naturopathic Federation to verify the information in this report. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Naturopathic Federation be liable for damages arising from its use. -

WNF Bílá Kniha: Naturopatické Filosofie, Principy a Teorie
WNF Bílá kniha: Naturopatické filosofie, principy a teorie Poděkování Světová naturopatická federace (WNF) velmi oceňuje spolupráci následujících naturopatických vzdělávacích institucí při poskytování požadovaných údajů pro Bílou knihu WNF: Naturopatické filosofie, principy a teorie; Bastyr University, USA; Canadian College of Naturopathic Medicine (CCNM), Kanada; Collège Européen de Naturopathie Traditionnelle Holistique (CENATHO), Francie; Centro Andaluz de Naturopatía (CEAN), Španělsko; Naturopatska Sola (SAEKA), Slovinsko; Wellpark College of Natural Therapies, Nový Zéland. Rádi bychom také poděkovali jednotlivcům a organizacím, které se podílely na dvou předchozích průzkumech, které poskytly základy pro tento projekt. Tyto organizace jsou uvedeny ve dvou zprávách o průzkumu, které lze nalézt na adrese http://worldnaturopathicfederation.org/wnf-publications/. Tuto iniciativu vedl výbor WNF Naturopathic Roots (Naturopatické kořeny), který zahrnoval členy Heilpraktiker, naturopaty a naturopatické lékaře (ND): Tina Hausser, Heilpraktiker, naturopat (Španělsko) Dr. Iva Lloyd, naturopatický lékař (ND) (Kanada) Dr. JoAnn Yánez, ND, MPH, CAE (USA) Phillip Cottingham, naturopat (Nový Zéland) Roger Newman Turner, naturopat (Velká Británie) Alfredo Abascal, naturopat (Uruguay) Všechna práva vyhrazena. Publikace Světové naturopatické federace jsou k dispozici na internetových stránkách www.worldnaturopathicfederation.org. Žádosti o povolení reprodukovat nebo překládat publikace WNF - ať již pro prodej nebo pro nekomerční distribuci musí být -

Zum 100. Todestag Von Heinrich Lahmann 1860 Bis 1905
Medizingeschichte Zum 100. Todestag von Heinrich Lahmann 1860 bis 1905 Am 1. Juni 2005 gedachte der Verschönerungs- des Ersten Weltkrieges die Besucherzahlen bis 1972), aber auch Ingeborg Elisabeth verein Weißer Hirsch mit der Enthüllung eingebrochen waren – wieder mehr als Gräfin von Plauen und Emmerich Graf von eines Lahmann-Porträtreliefs an der Pergola 80.000 (Prospekt Weißer Hirsch 1928). Thun und Hohenstein. Stechgrundstraße und einem Konzert mit Zudem kurten in weiteren bekannten natur- Der Weiße Hirsch war ein wirtschaftlich Musik von Rainer Promnitz sowie mit Aus- heilkundlich arbeitenden Einrichtungen des blühender Kurort, der ausschließlich vom schnitten aus einem Film von Ernst Hirsch Kurbezirkes Weißer Hirsch jährlich noch Kurtourismus lebte. Erste Bestrebungen, den des Todestages von Heinrich Lahmann vor Tausende von Gästen: im exklusiven „Dr. kleinen Dresdner Vorort Weißer Hirsch zum einhundert Jahren. Dabei wurde auch folgen- Weidners Sanatorium“, im für seine Diät- und Kurort und zur Sommerfrische zu entwickeln, des Gedicht zitiert: Fastenkuren berühmten Sanatorium von datierten bereits aus den 1870er Jahren. Aber „Wieviele tausende von Menschen haben Siegfried Möller (1871 bis 1943), im psycho- erst mit der Eröffnung von Lahmanns Sanato- dort Erholung schon gefunden? therapeutisch orientierten Sanatorium von rium begann 1888 sein großer Aufschwung. Wieviele tausende wohl konnten nur im Heinrich Teuscher (1862 bis 1946) oder im Weißen Hirsch gesunden? vornehm-familiär geführten Sanatorium von Der Begründer des Weltruhms – Auch ich gehörte einst zu dem Max Steinkühler (1875 bis 1934). Viele Erho- ein eigenwilliger Naturarzt Patienten-Publikum lungssuchende reisten in den weltberühmten Heinrich Lahmann (1860 bis 1905), Sohn aus Und ward gesund in Dr. Lahmanns Kurort und wohnten im luxuriösen Parkhotel einer angesehenen Bremer Kaufmannsfamilie, Sanatorium, oder in einer der zahlreichen Pensionen. -

Homeopathic Thesaurus
HOMEOPATHIC THESAURUS KEYTERMS TO BE USED IN HOMEOPATHY TREE STRUCTURE AND ALPHABETICAL LIST ENGLISH, GERMAN, FRENCH, ITALIAN 2016 FOURTH MULTILINGUAL REPRINT EDITION 2016 EUROPEAN COMMITTEE FOR HOMEOPATHY President: Dr Thomas Peinbauer Herrenstraße 2 4020 Linz Austria Secretariat of the European Committee for Homeopathy Noorwegenstraat 49, Haven 8008X 9940 Evergem (Gent) Belgium DOCUMENTATION subcommittee Co-ordinator: Caroline Vandeschoor Heel Belgium Booiebos 25 9031 Drongen Belgium ECH HOMEOPATHIC THESAURUS First edition 1998 Second edition 2000 First multilingual edition 2002 Second multilingual edition 2005 Third multilingual edition 2007: Italian translation by Federica Bert Revised by Valter Masci and Antonella Ronchi Fourth multilingual reprint edition 2016 Published by Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG P.O.Box 410240 76202 Karlsruhe Germany All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without prior permission in writing of the European Committee for Homeopathy, Documentation subcommittee. ECH HOMEOPATHIC THESAURUS 2016 Table of Contents Foreword to the 3rd Multilingual Edition.............................................................5 Changes to the 2nd Multilingual Edition…………………………..…………….....6 Introduction.......................................................................................................9 Notes on the use -

Central Council for Research in Ayurvedic Sciences
CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN AYURVEDIC SCIENCES Syllabus for Ph.D. Fellowships/ Senior Research Fellowships in different AYUSH streams SI. Name of the Fellowship Syllabus/Subjects Total No. Qucstions/Marks (total marks = 120) 1. Aptitude Section (Part-I) A. General Science: All Science Subjects 30 MCQs/30 Marks common to all AYUSH (Physics, Chemistry, Biology) as per NCERT (@ 1 marks per streams on General Science Syllabus for 10+2. question) and Research aptitude (for B. Research aptitude including Research Ph.D. Fellowship/Senior Methodology: Research Methodology with Research Fellowship) emphasis on Clinical Research Conduct & Monitoring, Good Clinical Practices, Protocol Development, Bio-ethics, Bio-statistics etc. *The questions should be applied in nature with reasoning to assess the subject knowledge and aptitude of scholars. 2. Subject Specific Section As per syllabus prescribed by Central Council of 90 MCQs/90 Marks (Part-II-A/Y/U/S/H) (for Indian Medcine (CCIM*) for Ayurveda, Siddha (@ 1 marks per Ph.D. Fellowship/Senior & Unani at SI. No.2.1-2.3 and by Central question) Research Fellowship) Council of Homoeopathy (CCH*) for Homoeopathy at SI. No.2.4, and provide by Central Council for Research in Yoga & Naturopathy (CCRYN) for Yoga & Naturopathy at SI. No.2.5. 2.1 Ph.D. Fellowship/Senior All subjects of under Graduation (BAMS) as per 90 MCQs/90 Marks Research Fellowship CCIM* syllabus (@ 1 marks per (Ayurveda) *The questions should be applied in nature with question) reasoning to assess the subject knowledge and aptitude of postgraduate level scholars. 2.2 Ph.D. Fellowship/Senior All subjects of under Graduation (BSMS) as per 90 MCQs/90 Marks Research Fellowship CCIM* syllabus (@ 1 marks per (Siddha) *The questions should be applied in nature with question) reasoning to assess the subject knowledge and aptitude of postgraduate level scholars. -

Paper 1-Yoga Philosophy
Paper – 1 ROGA VIJNANA – VIKRUTI VIJNANA (Total = Theory – 200+Practical – 100 = 300 marks) Theory – 100 marks Teaching hours – 70 Part – A (each unit bears 10 marks = total 50 marks) Unit – 1 Introduction: Definition of Vikruti Vijnana (Pathology), its importance and branches; Concept of vitiated Dosha – Dosha as a principal cause of Vyadhi; signs & symptoms of increased & decreased Dosha, migration of Dosha from Koshtha to Shakha & Shakha to Koshtha, causative factors of Dosha accumulation & aggravation Unit – 2 Concept of Agni Dushti (Manda, Tikshana & Vishama) – Jatharagni, Dhatvagni, Bhutagni and related disorders with special reference to metabolic disorders; Concept of Ama: Origin, Definition, Characteristics & Symptomatology; signs & symptoms of Sama Dosha, Dhatu & Mala Unit – 3 Concept of vitiated Dhatu, Upadhatu & Mala – signs & symptoms of increased & decreased Dhatu, Upadhatu & Mala; causative factors of vitiation of Dhatu, Upadhatu & Mala, Role of Dhatu, Upadhatu & Mala in disease production; Interdependency (Ashraya – Ashrayi Bhava) of Dosha & Dushya; Concept of Oja vitiation – causative factors, signs & symptoms and related disorders Unit – 4 Concept of vitiated Srotas – causative factors of vitiation of various Srotas, signs & symptoms of vitiated Srotas, importance of Srotas and Srotomula in disease production; Anomalies due to Indriya Pradosha (vitiation of sensory & motor organs) 1 Unit – 5 Yogic & Naturopathic Aspect of Vikruti: Vitiation of Dashavidha Prana according to Yoga & Ayurveda, Role of Svara (nostril breathing) -

The Best Well-Being Programmes in Slovenia
Terme Lendava Terme Zdravilišče Radenci Zdravilišče THE BEST WELL-BEING PROGRAMMES IN SLOVENIA Toplice 3000 - Moravske Terme Refreshing, relaxing, reenergising, Ptuj Terme rejuvenating with a local feel Sava Hoteli Bled Hoteli Sava Sava Hoteli Bled Enchanted by images of paradise. VISIT BREATHTAKING BLED Embraced by the mountain peaks of the Julian Alps, there is a lake, which glitters like a tear, with an island, which never fails to mesmerise. Breathe in deeply: let the fresh mountain air invigorate you. Listen to the tolling of a sunken bell at the bottom of the lake. Bled is the perfect place for both eternal romantics and enthusiastic sportsmen. Besides the mandatory walk around the lake and enjoying the original Bled Crème Cake there is so much else to do here… SAVA HOTELI BLED • Hotels with breath-taking views. • An idyllic resort with thermal springs and more than a hundred years of Ar- nold Rikli’s health resort tradition. • Give us three days and we’ll fill your pho- to album with unforgettable memories. • A clever combination of original Alpine gastronomy and contemporary culinary trends. • More than 60 years of the “Original Bled Crème Cake” – 60 years and more than 12 million sweet sighs. • Where we take care of the best in you under the patronage of Živa, the Old Slavic goddess of love. • In Bled we practise natural, sustainable tourism, enable green mobility, serve lo- cal food, and strive for energy efficiency. • Sava Hotels & Resorts – the proud guardian of Bled swans. THE HEALING POWER OF BLED People have always believed that the Slovenian town of Bled and the enchanting nature around it have special healing powers. -
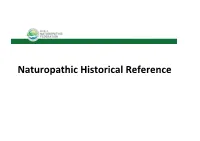
Naturopathic Historical Reference
Naturopathic Historical Reference Naturopathic Historical Reference Acknowledgements The World Naturopathic Federation (WNF) greatly appreciates the participation of naturopathic educational institutions in providing the details required for this WNF Naturopathic Historical Reference: Canadian College of Naturopathic Medicine (CCNM), Canada; Collège Européen de Naturopathie Traditionnelle Holistique (CENATHO), France; Centro Andaluz de Naturopatía (CEAN), Spain; Naturopatska Sola (SAEKA), Slovenia; Wellpark College of Natural Therapies, New Zealand. This initiative was led by the Naturopathic Roots Committee with the following members including Heilpraktiker / naturopaths / naturopathic doctors (ND): Tina Hausser, Heilpraktiker, Naturopath - Chair (Spain) Dr. Iva Lloyd, ND (Canada) Dr. JoAnn Yánez, ND, MPH, CAE (United States) Phillip Cottingham, ND (New Zealand) Roger Newman Turner, ND (United Kingdom) Alfredo Abascal, Naturopath (Uruguay) © World Naturopathic Federation July 2017 (date provisional) All rights reserved. Publications of the World Naturopathic Federation can be obtained from our website at www.worldnaturopathicfederation.org. Requests for permission to reproduce or translate WNF publications – whether for sale or for noncommercial distribution – should be addressed to [email protected] All reasonable precautions have been taken by the World Naturopathic Federation to verify the information in this report. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the Copyright 2017 1 www.worldnaturopathicfederation.org interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Naturopathic Federation be liable for damages arising from its use. Printed in Canada. Introduction: The following chart and naturopathic historical timeline is an overview of some of the key individuals that have contributed to the philosophies, theories and principles that make up naturopathy / naturopathic medicine. -

Steward the Culture of Water Cure in Nineteenthcentury Austria
Northumbria Research Link Citation: Steward, Jill (2002) The culture of water cure in nineteenth-century Austria, 1800-1914. In: Water, Leisure and Culture: European Historical Perspectives. Leisure, Consumption and Culture . Berg, Oxford, pp. 23-36. ISBN 9781859735404 Published by: Berg URL: http://www.bloomsbury.com/uk/water-leisure-and-cul... <http://www.bloomsbury.com/uk/water-leisure-and-culture-9781859735404/> This version was downloaded from Northumbria Research Link: http://nrl.northumbria.ac.uk/id/eprint/582/ Northumbria University has developed Northumbria Research Link (NRL) to enable users to access the University’s research output. Copyright © and moral rights for items on NRL are retained by the individual author(s) and/or other copyright owners. Single copies of full items can be reproduced, displayed or performed, and given to third parties in any format or medium for personal research or study, educational, or not-for-profit purposes without prior permission or charge, provided the authors, title and full bibliographic details are given, as well as a hyperlink and/or URL to the original metadata page. The content must not be changed in any way. Full items must not be sold commercially in any format or medium without formal permission of the copyright holder. The full policy is available online: http://nrl.northumbria.ac.uk/policies.html This document may differ from the final, published version of the research and has been made available online in accordance with publisher policies. To read and/or cite from the published version of the research, please visit the publisher’s website (a subscription may be required.) Northumbria Research Link Steward, J.