Klick, Klick, Klack. Leben Mit Automaten
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

MOST ADDED Media
AIRPLAL. GALAXY NETWORK/Bristol/Leeds P Playlist Additions: Mina -La Lontananza ©BPI Communications Inc. DANCE Anastacia-Cowboys & Kisses Travis -Sing WEEK 23/01 Vaughan Hobbs - Head Of Music C.Aguilera, Lill Kim, Mya & Pink -Lady Marmalade Power Rotation: Faith Hill -There You'll Be RE. 102.5 - HIT RADIO/Cologno Monzese (MI) P Pied Piper/Masters 01Ceremonies-Do You Really Like It? Shaggy teat. Rayvon-Angel HOT AC Media Luca Viscardi - Programme Director MOST ADDED BEAT 106/Glasgow G Playlist Additions: ALTERNATIVE FRANCF Faithless -We Come 1 Most Added are those songs which received the highest number of playlist additions Playlist Additions: R. Kelly -Fiesta during the week. In the case of a tie, songs are listed alphabetically by artist, Daft Punk -Digital Love EUROPE 2 NETWORK/Paris P Robert Miles -Paths Delerium feat Leigh Nash -Innocents (Haling In Love) AC Sugababes-Run For Cover C.Aguilera, Lil' Kim, Mya & PinkLady Fun Lovin' Criminals -Bump Sebastien Cauet - Prog. Dir. Titiyo-Come Along Gloss -New York Boy Playlist Additions: Marmalade (Festival) 13 I Monster -Daydream In Blue Pascal Obispo-Ce Qu'On Voit Allee Rimbaud Daft Punk Digital Love Kid Galahad-Stealin' Beats EP Patrick Bruel-Au Bout De La Marelle PA I NJ (Virgin) 11 CLYDE 1 FM/Glasgow G FRANCE INTER/Paris P CADENA DIAL/Madrid P CHR FULL SERVICE NATIONAL MUSIC Bran Van 3000 feat. Curtis Mayfield Ross Macfadgen - Head Of Music Bernard Chereze - Music Dir Paco Herrera - Prog Dir/ Astounded (Grand Royal) 9 Playlist Additions: Playlist Additions: Music Programmer 2Pac-Until The End Of Time Ani Di Franco -Heartbreak Even Power Rotation: Faithless We Come 1 Brandy & Ray J -Another Day In Paradise Hubert Felix Thiefaine-Le Touquet Juillet 1925 Cafe Quijano-Nada De Na Daft Punk -Digital Love Madredeus-O Labirinto Parado Playlist Additions: (Cheeky/Arista) 9 Dina Carroll -Someone Like You Marc Lavoine-Le Pont Mirabeau Daniel Andrea -Dime Por Qu' Farrell Lennon -World's Greatest Lover Tete-Les Envies Ella Baila Sola-Sin Confesarlo Todo Shaggy feat. -

Musikexpress Feiert Style-Award-Jubiläum Mit Mode-Special
MUSIKEXPRESS 19.10.2009 – 18:00 Uhr Musikexpress feiert Style-Award-Jubiläum mit Mode-Special München (ots) - 16. Oktober 2009 Seit fünf Jahren ehrt der Musikexpress mit dem Style Award Modelabels, Musiker und Medien, die mit Stilbewusstsein und Mut zur Innovation die Popkultur vorantreiben. Zum Geburtstag gratuliert sich der Musikexpress mit einem Fashion-Special. Indierocker wie Beth Ditto spazieren über die Catwalks der Welt, Elektro-Acts wie Justice liefern den Soundtrack dazu. Madonna wirbt für Versace. Pete Doherty komponiert für Dior. Karl Lagerfelds Plattensammlung ist größer als so manche innerstädtische Tonträgerabteilung. Man sieht: Die symbiotischen Verflechtungen von aktueller Musik und aktueller Mode sind nicht länger zu leugnen. Der Musikexpress zollt dieser Entwicklung mit einem 30-seitigen "Style Special" in seiner Dezemberausgabe (jetzt am Kiosk) Rechnung. In dem Sonderteil stellt das Musikmagazin, das kürzlich seinen 40. Geburtstag feierte, die Gewinner des Musikexpress Style-Award 2009 vor. Das Special enthält unter anderem eine Modestrecke mit den Siegern in der Kategorie "Performer domestic" (die Berliner Newcomersensation Bonaparte) und "Performer international" (die britischen Elektropopper um Madonna-Produzent Stuart Price, Zoot Woman). Modemuffel haben allerdings nichts zu befürchten: Das "Style Special" geht nicht auf Kosten der Musikthemen. Das 164 Seiten starke Heft behandelt auf über 130 Seiten wie gewohnt alle relevanten Trends der aktuellen Musikszene, bespricht die Platten, auf die es im Herbst ankommt. Dazu gibt es zwei Geschichtsstunden: In zwei großen Dossiers erzählt das Magazin die Geschichte von Pearl Jam und der momentan wieder einmal größten Band des Planeten, der Beatles. Pressekontakt: Kontakt: Redaktion Musikexpress Tel: +49 089/ 697 49 400 Diese Meldung kann unter https://www.presseportal.ch/de/pm/100002141/100591867 abgerufen werden.. -

Strut, Sing, Slay: Diva Camp Praxis and Queer Audiences in the Arena Tour Spectacle
Strut, Sing, Slay: Diva Camp Praxis and Queer Audiences in the Arena Tour Spectacle by Konstantinos Chatzipapatheodoridis A dissertation submitted to the Department of American Literature and Culture, School of English in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy Faculty of Philosophy Aristotle University of Thessaloniki Konstantinos Chatzipapatheodoridis Strut, Sing, Slay: Diva Camp Praxis and Queer Audiences in the Arena Tour Spectacle Supervising Committee Zoe Detsi, supervisor _____________ Christina Dokou, co-adviser _____________ Konstantinos Blatanis, co-adviser _____________ This doctoral dissertation has been conducted on a SSF (IKY) scholarship via the “Postgraduate Studies Funding Program” Act which draws from the EP “Human Resources Development, Education and Lifelong Learning” 2014-2020, co-financed by European Social Fund (ESF) and the Greek State. Aristotle University of Thessaloniki I dress to kill, but tastefully. —Freddie Mercury Table of Contents Acknowledgements...................................................................................i Introduction..............................................................................................1 The Camp of Diva: Theory and Praxis.............................................6 Queer Audiences: Global Gay Culture, the Arena Tour Spectacle, and Fandom....................................................................................24 Methodology and Chapters............................................................38 Chapter 1 Times -
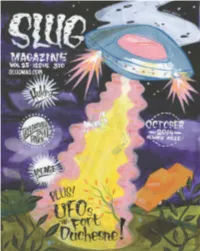
Slugmag.Com 1
slugmag.com 1 SaltLakeUnderGround • Vol. 25 • Issue #310 • October 2014 • slugmag.com ABOUT THE COVER: There’s something out there, right in our back yard—in Ft. Duchesne, Utah, where Publisher: Eighteen Percent Gray Marketing Coordinator: people often report sightings of lights, noises and Editor: Angela H. Brown Robin Sessions voices possibly associated with UFOs. Revel in illus- Managing Editor: Alexander Ortega Marketing Team: Alex Topolewski, Carl Acheson, trator Robin Banks’ sensationalized presentation of Junior Editor: Christian Schultz Cassie Anderson, Cassie Loveless, Ischa B., Janie this Northeastern Utah point of interest. SLUG Senior Office Coordinator:Gavin Sheehan Greenberg, Jono Martinez, Kendal Gillett, Rachel Staff Writer Cody Kirkland went down to investi- Fact Checker: Henry Glasheen Roller, Raffi Shahinian, Robin Sessions, Zac Freeman gate—read his story on pg. 36. Copy Editing Team: Alex Cragun, Alexander Social Media Coordinator: Catie Weimer Ortega, Allison Shephard, Christian Schultz, Cody Distribution Manager: Eric Granato DISCLAIMER: SLUG Magazine does not necessarily Kirkland, Genevieve Smith, Henry Glasheen, Distro: Adam Okeefe, Eric Granato, John Ford, maintain the same opinions as those found in our John Ford, Jordan Deveraux, Julia Sachs, Maria Jordan Deveraux, Julia Sachs, Michael Sanchez, content. We seek to circulate ideas and dialogue Valenzuela, Mary E. Duncan, Shawn Soward, Traci Nancy Burkhart, Nancy Perkins, Nate Abbott, Ricky through quality coverage of contemporary music, art, Grant Vigil, Ryan Worwood, Tommy Dolph, Tony Bassett, action sports and the subcultures therein … except Content Consultants: Jon Christiansen, Xkot Toxsik rollerblading. Content is property of SLUG Magazine— Matt Hoenes Senior Staff Writers: Alex Springer, Alexander Cover Illustration: Robin Banks Ortega, Ben Trentelman, Brian Kubarycz, Brinley please do not use without written permission. -

History Report Freiburg HOT 03.02.2016 00 Through 09.02.2016 23
History Report Freiburg_HOT 03.02.2016 00 through 09.02.2016 23 Air Date Air Time Cat RunTime Artist Keyword Title Keyword Mi 03.02.2016 00:05 SRO 04:11 Purple Souls There Goes The Fear Mi 03.02.2016 00:09 EKR 02:28 Bondage Fairies Clone Mi 03.02.2016 00:12 DPR 03:10 ANSA Foto Mi 03.02.2016 00:15 RCK 04:34 David Bowie Rebel Rebel Mi 03.02.2016 00:19 EKR 03:59 Delphic Doubt Mi 03.02.2016 00:23 RCK 03:04 The Rural Alberta Advantage Terrified Mi 03.02.2016 00:26 RCK 03:08 Eating Pebble Wrestling The Radio Mi 03.02.2016 00:30 NAC 01:41 EFFI Lovefiles Mi 03.02.2016 00:31 ARO 03:42 Foals Birch Tree Mi 03.02.2016 00:35 EKR 08:05 Ry/Frank Wiedemann Howling Mi 03.02.2016 00:43 SRO 04:18 Søjus1 003 (feat. i Am Halo) Mi 03.02.2016 00:47 POP 03:31 Kakkmaddafakka Forever Alone Mi 03.02.2016 00:51 DPR 03:08 Niels Frevert Das mit dem Glücklichsein ist relativ Mi 03.02.2016 00:54 RCK 03:52 The white stripes My Doorbell Mi 03.02.2016 00:58 ARO 02:40 JAIN Come Mi 03.02.2016 00:61 EKR 03:27 Darkstar Amplified Ease Mi 03.02.2016 00:64 POP 03:18 Monta all the luck in the world Mi 03.02.2016 00:67 NAC 04:25 William Fitzsimmons When I Come Home Mi 03.02.2016 00:72 NAC 04:00 Willard Grant Conspiracy Mary Of The Angels Mi 03.02.2016 01:05 NAC 04:43 Badly drawn boy Year of the Rat Mi 03.02.2016 01:10 J 00:02 Flüsterer_Ids1 Mi 03.02.2016 01:10 RCK 03:24 Givers Up Up UP Mi 03.02.2016 01:13 ARO 03:07 Lilith Ai Hang Tough Mi 03.02.2016 01:16 POP 04:18 Elliott Smith Cant Make A Sound Mi 03.02.2016 01:21 NAC 07:22 Sigur Rós Svo Hljótt Mi 03.02.2016 01:28 POP 03:58 The -
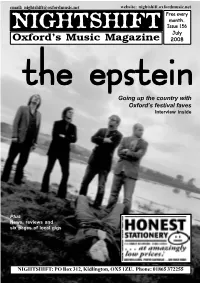
Issue 156.Pmd
email: [email protected] website: nightshift.oxfordmusic.net Free every month. NIGHTSHIFT Issue 156 July Oxford’s Music Magazine 2008 thethethe epsteinepsteinepstein Going up the country with Oxford’s festival faves Interview inside Plus News, reviews and six pages of local gigs NIGHTSHIFT: PO Box 312, Kidlington, OX5 1ZU. Phone: 01865 372255 NEWNEWSS Nightshift: PO Box 312, Kidlington, OX5 1ZU Phone: 01865 372255 email: [email protected] Online: nightshift.oxfordmusic.net LOCAL PHOTOGRAPHER MARC WEST has an exhibition of his music photos at the Lolapaloza Gallery on Blue Boar Street from Monday 30th June through to Thursday 31st July. Marc, whose exhibition is entitled First 3, No Flash, regularly contributes live photos to Nightshift as well as conducting band interviews for BBC Rado Oxford’s Introducing music show. Lolapaloza is open from 10am through to 5.30pm. A LOCAL POP LEGENDS THE special evening viewing, on Friday 4th July, CANDYSKINS are set to reform again for from 5.30-8pm, features a live set from a one-off Music For Life gig in aid of Tristan & The Troubadours. Cancer Research at the Academy on Friday 8th August. The band, who last played SUNNYVALE NOISE SUB-ELEMENT together at the Zodiac’s closing down party release a limited edition album of live last year, will be joined by fellow Britpop tracks and remixes this month. ‘More stars Dodgy as well as Frank Turner and A Than 20%’ is available from the band’s Silent Film. The benefit gig is being website and comes in a hand-doodled and organised by Dave Holt, who managed numbered mailer box and features remixes Unbelievable Truth and promoted early by the likes of Boywithatoy, Eduard shows by Radiohead and Supergrass, who Soundingblock, Space Heroes of the has been treated for cancer this year. -

10,000 Maniacs Beth Orton Cowboy Junkies Dar Williams Indigo Girls
Madness +he (,ecials +he (katalites Desmond Dekker 5B?0 +oots and Bob Marley 2+he Maytals (haggy Inner Circle Jimmy Cli// Beenie Man #eter +osh Bob Marley Die 6antastischen BuBu Banton 8nthony B+he Wailers Clueso #eter 6oA (ean #aul *ier 6ettes Brot Culcha Candela MaA %omeo Jan Delay (eeed Deichkind 'ek181Mouse #atrice Ciggy Marley entleman Ca,leton Barrington !e)y Burning (,ear Dennis Brown Black 5huru regory Isaacs (i""la Dane Cook Damian Marley 4orace 8ndy +he 5,setters Israel *ibration Culture (teel #ulse 8dam (andler !ee =(cratch= #erry +he 83uabats 8ugustus #ablo Monty #ython %ichard Cheese 8l,ha Blondy +rans,lants 4ot Water 0ing +ubby Music Big D and the+he Mighty (outh #ark Mighty Bosstones O,eration I)y %eel Big Mad Caddies 0ids +able6ish (lint Catch .. =Weird Al= mewithout-ou +he *andals %ed (,arowes +he (uicide +he Blood !ess +han Machines Brothers Jake +he Bouncing od Is +he ood -anko)icDescendents (ouls ')ery +ime !i/e #ro,agandhi < and #elican JGdayso/static $ot 5 Isis Comeback 0id Me 6irst and the ood %iddance (il)ersun #icku,s %ancid imme immes Blindside Oceansi"ean Astronaut Meshuggah Con)erge I Die 8 (il)er 6ear Be/ore the March dredg !ow $eurosis +he Bled Mt& Cion 8t the #sa,, o/ 6lames John Barry Between the Buried $O6H $orma Jean +he 4orrors and Me 8nti16lag (trike 8nywhere +he (ea Broadcast ods,eed -ou9 (,arta old/inger +he 6all Mono Black 'm,eror and Cake +unng &&&And -ou Will 0now Us +he Dillinger o/ +roy Bernard 4errmann 'sca,e #lan !agwagon -ou (ay #arty9 We (tereolab Drive-In Bi//y Clyro Jonny reenwood (ay Die9 -

History Report Freiburg HOT 30.07.2016 00 Through 05.08.2016 23
History Report Freiburg_HOT 30.07.2016 00 through 05.08.2016 23 Air Date Air Time Cat RunTime Artist Keyword Title Keyword Sa 30.07.2016 00:05 ARO 02:47 AnnenMayKantereit Wohin du gehst Sa 30.07.2016 00:08 SRO 04:17 BadBadNotGood Time Moves Slow (feat. Samuel T. Herring) Sa 30.07.2016 00:12 HIP 03:45 G Love and Special Sauce Baby's Got Sauce Sa 30.07.2016 00:16 J 00:12 uniFM ID Brothers Of Santa Claus Sa 30.07.2016 00:16 RCK 02:43 Beatsteaks Ain't Complaining Sa 30.07.2016 00:19 SRO 03:50 Hanna Georgas Don't Go Sa 30.07.2016 00:23 POP 02:38 Lambchop Gone Tomorrow Sa 30.07.2016 00:25 RCK 03:53 Funeral Suits All Those Friendly People Sa 30.07.2016 00:29 RCK 02:21 Kings of leon king of the rodeo Sa 30.07.2016 00:31 ARO 03:41 Gypsy and the Cat Inside Your Mind Sa 30.07.2016 00:35 POP 02:20 Fenster Oh Canyon Sa 30.07.2016 00:37 SRO 02:48 Charlie Cunningham Telling It Wrong Sa 30.07.2016 00:40 HIP 04:05 Der Tobi Und Das Bo Morgen geht die Bombe hoch Sa 30.07.2016 00:44 J 00:13 uniFM ID Wanda Sa 30.07.2016 00:45 SRO 02:45 Aesop Rock Kirby Sa 30.07.2016 00:47 ARO 03:54 Femme Dumb Blonde Sa 30.07.2016 00:51 EKR 03:29 Me Succeeds Riemerling Sa 30.07.2016 00:55 POP 02:46 Poor Moon People In Her Mind Sa 30.07.2016 00:57 POP 03:46 Coldplay Strawberry Swing Sa 30.07.2016 00:61 RCK 03:31 Say Hi to Your Mom northwestern girls Sa 30.07.2016 00:65 SRO 03:51 Oracles Amoeba Sa 30.07.2016 00:69 RCK 03:31 Kensington Road Tired Man Sa 30.07.2016 01:05 SRO 03:46 Joana Serrat Cloudy Heart Sa 30.07.2016 01:09 EKR 03:20 Caribou Our Love Sa 30.07.2016 01:12 HIP 04:22 -

Corpus Antville
Corpus Epistemológico da Investigação Vídeos musicais referenciados pela comunidade Antville entre Junho de 2006 e Junho de 2011 no blogue homónimo www.videos.antville.org Data Título do post 01‐06‐2006 videos at multiple speeds? 01‐06‐2006 music videos based on cars? 01‐06‐2006 can anyone tell me videos with machine guns? 01‐06‐2006 Muse "Supermassive Black Hole" (Dir: Floria Sigismondi) 01‐06‐2006 Skye ‐ "What's Wrong With Me" 01‐06‐2006 Madison "Radiate". Directed by Erin Levendorf 01‐06‐2006 PANASONIC “SHARE THE AIR†VIDEO CONTEST 01‐06‐2006 Number of times 'panasonic' mentioned in last post 01‐06‐2006 Please Panasonic 01‐06‐2006 Paul Oakenfold "FASTER KILL FASTER PUSSYCAT" : Dir. Jake Nava 01‐06‐2006 Presets "Down Down Down" : Dir. Presets + Kim Greenway 01‐06‐2006 Lansing‐Dreiden "A Line You Can Cross" : Dir. 01‐06‐2006 SnowPatrol "You're All I Have" : Dir. 01‐06‐2006 Wolfmother "White Unicorn" : Dir. Kris Moyes? 01‐06‐2006 Fiona Apple ‐ Across The Universe ‐ Director ‐ Paul Thomas Anderson. 02‐06‐2006 Ayumi Hamasaki ‐ Real Me ‐ Director: Ukon Kamimura 02‐06‐2006 They Might Be Giants ‐ "Dallas" d. Asterisk 02‐06‐2006 Bersuit Vergarabat "Sencillamente" 02‐06‐2006 Lily Allen ‐ LDN (epk promo) directed by Ben & Greg 02‐06‐2006 Jamie T 'Sheila' directed by Nima Nourizadeh 02‐06‐2006 Farben Lehre ''Terrorystan'', Director: Marek Gluziñski 02‐06‐2006 Chris And The Other Girls ‐ Lullaby (director: Christian Pitschl, camera: Federico Salvalaio) 02‐06‐2006 Megan Mullins ''Ain't What It Used To Be'' 02‐06‐2006 Mr. -

ETTA JAMES Etta James: the Montreux Years Release Date: May 28, 2021
ada–music.com @ada_music NEW RELEASE GUIDE May 28 June 4 ORDERS DUE APRIL 23 ORDERS DUE APRIL 30 2021 ISSUE 12 May 28 ORDERS DUE APRIL 23 CAN LIVE IN STUTTGART 1975 Street Date: 5/28/2021 Neu!, Faust, Cluster, Harmonia, Mute are delighted to announce the release of Can FOR FANS OF: Amon Düül II, Tangerine Dream Live in Stuttgart 1975, the first in a series of Can live 3xLP: 5400863043391 concerts available in full for the first time on vinyl, SLRP: 49.98 File Under: Alternative CD and digital formats. LP Non-Returnable Limited Edition Orange Vinyl NOT FOR EXPORT Originally recorded on tape, these carefully restored 2xCD: 5400863043407 live albums will comprise the entirety of each show SLRP: 17.98 in the format of a story with a beginning, middle File Under: Alternative and end, with Can’s performances taking on a life of NOT FOR EXPORT their own. Digital UPC: 5400863043414 TRACKLISTING: Can Live in Stuttgart 1975 will be available on limited edition triple orange vinyl and double CD. 1. Stuttgart 75 Eins 4. Stuttgart 75 Vier Both formats include booklets with extensive sleeve 2. Stuttgart 75 Zwei 5. Stuttgart 75 Fünf notes by novelist Alan Warner, archivist Andy Hall 3. Stuttgart 75 Drei and manager Sandra Podmore Schmidt. ALSO AVAILABLE FROM CAN: The band’s line up for this legendary 1975 Tago Mago performance features all four original members— 2xLP: 724596951934 CD: 724596937723 Irmin Schmidt on keys, Jaki Leibezeit on drums, SLRP: 30.98 SLRP: 11.98 Michel Karoli on guitar, and Holger Czukay on bass. -

Die Form Tanzwut Lacrimosa
edition October - December 2014 free of charge, not for sale 15 quarterly published music magazine DIE FORM TANZWUT LACRIMOSA DIARY OF DREAMS NOOK KARAVAN FOLK + CESAIR SCARLET SOHO + METROLAND HULDRE + SKEPTICAL MINDS DER KLINKE + VIEON - 1 - WOOL-E TOP 10 WOOL-E TAPES Best Selling Releases (July/August/September 2014) Wool-E Tapes is a spin-off of Wool-E Shop to release everything its owner likes on tape 1. KLINIK Box (8CD) WET010 – Luminance/Acapulco City 2. LUMINANCE/ACAPULCO CITY Hunters – The Cold Rush C36 HUNTERS The Cold Rush (MC) WET011 - Woodbender/Cinema Perdu/The 3. XENO & OAKLANDER [Law-Rah] Collective - Blue Ruins Under Par Avion (CD/LP) Yellow Skies C58 4. LUMINANCE The Light Is Ours (12”/MC) WET012 - Sebastien Crusener – 5. ASMODAEUS Dwaalspoor C80 Lies And Logic (LP) 6. VARIOUS WET013 - Man Without World - And Then Romance Moderne II (LP) It Ends C70 7. VARIOUS Transmission Barcelona (LP) WET015 – Various - The 15th C44 8. PARADE GROUND Strange World (CD) Coming up: Luminance repress, Transfigure 9. KLINE COMA XERO repress, Factice Factory, The Broken Window Kline Coma Xero (LP) Theory,… 10. POLICE DES MOEURS/ESSAIE PAS Still available: Split (12”) WET001 – Woodbender – Coincidences C55 WET002 – Cinema Perdu – Reworks C100 WET005 – Breast Implosion – Necronomicon C110 WET007 – Kingstux – Red & Blue C36 WET008 – Kevin Strauwen – Moving Sound & Music For Film C37 For sounds, check our bandcamp page: http://wool-e-tapes.bandcamp.com The Wool-E Shop - Emiel Lossystraat 17 - 9040 Ghent - Belgium VAT BE 0642.425.654 - [email protected] -

October 11Th —15Th, 2017
OCTOBER 11 TH—15 TH, 2017 SANTA CRUZ FILM FESTIVAL 2017 1 Inform. Welcome The Santa Cruz Film Festival celebrates its 15th year this season, and I’m honored for the opportunity to play a small part in this tradition, directing the festival for the 2nd year at the Entertain. Tannery Arts Center. Over the years the festival has seen changes and innovations to the program as well as special traditions maintained throughout it’s history. A tradition I’m proud to honor is the screening of fi lms in our Earth Vision category. Santa Cruz was home to an Earth Vision Film Festival for 10 years before the launch of the Santa Inspire. Cruz Film Festival, and we continue to keep that festival’s vision alive through a segment dedicated to environmental fi lms. Increasingly, independent fi lm is able to raise awareness about the preservation of our natural world through it’s use of engaging visual imagery – seeing the scenic beauty of our earth in fi lm has always had an impact — combined with documentary style story telling about what’s happening to our planet. This year we have several wonderful Earth Vision selections including a special short fi lm program with an ocean theme. So many artists call Santa Cruz home, that it is natural for our festival to attract artistic fi lms. With our new venue at the Tannery Arts Center, we’ve begun a new tradition for bringing more fi lms about the arts. This year we look at the art of fi lm from the insider’s vantage of a travelling fi lm festival in rural India with The Cinema Travellers, our opening fi lm.