Wiener O B O En-Jo Urnal
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Physical Modeling Sound Simulations for the Study of the Quality of Wind Instruments Jean-François Petiot, Robin Tournemenne, Joel Gilbert
Physical modeling sound simulations for the study of the quality of wind instruments Jean-François Petiot, Robin Tournemenne, Joel Gilbert To cite this version: Jean-François Petiot, Robin Tournemenne, Joel Gilbert. Physical modeling sound simulations for the study of the quality of wind instruments. ICSV2019 - 26th International Congress on Sound and Vibration, Jul 2019, Montréal, Canada. hal-02466551 HAL Id: hal-02466551 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02466551 Submitted on 10 Feb 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. PHYSICAL MODELING SOUND SIMULATIONS FOR THE STUDY OF THE QUALITY OF WIND INSTRUMENTS Jean-François Petiot Ecole Centrale de Nantes, Nantes, France email: [email protected] Robin Tournemenne INRIA, Bordeaux, France e-mail: [email protected] Joël Gilbert LAUM, Le Mans, France e-mail: [email protected] Physical modeling sound simulations can be potentially interesting for instrument design as far as they are representative of the functioning of the real instrument. This work studies to what ex- tent sound simulations of a brass instrument (the trumpet) are predictive of certain playing char- acteristics of the instrument (intonation, timbre). -

Film Presentations Lectures Panel Discussions Workshops
11–15 August 2014 Reichenau an der Rax / Austria Schloss Reichenau Film Presentations Lectures Panel Discussions Workshops FREE ADMISSION © Stephan Polzer www.isa-music.org isamusic.org Preface Dear Ladies and Gentlemen, The development of society, of any cultural community, depends on people reflecting and working on past events. This year‘s edition of isa will not only look back to the events of 1814, 1914 and 1989, but also examine the changes we have been through since and in what way these changes have affected our lives – as a society and as a cultural community. As rector of one of the biggest cultural institutions in the world, I wish you much inspiration and personal development as you explore and visit the wide range of courses, concerts and workshops of isa14. Werner Hasitschka Rector of the mdw – University of Music and Performing Arts Vienna 2 With last year’s first edition, isaScience began developing into a forum for the university’s Preface research departments, working in direct contact with the artists of the isa master classes and their respective communities. But isaScience is also reaching out to a broader public interested in scholarly discourse on music-related matters that tie in to historical, sociological, pedagogical, acoustical and anthropological issues, and it takes place in an atmosphere characterised by relaxed encounters between participants and the staff, who come from a considerable number of different countries and research traditions. This year’s contributions not only cover a more complete range of academic fields, running from acoustics and music pedagogy to music history and ethnomusicology, but are also presented as part of a programme that encourages and facilitates inter- disciplinary communication and exchange in the form of several workshops that are closely related to isa’s master class programme. -

„Distinguishing Marks“ of the Vienna Philharmonic Orchestra M
A new search for acoustic „distinguishing marks“ of the Vienna Philharmonic Orchestra M. Bertsch Institut für Wiener Klangstil, University of Music, Singerstr. 26a, 1010 Vienna, Austria "Vienna is Different" is the slogan you read when you enter the city on the highways. Differences are also associated with the sound of the famous Vienna Philharmonic Orchestra (VPO). This orchestra's individual sound characteristic is caused partly by different musical instruments (oboe, horn or timpani), and partly through a specific playing style. While the individual sound variations of these instruments have been investigated in previous studies at our Institute, this paper presents a more general approach to the "distinguishing mark" of this orchestra. 21 sound-pairs of orchestral CD-recordings were offered to test subjects: one example from the VPO and a second from the Berlin Philharmonic or New York Philharmonic Orchestras. The task was to listen and to identify the Viennese one. Listener test data are statistically analyzed to find who identified the orchestra correctly most often and through which examples (involved instruments in the example, musical background and origin of the listener, etc. are taken into account). The aim of the study is to find out which instruments do establish the typical Vienna orchestra signature. Which instruments give the best clues for identifying the VPO? The members of the audience are invited to make their own decisions. INTRODUCTION examples is between 3 and 35 seconds (15 seconds on What is special about the Viennese orchestra ? This average). While short examples allow the comparison question exists as long as the world famous orchestra of timbre and short time elements, longer examples are itself. -

Untersuchungen Zum Stopfen Bei Hörnern
Untersuchungen zum Stopfen bei Hörnern Diplomarbeit aus musikalischer Akustik durchgeführt von Stefan Wachter Institut für Wiener Klangstil der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien Vorstand: Univ.-Prof. Mag. Gregor Widholm und Institut für elektronische Musik und Akustik der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz Univ.-Prof. DI Mag. Dr. techn. Robert Höldrich Wien, im Oktober 2008 Diplomarbeit Untersuchungen zum Stopfen bei Hörnern Zusammenfassung Zusammenfassung Die "Stopftechnik" bei Hörnern ist eine seit mehr als 250 Jahren angewandte Spieltechnik, um den Klang und die Intonation zu verändern. Je weiter die rechte Hand in den Schalltrichter eingeführt wird, desto tiefer wird der Ton. Ab einem bestimmten Punkt, wenn die Hand ca. 95% der Schalltrichteröffnung verschließt, springt die Intonation plötzlich um einen Halbton hinauf. Unter den Akustikern tobt aber noch immer der Streit, ob der Ton nun höher oder tiefer wird. In dieser Arbeit wird das offe- ne und gestopfte Horn durch Eingangsimpedanz und Übertragungsfunktionsmessungen akustisch untersucht. Zudem werden die Druckknoten und Bäuche im Instrument mit der Simulationssoftware „Optimierer“ dargestellt. Mit diesen umfassenden Untersu- chungen zum gestopften Horn werden die akustischen Vorgänge geklärt. Abstract Muting techniques have been used for about 250 years to modify a horn’s sound and intonation. The more the right hand is being fed into the bell the more the pitch drops. At a certain point, however, when the hand closes approximately 95 percent of the bell opening, the pitch produced is one semitone sharper than it would be for the open instrument. Acousticians still heavily discuss whether the pitch in fact gets higher or lower. In this thesis the open and stopped horn is acoustically analysed by means of in- put impedance and transfer function measurements. -

Ismra2016-83
Physics of musical instruments and voice: Paper ISMRA2016-83 A new method for high-speed line-scanning of brass players’ vibrating lips using the examples of subcontra G-flat (tuba) and split tones (trombone) (a) (b) Mauersberger Renate , Bergmann-Fischer Gunhild , Massing Thomas(a), Angerstein Wolfgang(a) (a) Duesseldorf University hospital, Germany, [email protected] (b) Medical practice ENT/Phoniatrics Bonn, Germany, [email protected] Abstract This study aims to develop a device for observation of lip vibrations in brass musicians. To avoid motion artefacts, mouthpieces with probe holes for the endoscope were used. A standardised device with fixed coupling between endoscope and camera on the one hand and mouthpiece with instrument on the other hand was constructed. For localisation of the probe hole the endoscope was positioned opposite to the mouthpiece so that the outer rim of the mouthpiece was completely visible through the endoscope. The distance between endoscope tip and outer rim was measured and mirrored on a horizontal axis alongside the outer rim. The optimal position for the probe hole resulted and allowed a frontal view on the lips. Thus, lip vibrations were observed with a kymography camera in real-time. Two examples of high-speed line-scanning illustrate this technique: While playing a subcontra G-flat (approx. 23 Hz), each lip vibration correlates with a video frame (frame rate 25 Hz). Single sinusoidal lip vibrations can be distinguished. Split tones (e.g. “Keren” by Iannis Xenakis) are multiphonic effects on brass instruments. Two pitches with different frequencies are played. The pitches alternate so quickly that the human ear notices them simultaneously. -

2004 the Paradox of Musical Acoustics Objectivzing the Essentially
The paradox of musical acoustics: Objectivzing the essentially subjective Andrew W. Brown Institut für Wiener Klangstil, University of Music and Performing Arts Vienna, Austria www.awbmusic.com Matthias Bertsch Institut für Wiener Klangstil, University of Music and Performing Arts Vienna, Austria http://iwk.mdw.ac.at/mb/welcome.htm In: R. Parncutt, A. Kessler & F. Zimmer (Eds.) Proceedings of the Conference on Interdisciplinary Musicology (CIM04) Graz/Austria, 15-18 April, 2004 http://gewi.uni-graz.at/~cim04/ Music Acoustics. The study of music acoustics may be considered the quintessential interdisciplinary musical science, requiring expertise in a number of areas, including but not limited to musical performance, psychoacoustics, and physics. Background in acoustics. Acoustics is the science that deals with the production, control, transmission, reception, and effects of sound. Sub disciplines include speech processing, room acoustics, environmental noise, vibration in vehicles, ground vibration, marine mammal communication, bioacoustics and musical acoustics. Sub disciplines of musical acoustics include music perception, physical modeling, music performance, and instrumental acoustics. One of the goals of instrumental acoustics is to define quality parameters enabling objective judgments of musical instruments. These quality parameters are largely dependent on subjective factors, however, and remain elusive. Background in music performance. Musical instruments evolved by trial-and-error, fulfilling developing needs of contemporary musicians. Instruments and musicians' playing techniques developed a high level of sophistication long before they came under scientific scrutiny in the last century. Skilled musicians may be able to say immediately if they like an instrument without any idea of its physical function based on his or her traditions, habits, taste, and expressive vision. -
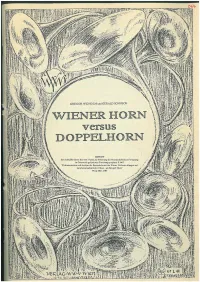
Wien Er Horn
GREGOR WIDHOLM und GERALD SONNECK WIENER HORN versus DOPPEI,HORN REPRI:-'. d", Schlußbcrichl,,:, des 'um Fonds zur Fördcrung dcr wi.'>SCnsch.ftlichen Forschung in O.terrcich geförderten Fo=hunpprojcklc:5 P 5467 "Dokumentatjon und Analyse ~cr Besonderbeiten des V.'icncr OrchcstcrUange.s auf DatUT\loi~n.schafllichcr Ebene· am Beispiel Horn- Wien 1985 · 1987 GREGOR WIDHOLM und GERALD SONNECK WIENERHORN REPRINT des SchJußberichtes des vom Fonds zur Förderung der v.<issenschaftlichen Forschung in Österreich geförderten Forschungsprojektes P 5467 "Dokumentation und Analyse der Besonderheiten des Wiener Orchesterklanges auf naturv.<issenschaftlicher Ebene - am Beispiel Horn" Wien 1985 - 1987 © Copyright by Gregor Widholm und Gerald Sonn eck, 1987 Mag. GREGOR WIDHOLM Institut rur Wiener Klangstil, Hochschule rur Musik und darstellende Kunst in Wien Musiksturuum (Konzertfach Horn) an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien und Studium der Nachrichtentechnik an der Technischen Universität Wien. Seit 1971 Mitglied des Orchesters der Wiener Volksoper. 1980 Ausbau des Institutes für Wiener Klangstil für Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Musikinstrumentenakustik und der Analyse musikalischer Klänge im Auftrag der Musikhochschule Wien. Führte erstmals in Österreich physikalische Meßmethoden zur Beurteilung von Musikinstrumenten und deren Klänge ein. Arbeitet derzeit an einem Konzept zur digitalen Untersuchung und Software-Simulation der Interaktion von Musiker und Instrument. Dipl.-Ing. GERALD SONNECK Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf Institut rur Wiener Klangstil, Hochschule rur Musik und darstellende Kunst in Wien Studierte Technische Physik an der Technischen Universität Wien und Violoncello am Konservatorium der Stadt Wien. Substitut beim ORF-Symphonieorchester und im Orchester der Wiener Volksoper. Mitglied des Ensemble Musica Antiqua, Wien. Seit 1973 Mitarbeiter des Österreichischen Forschungszentrums Seibersdorf. -

Axial Vibrations of Brass Wind Instrument Bells and Their
Rollins College Rollins Scholarship Online Student-Faculty Collaborative Research 6-2015 Axial Vibrations of Brass Wind Instrument Bells and Their Acoustical Influence: Theory and Simulations Wilfried Kausel Institut fÄur Wiener Klangstil (Musikalische Akustik), UniversitÄat fÄur Musik und darstellende Kunst Wein , Austria Vasileios Chatziioannou UniversitÄat fÄur Musik und darstellende Kunst Wein, Austria Thomas R. Moore Department of Physics, Rollins College, [email protected] Britta R. Gorman Rollins College Michelle Rokni Rollins College Follow this and additional works at: http://scholarship.rollins.edu/stud_fac Part of the Other Physics Commons Published In Wilfried Kausel, Vasileios Chatziioannou, Thomas R. Moore, Britta R. Gorman, and Michelle Rokni. J. Acoust. Soc. Am. 137, 3149 (2015). This Article is brought to you for free and open access by Rollins Scholarship Online. It has been accepted for inclusion in Student-Faculty Collaborative Research by an authorized administrator of Rollins Scholarship Online. For more information, please contact [email protected]. Axial vibrations of brass wind instrument bells and their acoustical influence: Theory and simulations Wilfried Kausel and Vasileios Chatziioannou Institute of Music Acoustics (Wiener Klangstil), University of Music and Performing Arts, Vienna, Austria Thomas R. Moore,a) Britta R. Gorman, and Michelle Rokni Department of Physics, Rollins College, Winter Park, Florida 32789, USA (Received 6 October 2014; revised 26 April 2015; accepted 28 April 2015) Previous work has demonstrated that structural vibrations of brass wind instruments can audibly affect the radiated sound. Furthermore, these broadband effects are not explainable by assuming perfect coincidence of the frequency of elliptical structural modes with air column resonances. In this work a mechanism is proposed that has the potential to explain the broadband influences of structural vibrations on acoustical characteristics such as input impedance, transfer function, and radiated sound. -

Collected Papers in Musical Acoustics 1995/2003
6 Collected Papers in Musical Acoustics 1995/2003 Matthias Bertsch Reprint of articles Matthias from Bertsch - 2003 published between 1995 Matthias Bertsch von - 2003Nachdruck aus den 1995 Textbeiträgen Jahren von ISBN Schriftenreihe des Instituts für Wiener Klangstil - Musikalische Akustik 3-900914-04-4 Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Band 6 (2003) Verlag Institut für Wiener Klangstil www.bias.at 0DWWKLDV%HUWVFK&ROOHFWHG3DSHUVLQ0XVLFDO$FRXVWLFV 5HSULQWRIDUWLFOHVIURP0DWWKLDV%HUWVFKSXEOLVKHGEHWZHHQ 1DFKGUXFNYRQ7H[WEHLWUlJHQYRQ0DWWKLDV%HUWVFKDXVGHQ-DKUHQ 6FKULIWHQUHLKHGHV,QVWLWXWVIU:LHQHU.ODQJVWLO 0XVLNDOLVFKH$NXVWLN DQGHU 8QLYHUVLWlWIU0XVLNXQGGDUVWHOOHQGH.XQVW:LHQ %DQG ,QVWLWXWIU:LHQHU.ODQJVWLO 0XVLNDOLVFKH$NXVWLN :LHQ ,6%1 $PMMFDUFE3FTFBSDI1BQFST JO.VTJDBM"DPVTUJDT #SBTT*OTUSVNFOUT #SJEHJOHJOTUSVNFOUDPOUSPMBTQFDUTPGCSBTTJOTUSVNFOUTXJUIQIZTJDTCBTFEQBSBNFUFST JO1SPDFFEJOHTPGUIF4."$ 4UPDLIPMN.VTJD"DPVTUJDT$POGFSFODF 7PMVNF *3PCFSUP#SFTJO )H 4UPDLIPMN,5)4QFFDI .VTJDBOE)FBSJOH 4 #FSUTDI .BUUIJBT QBHF 7JTVBMJ[BUJPOPG#SBTT1MBZFST}8BSNVQCZJOGSBSFEǰFSNPHSBQIZJO#SBTT#VMMFUJO *OUFSOBUJPOBMNBHB[JOFGPSCSBTTQMBZFST/S7VBSNBSFOT $) +FBO1JFSSF.BUIF[ )H #3"44#6--&5*/ 4#FSUTDI .BUUIJBT.BDB ǰPNBT QBHF *OUPOBUJPOPOUSVNQFUTJO1SPDFFEJHTPG*4."A *OUFSOBUJPOBM4ZNQPTJVNPO.VTJDBM "DPVTUJDT -FBWFOXPSUI 8BTIJOHUPO 64" "4" $BUHVU 4#FSUTDI .BUUIJBT QBHF 7BSJBCJMJUJFTJO5SVNQFU4PVOETJO1SPDFFEJOHTPGUIF*OUFSOBUJPOBM4ZNQPTJVNPG.VTJDBM "DPVTUJDT<*4.">7PMVNF**.:&34 "SOPME )H 4U"MCBO 6, *OTUJUVUFPG "DPVTUJDT 4#FSUTDI .BUUIJBT QBHF 5XP"TQFDUTPG5SVNQFU1MBZJOH0OUSVNQFUNVUFT"TQFDUPGUIFFNCPVDIVSFJO -

BACHELOR THESIS Turntable for an Automatic Acquisition System For
BACHELOR THESIS University of Applied Sciences Technikum Wien, Electronic Engineering Turntable for an Automatic Acquisition System for Measuring the Directional Characteristic of Musical Instruments Author: Martin Lahmer Student ID: 1210254005 Academic Supervisor: FH-Prof. Dipl.-Ing. Christian Kollmitzer Company Supervisor: Ing. DI (FH) Alexander Mayer Vienna, June 4, 2014 Declaration „I confirm that this paper is entirely my own work. All sources and quotations have been fully acknowledged in the appropriate places with adequate footnotes and citations. Quotations have been properly acknowledged and marked with appropriate punctuation. The works consulted are listed in the bibliography. This paper has not been submitted to another examination panel in the same or a similar form, and has not been published.“ Vienna, June 4, 2014 Place, Date Signatur Abstract Musical instruments are complex physical systems. This paper deals with the class of brass wind instruments especially the Tuba. Brass instruments are excited by the vibrating lips of the musician and radiates the played tone at the end of the tube via the bell into the acoustic room. How the sound is radiated, is determined by individual characteristics of an musical instrument. One of these attributes is the directivity, which will be considered in greater detail in this work. It defines how the sound is radiated as a function of position and frequency. For this purpose an automatic measuring system was developed which allows stimulating a brass instrument and measuring the radiated sound pressure in different angles. So a complete sound pattern can be created. This was realized by a turntable system which is driven by automatic controlled stepper motors. -

A Remarkable Collection on Tour !
A REMARKABLE COLLECTION ON TOUR ! The Orpheon Foundation Museum of Historical musical instruments In the service of a living tradition... Orpheon Foundation www.orpheon.org [email protected] Praterstrasse 13/2/11, A-1020 Wien, Austria Tel: +431-2143021 1 THE ORPHEON FOUNDATION MUSEUM OF HISTORICAL MUSICAL INSTRUMENTS: BASIS OF THE PROJECT is to preserve a past for our future and giving a The young artist's hand future to our past: historical musical instruments as startles aged instrument: a living heritage of Western Culture for mankind. it sings! Miracle! The Scope of the Project: A Past for our Future - - collecting, restoring and preserving a Future for our Past historical musical instruments of the 16th- 18th Centuries The Orpheon Foundation kindly request you to - Ensuring that these instruments remain in examine this documentation on the Vázquez the hands of practicing musicians, making Collection of Historical Musical Instruments and them available for concerts, recordings, the novel project that its owner, Prof. José Vázquez competitions or study has designed and developed with the experience - Promote research on these instruments and gathered in the past years. their music - Organising conerts, exhibitions, seminars, lectures, courses Two violas da gamba, Exhibition in Perugia 1997 In the opinion of the directors and curators of some the most distinguished museums of musical instruments (The Metropolitan Museum, New York, The Smithsonian Institute a Washington, D.C., The Shrine to Music South Dakota, David Hill, London, John Pringle, USA, etc.), the Orpheon Foundation harbours a collection unique in the world, which truly represents a living cultural heritage. Its owner, Prof. -

Influence of Wall Vibrations on the Sound of Brass Wind Instruments
Rollins College Rollins Scholarship Online Student-Faculty Collaborative Research 11-2010 Influence of wall vibrations on the sound of brass wind instruments Wilfried Kausel Institut fÄur Wiener Klangstil (Musikalische Akustik), UniversitÄat fÄur Musik und darstellende Kunst Wein , Austria Daniel W. Zietlow Department of Physics, Rollins College, [email protected] Thomas R. Moore Department of Physics, Rollins College, [email protected] Follow this and additional works at: http://scholarship.rollins.edu/stud_fac Part of the Physics Commons Published In Wilfried Kausel, Daniel W. Zietlow* and Thomas R. Moore, “Influence of wall vibrations on the sound of brass wind instruments,” Journal of the Acoustical Society of America 128 (5) 3161-3174 (2010). This Article is brought to you for free and open access by Rollins Scholarship Online. It has been accepted for inclusion in Student-Faculty Collaborative Research by an authorized administrator of Rollins Scholarship Online. For more information, please contact [email protected]. Influence of wall vibrations on the sound of brass wind instruments Wilfried Kausel Institute of Musical Acoustics, University of Music and Performing Arts, Anton von Webern Platz 1, A-1030 Vienna, Austria ͒ Daniel W. Zietlow and Thomas R. Moorea Department of Physics, Rollins College, Winter Park, Florida 32789 ͑Received 4 March 2010; revised 2 September 2010; accepted 5 September 2010͒ The results of an experimental and theoretical investigation of the influence of wall vibrations on the sound of brass wind instruments are presented. Measurements of the transmission function and input impedance of a trumpet, with the bell both heavily damped and freely vibrating, are shown to be consistent with a theory that assumes that the internal pressure causes an oscillation of the diameter of the pipe enclosing the air column.