Dgaae Nachrichten
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
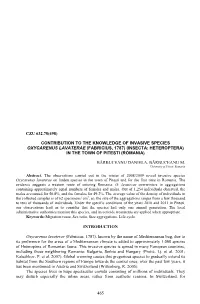
2. Lawrence, J.F., Newton, A.F. Families and Subfamilies of Coleoptera (With Selected Genera, Notes, References and Data on Family-Group Names)
2. Lawrence, J.F., Newton, A.F. Families and subfamilies of Coleoptera (with selected genera, notes, references and data on family-group names). In: Pakaluk, J., Slipinski, S. A. (Eds.), Biology, phylogeny and classification of Coleoptera: papers celebrating the 80th birthday of Roy A. Crowson. 1995. Vol. 2. Museum i Instytut Zoologii PAN, Warsaw, pp. 779-1006 3. Majerus, M.E.N. Ladybirds. London: Harper Collins, 1994. 359 p. ISBN 0-00-219935 - 1 4. MКУФКăC.G.ăТă MМCШЫqЮШНКХОăD.B.ă – Ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) of the Atlantic Maritime Ecozone. In: Assessment of Species Diversity in the Atlantic Maritime Ecozone. Canada, Ottawa: D.F. McAlpine and I.M. Smith. NRC Research Press, 2010. pp. 436 – 452, 5. Thalji R. Composition of Coccinellid Comunities in Suger Beet Fields in Vojvidina. In: Proc. Nat. Sci., Matica Srpska Novi Sad. 2006. no. 110, pp. 267 – 273 6. Vandenberg N.J. Coccinellidae Latreille 1807. In: Arnett, R.H., Jr., Thomas, M.C., Skelley, P.E., Frank, J.H. (Eds.), American Beetles. CRC Press, Boca Raton, 2002. pp. 371-389 7. VьЫЭОТЮă AЧКă – Maria, Grozea IШКЧК,ă ЭОПă RКЦШЧК,ă VХКНă M.,ă DШЛЫТЧă IШЧОХК. Faunistic study of ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) in the Banat region, Romania. In: Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca Agriculture, 2015. vol. 72 (ьЧăМЮЫЬăНОăКЩКЫТТО) CZU 632.78(498) CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF INVASIVE SPECIES OXYCARENUS LAVATERAE (FABRICIUS, 1787) (INSECTA: HETEROPTERA) IN THE TOWN OF PITESTI (ROMANIA) BRBUCEANUăDANIELA,ăBRBUCEANUăM. UЧТЯОrЬТЭвăШПăPТЭОşЭТ,ăRШЦКЧТК Abstract. The observations carried out in the winter of 2008/2009 reveal invasive species Oxycarenus lavaterae ШЧă ХТЧНОЧă ЬЩОМТОЬă ТЧă ЭСОă ЭШаЧă ШПă PТЭОşЭТă КЧНă ПШЫă ЭСОă ПТЫЬЭă ЭТЦОă ТЧă RШЦКЧТК.ă TСОă evidence suggests a western route of entering Romania. -

ICDPP București - Specii Invazive În România
ICDPP București - Specii Invazive în România Alina - Gabriela Geicu PLOȘNIȚA SEMINȚELOR DE TEI - OXYCARENUS LAVATERAE Încadrare sistematică: Regn: Animalia Încrengătura: Arthropoda Clasa: Insecta Ordin: Hemiptera Famila: Lygaeidae Gen: Oxycarenus Specia: Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) Răspândire: În ultima vreme, ploșnița semințelor de tei sau ploșnita Mediteraneană (Oxycarenus lavaterae) își face tot mai simțită prezența în zona urbană, pe trunchiul pomilor de tei din parcuri sau aliniamente stradale. Ploșnița este o specie invazivă originară din zona vest Mediteraneană, de unde și numele de ploșnita Mediteraneană. O. lavaterae s-a răspândit rapid cu populații masive în regiunea Fig. 1. Oxycarenus lavaterae Palearctică, din nord-vestul continentului African până în vestul Europei. În Europa este răspândită în majoritatea țărilor din est, centru și sud-est. În ultimii 20 de ani ploșnița s-a răspândit spre nord și a fost găsită în Muntenegru (1985), Ungaria (1994), Slovacia (1995), Serbia (1996), Bulgaria (1998), Nordul Franței (1999), Austria (2001), Elveția de Nord (2002), Finlanda (2003), Republica Cehă (2004), Germania (2004), România (2008) și Republica Moldova (2016). Principalele căi de pătrundere a dăunătorului în zone noi libere: Căile posibile de pătrundere a ploșniței teiului din zonele unde specia există în zone libere sunt accentuate de comerțul și schimbul de material săditor din speciile gazdă afectate. În plus, iernile cu temperaturi blânde, așa cum sunt de ceva vreme, permit supraviețuirea populațiilor peste iarnă întărind rezerva biologică a dăunătorului (Derjanschi & Elisoveţcaia, 2017). Distribuție în România: Prima semnalare a speciei în România a fost în 2008 pe specii de tei din orașul Pitești (Bărbuceanu, 2012). În 2009, specia a fost observată și în regiunea Banatului. -
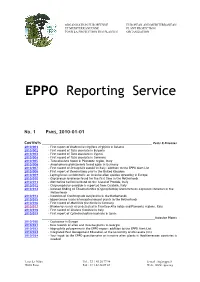
EPPO Reporting Service
ORGANISATION EUROPEENNE EUROPEAN AND MEDITERRANEAN ET MEDITERRANEENNE PLANT PROTECTION POUR LA PROTECTION DES PLANTES ORGANIZATION EPPO Reporting Service NO. 1 PARIS, 2010-01-01 CONTENTS _____________________________________________________________________ Pests & Diseases 2010/001 - First report of Diabrotica virgifera virgifera in Belarus 2010/002 - First record of Tuta absoluta in Bulgaria 2010/003 - First record of Tuta absoluta in Cyprus 2010/004 - First record of Tuta absoluta in Germany 2010/005 - Tuta absoluta found in Piemonte region, Italy 2010/006 - Anoplophora glabripennis found again in Germany 2010/007 - First record of Drosophila suzukii in Italy: addition to the EPPO Alert List 2010/008 - First report of Dendrolimus pini in the United Kingdom 2010/009 - Leptoglossus occidentalis: an invasive alien species spreading in Europe 2010/010 - Oxycarenus lavaterae found for the first time in the Netherlands 2010/011 - Marchalina hellenica found on the Island of Procida, Italy 2010/012 - Chrysomphalus aonidum is reported from Calabria, Italy 2010/013 - Isolated finding of Thaumatotibia (Cryptophlebia) leucotreta on Capsicum chinensis in the Netherlands 2010/014 - Incursion of Stathmopoda auriferella in the Netherlands 2010/015 - Hypercompe icasia intercepted on pot plants in the Netherlands 2010/016 - First record of Monilinia fructicola in Germany 2010/017 - Blueberry scorch virus detected in Trentino-Alto Adige and Piemonte regions, Italy 2010/018 - First record of Chalara fraxinea in Italy 2010/019 - First report of Cylindrocladium buxicola in Spain CONTENTS _______________________________________________________________________Invasive Plants 2010/020 - Cactaceae in Europe 2010/021 - New records of alien and invasive plants in Georgia 2010/022 - Hygrophila polysperma in the EPPO region: addition to the EPPO Alert List 2010/023 - Integrated Pest Management Education at the University of Minnesota (US) 2010/024 - Your input to the EPPO questionnaire on invasive alien plants in Mediterranean countries is needed 1, rue Le Nôtre Tel. -

Autumn 2011 Newsletter of the UK Heteroptera Recording Schemes 2Nd Series
Issue 17/18 v.1.1 Het News Autumn 2011 Newsletter of the UK Heteroptera Recording Schemes 2nd Series Circulation: An informal email newsletter circulated periodically to those interested in Heteroptera. Copyright: Text & drawings © 2011 Authors Photographs © 2011 Photographers Citation: Het News, 2nd Series, no.17/18, Spring/Autumn 2011 Editors: Our apologies for the belated publication of this year's issues, we hope that the record 30 pages in this combined issue are some compensation! Sheila Brooke: 18 Park Hill Toddington Dunstable Beds LU5 6AW — [email protected] Bernard Nau: 15 Park Hill Toddington Dunstable Beds LU5 6AW — [email protected] CONTENTS NOTICES: SOME LITERATURE ABSTRACTS ........................................... 16 Lookout for the Pondweed leafhopper ............................................................. 6 SPECIES NOTES. ................................................................18-20 Watch out for Oxycarenus lavaterae IN BRITAIN ...........................................15 Ranatra linearis, Corixa affinis, Notonecta glauca, Macrolophus spp., Contributions for next issue .................................................................................15 Conostethus venustus, Aphanus rolandri, Reduvius personatus, First incursion into Britain of Aloea australis ..................................................17 Elasmucha ferrugata Events for heteropterists .......................................................................................20 AROUND THE BRITISH ISLES............................................21-22 -

Oxycarenus Lavaterae, an Expansive Species New to Romania (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae)
ISSN 1211-8788 Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 94: 23–25, 2009 Oxycarenus lavaterae, an expansive species new to Romania (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) PETR KMENT Department of Entomology, National Museum, Kunratice 1, CZ-148 00 Praha 4, Czech Republic; e-mail: [email protected] KMENT P. 2009: Oxycarenus lavaterae, an expansive species new to Romania (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 94: 23–25. – Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) is recorded for the first time in the territory of Romania (Banat). This record confirms a further expansion of its range towards the north and east. Keywords. Heteroptera, Oxycarenidae, Oxycarenus lavaterae, Romania, Bulgaria, range expansion Introduction Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) is a peculiar member of the family Oxycarenidae (formerly part of Lygaeidae sensu lato) with a remarkable life cycle. For recognition of this species see the key by Péricart (1999). The species is trophically bound to plants of the family Malvaceae. In the western Mediterranean it develops on a range of Malvaceae sensu lato (incl. former Malvaceae sensu stricto, Tiliaceae, Bombacaceae, and Sterculiaceae; cf. BAYER et al. 1999), moving to the stems of various trees to overwinter. However, in Italy, central Europe, and the Balkan Peninsula this species occurs on lime trees (Tilia cordata, T. americana, T. euchlora, but avoiding T. platyphyllos) on which it breeds as well as hibernates. Oxycarenus lavaterae is remarkable for its gregarious way of life, which is especially apparent during the hibernation, when hundreds to many thousands of individuals aggregate on the stems of trees, often in cities and villages. They may sometimes enter human dwellings in great numbers, becoming a nuisance to people or harming cultivated plants (peaches, grapevines, ornamental Malvaceae). -

Checkliste Und Rote Liste Der Wanzen Der Steiermark (Insecta: Heteroptera)1
© Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; download unter www.zobodat.at Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark Bd. 144 S. 15–90 Graz 2015 Checkliste und Rote Liste der Wanzen der 1 Steiermark (Insecta: Heteroptera) Von Thomas Friess2 & Wolfgang Rabitsch3 Mit 26 Abbildungen und 13 Tabellen Angenommen am 11. September 2014 „... und ich weiß recht wohl, dass eine möglichst vollständige Fauna der Rhynchoten eines Landes das Zusammenwirken vieler Forscher durch eine lange Reihe von Jahren voraussetzt, eine solche für die Steiermark also jedenfalls der Zukunft vorbehalten bleiben muss.“ (Josef Eberstaller 1864:109, Beitrag zur Rhynchoten-Fauna Steiermarks) Abstract: Checklist and Red List of True bugs of the Austrian province Styria (Insecta: Heteroptera). – This paper provides a critical checklist and Red List of the Heteroptera in Styria. Fourteen species are recorded the first time for the province. The analyses of 23,420 data records from 2,684 sampling locations revealed a total of 691 Heteroptera species for the province of Styria, which is 76 % of the species known to occur in Austria. Within Austria, eight species are currently known only from Styria. 68 % of the species are considered of least concern including eleven not evaluated non-indigenous species. This means that 32 % are considered endangered to various degrees: 34 species (5 %) are considered “regionally extinct”, most of them are xerothermophilic species of open lands. 30 species (4 %) are considered “critically endangered”, 46 species (7 %) “endangered”, and 56 species (8 %) “vulnerable”. 64 species (9 %) were considered “data deficient” due to unclear taxonomy or lack of data. Percentages of red list species are particularly high in bogs and wetlands, wet and dry extensive grasslands, and running waters due to habitat loss, degradation and isolation. -

Checkliste Und Rote Liste Der Wanzen Kärntens (Insecta: Heteroptera)
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Carinthia II Jahr/Year: 2009 Band/Volume: 199_119 Autor(en)/Author(s): Frieß Thomas, Rabitsch Wolfgang Artikel/Article: Checkliste und Rote Liste der Wanzen Kärntens (Insecta: Heteroptera). 335-392 ©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Carinthia II ■ 199./119. Jahrgang ■ Seiten 335–392 ■ Klagenfurt 2009 335 Checkliste und Rote Liste der Wanzen Kärntens (Insecta: Heteroptera)* Von Thomas FRIESS & Wolfgang RABITSCH Zusammenfassung: Schlagworte: Alle für das Bundesland Kärnten sicher belegten Wanzenarten werden in einer Wanzen, Checkliste, Checkliste angeführt sowie Angaben zu deren Rote Liste-Status gemacht. 12 Arten Rote Liste, Natur- werden in dieser Arbeit erstmals für Kärnten gemeldet. Aktuell sind aus dem Bun- schutz, Kärnten desland 591 Wanzenarten bekannt. 18 Arten (3 %) gelten in Kärnten als ausgestorben bzw. verschollen, 15 Arten (2 %) sind vom Aussterben bedroht und weitere 27 Arten Key words: (5 %) sind stark gefährdet. 41 Arten (7 %) wurden als gefährdet und 95 Arten (16 %) True bugs, Check in die Vorwarnliste eingestuft. Inklusive der 77 Arten (13 %) der Kategorie Datenlage List, Red List, nature un genügend (DD) sind 46 % aller Arten (273 Arten) in ihrem Bestand in Kärnten ge- conservation, fährdet. Am stärksten betroffen sind Arten der Flussufer, der Moore, der Verlandungs- Carinthia zonen von Stillgewässern sowie insbesondere Arten der Magerwiesen und Halb- trockenrasen. Kärnten besitzt für 12 Wanzenarten österreichweite Verantwortung, für 5 dieser Arten besteht zu deren Schutz aktueller Handlungsbedarf. Neben einer Liste von Charakterarten, die im Zuge von naturschutzfachlichen Kartierungen besonde- re Berücksichtigung fi nden sollten, wird vorgeschlagen, 51 Wanzenarten (9 %) in die Kärntner Tierartenschutzverordnung aufzunehmen. -

Description of Phytomonas Oxycareni N. Sp. from the Salivary Glands Of
Protist, Vol. 168, 71–79, xx 2017 http://www.elsevier.de/protis Published online date 30 November 2016 ORIGINAL PAPER Description of Phytomonas oxycareni n. sp. from the Salivary Glands of Oxycarenus lavaterae a b,c d b,e,f a,1 Emily A. Seward , Jan Votypka´ , Petr Kment , Julius Lukesˇ , and Steven Kelly a Department of Plant Sciences, University of Oxford, South Parks Road, Oxford, OX1 3RB, UK b Institute of Parasitology, Biology Centre, Czech of the Academy of Sciences, 370 05 ˇ Ceské Budejovice,ˇ Czechia c Department of Parasitology, Faculty of Science, Charles University, 128 44 Prague, Czechia d Department of Entomology, National Museum, Cirkusova 1790, 193 00 Prague, Czechia e ˇ Faculty of Sciences, University of South Bohemia, 370 05 Ceské Budejovice,ˇ Czechia f Canadian Institute for Advanced Research, Toronto, ON M5G 1Z8, Canada Submitted May 20, 2016; Accepted November 12, 2016 Monitoring Editor: Dmitri Maslov Phytomonas spp. (phytomonads) are a diverse and globally distributed group of unicellular eukaryotes that parasitize a wide range of plants and are transmitted by insect hosts. Here we report the discov- ery and characterisation of a new species of Phytomonas, named Phytomonas oxycareni n. sp., which was obtained from the salivary glands of the invasive species of true bug Oxycarenus lavaterae (Het- eroptera). The new Phytomonas species exhibits a long slender promastigote morphology and can be found both within the lumen of the insect host’s salivary glands as well as within the cells of the sali- vary gland itself. Sampling multiple individuals from the same population post-winter hibernation on two consecutive years revealed that infection was persistent over time. -

Zootaxa, Alien True Bugs of Europe (Insecta: Hemiptera: Heteroptera)
TERM OF USE This pdf is provided by Magnolia Press for private/research use. Commercial sale or deposition in a public library or website site is prohibited. Zootaxa 1827: 1–44 (2008) ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ ZOOTAXA Copyright © 2008 · Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) Alien True Bugs of Europe (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) WOLFGANG RABITSCH Austrian Federal Environment Agency, Spittelauer Lände 5, 1090 Wien, Austria.E-Mail: [email protected] Table of contents Abstract .............................................................................................................................................................................. 1 Introduction ........................................................................................................................................................................2 Material and methods......................................................................................................................................................... 2 Results and discussion ........................................................................................................................................................3 1) Comments on the alien Heteroptera species of Europe .................................................................................................3 Category 1a—Species alien to Europe.............................................................................................................................. -

Applied Ecology and Environmental Research 16(2):1305-1311
Arslangündoğdu et al.: First record of Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera, Lygaeidae) in Turkey - 1305 - FIRST RECORD OF OXYCARENUS LAVATERAE (FABRICIUS, 1787) (HETEROPTERA, LYGAEIDAE) IN TURKEY ARSLANGÜNDOĞDU, Z.* – HIZAL, E. – ACER, S. Department of Forest Entomology and Protection, Faculty of Forestry, University of Istanbul Istanbul, Turkey *Corresponding author e-mail: [email protected] (Received 7th Nov 2017; accepted 20th Feb 2018) Abstract. In autumn of 2017, Oxycarenus lavaterae (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae) was observed on linden trees (Tilia tomentosa) in a park in Sariyer, Istanbul, northwestern Turkey. This is the first record of this species from Turkey. Keywords: Hemiptera, Oxycarenidae, Tilia tomentosa, invasive, Istanbul Introduction Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Lygaeidea: Oxycarenidae) is widely distributed in Western Mediterranean region of Europe (Péricart, 1998, 2001). It occurs from northwest Africa to Portugal, southern Spain, southern France, southern Germany, Italy, Slovenia and Croatia (Velimirovic et al., 1992; Kalushkov, 2000; Rabitsch and Adlbauer, 2001; Wermelinger et al., 2005). During the last 20 years, O. lavaterae continued to spread eastwards into the Balkan Peninsula and northwards to the central Europe (Figure 1) (Velimirovic et al., 1992; Kondorosy, 1995; Bianchi and Stehlik, 1999; Protic and Stojanovic, 2001; Rabitsch and Adlbauer, 2001; Deckert, 2004; Wermelinger et al., 2005; Kment, 2009; Kment et al., 2006; Rabitsch, 2008, 2010; Hebda and Olbrycht, 2016). O. lavaterae spread to the east of Mediterranean area and can be found in Saudi-Arabia and Yemen as well as in tropical Africa to South Africa (Rabitsch and Adlbauer, 2001). Mass increase of O. lavaterae was previously observed and reported from and near Italy. -

Oxycarenus Lavaterae
KARTA WYKRYCIA ORGANIZMU SZKODLIWEGO Wykryty Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) organizm: Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Class: Insecta Order: Hemiptera Suborder: Heteroptera Systematyka: Infraorder: Pentatomomorpha Superfamily: Lygaeoidea Family: Lygaeidae Subfamily: Oxycareninae Genus: Oxycarenus Species: O. lavaterae Oxycarenus lavaterae to pluskwiak z rzędu pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera). Wielkość samic waha się od 5,5 mm do 6 mm, samce są mniejsze od samic, ich wielkość wynosi od 4,7 mm do 5,1 mm. Cechą charakterystyczną owadów dorosłych są czerwone nasady półpokryw, jednolicie czarne przedplecze, czarna głowa i czułki, a także bezbarwna i przeźroczysta błonka półpokryw. Larwy ostatnich stadiów mają czerwonawy grzbiet i niepełne skrzydła. Opis organizmu: https://de.wikipedia.org/wiki/Lindenwanze#/media/File:2016_09_28_Oxyc arenus_lavaterae.jpg Oxycarenus lavaterae pochodzi z basenu Morza Śródziemnego. Przez ostatnie 20 lat zasiedlał nowe obszary charakteryzujące się chłodniejszym klimatem. Gatunek ten zimuje pod postacią dużych agregacji złożonych z tysięcy osobników dorosłych. Kolonie te usytuowane są w zagłębieniach kory drzew, głównie lip ( Tilia americana, T. cordata, T. parviflora, T. platyphyllos ), a rzadziej na innych gatunkach ( Populus, Platanus, Aesculus hippocastanum). O. lavaterae jest wrażliwy na niską temperaturę, spadek temperatury poniżej 15°C powoduje śmierć 99% osobników zimujących w kolonii. W ciągu roku występują najczęściej dwa pokolenia. Na wiosnę masowy wylot osobników dorosłych związany jest z rozpoczęciem okresu kwitnienia lip. Z końcem wiosny osobniki dorosłe opuszczają drzewa i przelatują na rośliny zielne i krzewy z rodziny Malvaceae a w szczególności na ślaz dziki (Malva sylvestris). Samica składa od 22 do 589 jaj. Biologia: O. lavaterae żywi się i rozwija na roślinach należących do rodziny Malvaceae, takich jak Althea, Hibiscus, Lavatera i Malva sylvestris. -

A Revision of the African Species of Oxycarenus (Hemiptera: Lygaeidae)
79 A revision of the African species of Oxycarenus (Hemiptera : Lygaeidae) By 0. SAMY Imperial College, Prince Consort Road, London, S. W.7* CONTENTS PAGE I. Introduction . ... ... .79 11. Morphology of the male genitalia of Oxycarenus .....80 111. Geographical distribution and host plants .... 87 IV. Taxonomy. .. ..... .. .91 Genus Oxycarenus . ...... 91 Subgenus Oxycarenus s. str. .. .. 93 Subgenus Pseudoxycarenus subgen. n. .... 147 Subgenus Euoxycarenus subgen. n. .......153 V. Discussion . .. .... .. .. 156 References ..... .... 163 With 45 Text-figures SYNOPSIS A taxonomic revision of the African species of Oxycarenus Fieber is given. Keys are provided to the three subgenera and 36 species now recorded from Africa, of which two subgenera are here erected and 17 species described as new to science. Some new morphological characters of diagnostic value are described, and emphasis is placed on structures in the male genitalia. Host plants and distribution data are given for all the species occurring in Africa. I. INTRODUCTION THEspecies of the genus Oxycarenus Fieber, 1837 (Lygaeidae, Oxycareninae) are of some importance as pests of cotton and other malvaceous crops. Slater (1964a), in his catalogue of the Lygaeidae of the world, listed 39 species, 21 of which were recorded from Africa. In the present work the known African species are redescribed and 17 new species are added to the African fauna. Certain taxonomic variations in the male genitalia have been utilised to augment specific distinctions previously based on coloration only. Colour was however found to be of great importance in separating the species. External features that can be defined quite easily have been mainly used, and recourse to fine structures, requiring dissection, has been confined to separations when more obvious characters are absent.