(KFMV) Und Seine Ehemaligen Jüdischen Mitglieder / Mitglieder
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A History of German-Scandinavian Relations
A History of German – Scandinavian Relations A History of German-Scandinavian Relations By Raimund Wolfert A History of German – Scandinavian Relations Raimund Wolfert 2 A History of German – Scandinavian Relations Table of contents 1. The Rise and Fall of the Hanseatic League.............................................................5 2. The Thirty Years’ War............................................................................................11 3. Prussia en route to becoming a Great Power........................................................15 4. After the Napoleonic Wars.....................................................................................18 5. The German Empire..............................................................................................23 6. The Interwar Period...............................................................................................29 7. The Aftermath of War............................................................................................33 First version 12/2006 2 A History of German – Scandinavian Relations This essay contemplates the history of German-Scandinavian relations from the Hanseatic period through to the present day, focussing upon the Berlin- Brandenburg region and the northeastern part of Germany that lies to the south of the Baltic Sea. A geographic area whose topography has been shaped by the great Scandinavian glacier of the Vistula ice age from 20000 BC to 13 000 BC will thus be reflected upon. According to the linguistic usage of the term -

The Jewish Contribution to the European Integration Project
The Jewish Contribution to the European Integration Project Centre for the Study of European Politics and Society Ben-Gurion University of the Negev May 7 2013 CONTENTS Welcoming Remarks………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1 Dr. Sharon Pardo, Director Centre for the Study of European Politics and Society, Jean Monnet National Centre of Excellence at Ben-Gurion University of the Negev Walther Rathenau, Foreign Minister of Germany during the Weimar Republic and the Promotion of European Integration…………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 Dr. Hubertus von Morr, Ambassador (ret), Lecturer in International Law and Political Science, Bonn University Fritz Bauer's Contribution to the Re-establishment of the Rule of Law, a Democratic State, and the Promotion of European Integration …………………………………………………………………………………………………………………8 Mr. Franco Burgio, Programme Coordinator European Commission, Brussels Rising from the Ashes: the Shoah and the European Integration Project…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13 Mr. Michael Mertes, Director Konrad-Adenauer-Stiftung, Israel Contributions of 'Sefarad' to Europe………………………………………………………………………………………………………………………21 Ambassador Alvaro Albacete, Envoy of the Spanish Government for Relations with the Jewish Community and Jewish Organisations The Cultural Dimension of Jewish European Identity………………………………………………………………………………….…26 Dr. Dov Maimon, Jewish People Policy Institute, Israel Anti-Semitism from a European Union Institutional Perspective………………………………………………………………34 -

Das Reich Der Seele Walther Rathenau’S Cultural Pessimism and Prussian Nationalism ~ Dieuwe Jan Beersma
Das Reich der Seele Walther Rathenau’s Cultural Pessimism and Prussian Nationalism ~ Dieuwe Jan Beersma 16 juli 2020 Master Geschiedenis – Duitslandstudies, 11053259 First supervisor: dhr. dr. A.K. (Ansgar) Mohnkern Second supervisor: dhr. dr. H.J. (Hanco) Jürgens Abstract Every year the Rathenau Stiftung awards the Walther Rathenau-Preis to international politicians to spread Rathenau’s ideas of ‘democratic values, international understanding and tolerance’. This incorrect perception of Rathenau as a democrat and a liberal is likely to have originated from the historiography. Many historians have described Rathenau as ‘contradictory’, claiming that there was a clear and problematic distinction between Rathenau’s intellectual theories and ideas and his political and business career. Upon closer inspection, however, this interpretation of Rathenau’s persona seems to be fundamentally incorrect. This thesis reassesses Walther Rathenau’s legacy profoundly by defending the central argument: Walther Rathenau’s life and motivations can first and foremost be explained by his cultural pessimism and Prussian nationalism. The first part of the thesis discusses Rathenau’s intellectual ideas through an in-depth analysis of his intellectual work and the historiography on his work. Motivated by racial theory, Rathenau dreamed of a technocratic utopian German empire led by a carefully selected Prussian elite. He did not believe in the ‘power of a common Europe’, but in the power of a common German Europe. The second part of the thesis explicates how Rathenau’s career is not contradictory to, but actually very consistent with, his cultural pessimism and Prussian nationalism. Firstly, Rathenau saw the First World War as a chance to transform the economy and to make his Volksstaat a reality. -

Yearbook 2011/12
A BOOK ABOUT THE OSKAR VON MILLER FORUM Yearbook 2011/12 Longitude 11°34‘30,71“ E in L latitude of es U Forum Miller von Oskar the about information eful MUNICH s Germany 75° EVENTS 2011/12 60° 113 LATITUDE 48°8‘45,32“ N 45° GUESTS 2011/12 30° 83 15° 0° H OME COUNTRIES TIME Zone 15° OF GUESTS MET 30° L ines of longitude 15° 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120° 22 Time zone - 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 HE MADE HISTORY, AND NOT ONLY OBSERVED AND COLLECTED IT. THEODOR HEUSS 04 ABOUT OSKAR VON MILLER PTROJEC SPONSORS T he Oskar von Miller Forum is sponsored by the Bavarian construction industry. 03 PROJECT SPONSORS R SESIDENT <?> T he Oskar von Miller Forum offers 54 students and 7 guest scientists excellently TEAM equipped living space in a <?> central location. 02 EENSV T RESIDENTS’ T he Oskar von Miller Forum IMPRESSIONS offers forward-looking <?> academic events in the field of construction. AN INTERNatIONAL NE TWORK RANGE OF EVENTS <?> 01 THE FORUM <?> A meeting point and inter- ALUMNI national guesthouse for CALENDAR OF <?> students, pupils from higher EVENTS level trade schools and <?> scientists in construction. GRADUATES <?> OUtstaNDING WELCOME ADDRESS EVENTS 4 <?> ARCHITECTURE 7 Oskar von Miller Forum The Oskar von Miller Forum – in the heart of Munich, located close to the Technische Universität München – Oskar von Miller is an international guest house and meeting point. FORUM As an independent educational initiative of the Bavarian construction industry, the Oskar von Miller Forum gives new stimulus to the training of civil engineers, architects and students from higher-level trade schools in the construction industry and supports them in their pursuit of an above-average professional qualification, in preparing them for an international career and in developing social skills. -

Zbwleibniz-Informationszentrum
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Kocka, Jürgen Book Part White-collar employees and industrial society in Imperial Germany Provided in Cooperation with: WZB Berlin Social Science Center Suggested Citation: Kocka, Jürgen (1985) : White-collar employees and industrial society in Imperial Germany, In: Georg Iggers (Ed.): The social history of politics: critical perspectives in West German historical writing since 1945, ISBN 0-907582-78-8, Berg, Dover, NH ; Heidelberg, pp. 113-136 This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/112294 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. www.econstor.eu WZB-Open Access Digitalisate WZB-Open Access digital copies Das nachfolgende Dokument wurde zum Zweck der kostenfreien Onlinebereitstellung digitalisiert am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH (WZB). -

Soldiers, Rabbis, and the Ostjuden Under German Occupation: 1915-1918
University of Tennessee, Knoxville TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange Doctoral Dissertations Graduate School 8-2010 Shattered Communities: Soldiers, Rabbis, and the Ostjuden under German Occupation: 1915-1918 Tracey Hayes Norrell [email protected] Follow this and additional works at: https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss Part of the Diplomatic History Commons, European History Commons, History of Religion Commons, Military History Commons, and the Political History Commons Recommended Citation Norrell, Tracey Hayes, "Shattered Communities: Soldiers, Rabbis, and the Ostjuden under German Occupation: 1915-1918. " PhD diss., University of Tennessee, 2010. https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/834 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Doctoral Dissertations by an authorized administrator of TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. For more information, please contact [email protected]. To the Graduate Council: I am submitting herewith a dissertation written by Tracey Hayes Norrell entitled "Shattered Communities: Soldiers, Rabbis, and the Ostjuden under German Occupation: 1915-1918." I have examined the final electronic copy of this dissertation for form and content and recommend that it be accepted in partial fulfillment of the equirr ements for the degree of Doctor of Philosophy, with a major in History. Vejas G. Liulevicius, Major Professor We have read this dissertation and recommend -

Econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Kocka, Jürgen Article Family and bureaucracy in German industrial management, 1850-1914: Siemens in comparative perspective Business history review Provided in Cooperation with: WZB Berlin Social Science Center Suggested Citation: Kocka, Jürgen (1971) : Family and bureaucracy in German industrial management, 1850-1914: Siemens in comparative perspective, Business history review, ISSN 0007-6805, Cambridge University Press, Cambridge, Vol. 45, Iss. 2, pp. 133-156 This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/122745 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. www.econstor.eu WZB Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung WZB-Open Access Digitalisate WZB-Open Access digital copies Das nachfolgende Dokument wurde zum Zweck der kostenfreien Onlinebereitstellung digitalisiert am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH (WZB). -

Wily Welfare Capitalist: Werner Von Siemens and the Pension Plan
Cliometrica DOI 10.1007/s11698-009-0048-x ORIGINAL PAPER Wily welfare capitalist: Werner von Siemens and the pension plan Jakub Kastl • Lyndon Moore Received: 27 January 2009 / Accepted: 30 October 2009 Ó Springer-Verlag 2009 Abstract The German firm of Siemens and Halske introduced many enterprising features of what later came to be known as welfare capitalism in the mid-nineteenth century. Profit sharing, annual bonuses, a pension fund, a reduction in work hours, and an annual party were all means to ensure a productive, trouble-free workforce. We investigate the reasons why Siemens and Halske introduced this internal welfare system. We focus on the by-far most expensive part of the welfare system: the pension fund introduced in 1872, more than a decade before the nationwide social security system was implemented in Germany. We find that the adoption of the internal welfare system increased labor productivity, and in addition discouraged workers from striking. We estimate that the company’s gains due to strike pre- vention and higher productivity were at least as high as the cost of the pension fund. This suggests that (1) the introduction of a pension fund is not inconsistent with simple profit maximizing behavior on the firm’s side and (2) increased labor unionization induced firms to introduce subjective components of workers’ remu- neration packages. Keywords Welfare capitalism Á Siemens Á Productivity JEL Classification J50 Á L21 Á N33 Á N83 J. Kastl Stanford University, Stanford, CA, USA L. Moore (&) Universite´ de Montre´al, Montreal, QC, Canada e-mail: [email protected] 123 J. -
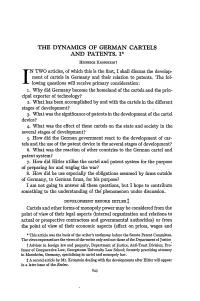
The Dynamics of German Cartels and Patents. I*
THE DYNAMICS OF GERMAN CARTELS AND PATENTS. I* HmmE cH KR NsEnmt N TWO articles, of which this is the first, I shall discuss the develop- ment of cartels in Germany and their relation to patents. The fol- lowing questions will receive primary consideration: i. Why did Germany become the homeland of the cartels and the prin- cipal exporter of technology? 2. What has been accomplished by and with the cartels in the different stages of development? 3. What was the significance of patents in the development of the cartel device? 4. What was the effect of these cartels on the state and society in the several stages of development? 5. How did the German government react to the development of car- tels and the use of the patent device in the several stages of development? 6. What was the reaction of other countries to the German cartel and patent system? 7. How did Hitler utilize the cartel and patent system for the purpose of preparing for and waging the war? 8. How did he use especially the obligations assumed by firms outside of Germany, to German firms, for his purpose? I am not going to answer all these questions, but I hope to contribute something to the understanding of the phenomenon under discussion. DEVELOPMENT BEFOR~E 11ITLET Cartels and other forms of monopoly power may be considered from the point of view of their legal aspects (internal organization and relations to actual or prospective contractees and governmental authorities) or from the point of view of their economic aspects (effect on prices, wages and * This article was the basis of the writer's testimony before the Senate Patent Committee. -

The German-Jewish Economic Elite (1900 – 1933)
The German-Jewish Economic Elite (1900 – 1933) 1. The spirit of capitalism: Sombart versus Weber 2. Religious ideas 3. Explanations and hypotheses 4. Who is Jewish? 5. The network of the corporate elite 6. Jewish origin: results of logistic regressions 7. Did a Jewish network exist? 8. Homophily 9. Discussion and conclusion Appendix References Paul Windolf [email protected] Department of Sociology Phone 0651-2012703 University Trier 54286 Trier/Germany 1 Summary In the early twentieth century, a dense corporate network was created among the large German corporations ("Germany Inc."). About 16% of the members of this corporate network were of Jewish background. At the center of the network (big linkers) about 25% were Jewish. The percentage of Jews in the general population was less than 1% in 1914. What comparative advantages did the Jewish minority enjoy that enabled them to succeed in the competition for leading positions in the German economy? Three hypotheses are tested: (1) The Jewish economic elite had a better education compared to the non-Jewish members of the network (human capital). (2) Jewish members had a central position in the corporate network, because many of them were engaged in finance and banking. (3) Jewish members created a network of their own that was separate from the overarching corporate network (social capital). The density of this Jewish network was higher than that of the non-Jewish economic elite (embeddedness). Our data do not support any of these hypotheses. The observed correlation between Jewish background and economic success cannot be explained by a higher level of education, a higher level of social capital, or a higher proportion of Jewish managers engaged in (private) banking. -

VDI Arbeitskreis Technikgeschichte Des Bezirksvereins Hannover Gekürzte Fassung Des Vortrags Am 12
VDI Arbeitskreis Technikgeschichte des Bezirksvereins Hannover Gekürzte Fassung des Vortrags am 12. Juni 2017 Emil Rathenau und die Gründung der AEG Jörg Bickmann, Hannover 1. Emil Rathenau (1838-1915) Emil Rathenau wurde als Sohn eines jüdischen Kaufmanns in Berlin geboren. Zum Familienkreis gehörten Bankiers und auch der Maler Max Liebermann (1847-1935). Nach der allgemeinen Schulbildung – mit leidlichem Ergebnis – absolvierte Emil Rathenau eine praktische Ausbildung zum Maschinenbauer in der großväterlichen Maschinenfabrik in Sprottau (Niederschle- sien). Nach dem Studium des Maschinenbaus am Polytechni- kum in Hannover schloss er 1862 seine Ausbildung mit einem Diplom an der ETH in Zürich ab. Nach einer sechsmonatigen Tä- tigkeit beim führenden europäischen Lokomotiven-Hersteller Borsig in Berlin erweiterte er seine Maschinenbau-Kenntnisse in England. Gemeinsam mit seinem Schulfreund Julius Valentin (1840- nach 1918) kaufte Emil Rathenau mit Hilfe der Mitgift seiner Frau Mathilde 1865 die Webersche Maschinenfabrik. Rathenau lernte 1881 bei der ersten Internationalen Elektrici- tiätsausstellung in Paris T. A. Edison und seine Glühlampe ken- nen. Nach langwierigen Verhandlungen erwarb Rathenau 1882 das Patent für Deutschland und gründete 1883 die Deutsche Edison Gesellschaft (DEG), die 1887 nach Loslösung von der amerikanischen Edison-Gesellschaft in Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft umbenannt wurde. Emil Rathenau übernahm die amerikanische Produktionsmethodik (Fließbandproduk- tion/Massenfertigung). Die DEG fertigte auch Dynamomaschinen, Motoren und Kabel gemein- sam mit Siemens & Halske. Mit Siemens & Halske wurde 1903 die Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie gegründet. Im Gegensatz zu Werner von Siemens (1816-1892), der größtenteils mit eigenen Erfindungen auf neuen Märkten operierte, kauft Emil Rathenau Patente und vermarktete diese. Emil Rathenau war ein hochbegabter Organisator, der die Fähigkeit besaß, bedeutsame, große und zusammenhängende Strukturen zu erkennen und diese zu leiten. -

Deciphering Economic Futures: Electricity, Calculation, and the Power Economy, 1880-1930
Deciphering Economic Futures: Electricity, Calculation, and the Power Economy, 1880-1930 Daniela Russ In: Centaurus (forthcoming) Introduction1 A few years after Emil Rathenau’s death, the economic journalist Felix Pinner wrote a laudatory biography placing the engineer squarely into his century. In Emil Rathenau und das elektrische Zeitalter (1918), Pinner portrayed Rathenau as the true inventor of the concept of the central station, the large-scale, centralised generation of electricity for a variety of urban consumers. Echoing a common prejudice against early American electro-technical engineering, Pinner noted that Edison’s Pearl Street Station missed the “systematic design”, it was a “purely empirical” power station, a result of experimentation and little calculation. In The Electric Review, Edison had played down the role of mathematicians in developing his electric system and Pinner contrasted this self-portrait with the calculating mind of the engineer-entrepreneur: Rathenau’s creativity and imagination ventured beyond the limits of the present, too, “but he let mathematicians search the paths into the future before entering them.” In Pinner’s almost Hegelian account, Edison built the first central station, but Rathenau grasped and realised the concept of the central station – the concept in which the electric age comes to itself.2 Such teleological reading of its history was widespread in the electro-technical industry at the time, as was the obsession with great ‘captains of industry’ such as Rathenau (the biography appeared