Rassenhygienische Forschungsstelle
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
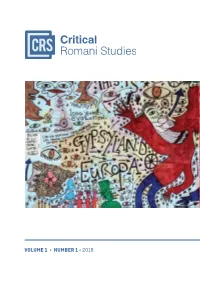
VOLUME 1 • NUMBER 1 • 2018 Aims and Scope
VOLUME 1 • NUMBER 1 • 2018 Aims and Scope Critical Romani Studies is an international, interdisciplinary, peer-reviewed journal, providing a forum for activist-scholars to critically examine racial oppressions, different forms of exclusion, inequalities, and human rights abuses Editors of Roma. Without compromising academic standards of evidence collection and analysis, the Journal seeks to create a platform to critically engage with Maria Bogdan academic knowledge production, and generate critical academic and policy Central European University knowledge targeting – amongst others – scholars, activists, and policy-makers. Jekatyerina Dunajeva Pázmány Péter Catholic University Scholarly expertise is a tool, rather than the end, for critical analysis of social phenomena affecting Roma, contributing to the fight for social justice. The Journal Tímea Junghaus especially welcomes the cross-fertilization of Romani studies with the fields of European Roma Institute for Arts and Culture critical race studies, gender and sexuality studies, critical policy studies, diaspora studies, colonial studies, postcolonial studies, and studies of decolonization. Angéla Kóczé Central European University The Journal actively solicits papers from critically-minded young Romani Iulius Rostas (editor-in-chief) scholars who have historically experienced significant barriers in engaging Central European University with academic knowledge production. The Journal considers only previously unpublished manuscripts which present original, high-quality research. The Márton Rövid (managing editor) Journal is committed to the principle of open access, so articles are available free Central European University of charge. All published articles undergo rigorous peer review, based on initial Marek Szilvasi (review editor) editorial screening and refereeing by at least two anonymous scholars. The Journal Open Society Foundations provides a modest but fair remuneration for authors, editors, and reviewers. -

Porajmos Edito
ROMA MEMORY PORAJMOS EDITO I DEDICATE THIS RESEARCH ALBUM TO JE DÉDIE CET OUVRAGE À TOUTES CELLES ET CEUX ALL THOSE WHO, TODAY, LIE BENEATH QUI, AUJOURD’HUI, GISENT DANS DES FOSSES GARDENS, BENEATH FLOWERED FIELDS, COMMUNES SOUS DES JARDINS OU DES CHAMPS ENVELOPED AND FORGOTTEN IN THEIR FLEURIS SANS AUCUN MÉMORIAL. MASS GRAVES - WITHOUT A MEMORIAL. A TOUS LES PHOTOGRAPHES ET LES CAMÉRAMANS TO ALL THE TALENTED PHOTOGRAPHERS TALENTUEUX ET, SURTOUT, AUX ÉQUIPES DE AND CAMERAMEN WHO GAVE A JEUNES ROMS QUI, SÉJOUR APRÈS SÉJOUR, ONT VISUAL TRACE TO OUR RESEARCH. BUT RECHERCHÉ LES VISAGES ÂGÉS BIEN SOUVENT ESPECIALLY TO THE TEAMS OF YOUNG CACHÉS À L’OMBRE D’UNE PIÈCE BIEN TROP ROMA, WHO SO CAREFULLY AND SIMPLE ET QUI PORTAIENT EN EUX, DEPUIS DILIGENTLY, TRIP AFTER TRIP, SOUGHT 70 ANS, LA MÉMOIRE ET LES BLESSURES DES OUT THE ELDERLY FACES HIDDEN IN THE ACTES GÉNOCIDAIRES DES NAZIS ET DE LEURS SHADOWS OF HUMBLE HOUSES, WHO COLLABORATEURS. ARE THE LAST TO CARRY THE MEMORY AND THE WOUNDS OF THESE GENOCIDAL TOUT CE DÉVOUEMENT FUT NÉCESSAIRE POUR ACTS COMMITTED BY THE NAZIS AND RENDRE UN PEU DE DIGNITÉ À CELLES ET CEUX, THEIR COLLABORATORS 70 YEARS AGO. HOMMES ET FEMMES, QUI GISENT DANS NOS CHAMPS. ALL OF THIS DEDICATION IS NECESSARY TO RESTORE DIGNITY TO THOSE MEN, CET OUVRAGE CONSTITUE, POUR MOI, UN APPEL WOMEN, AND CHILDREN WHO LIE IN À L’EUROPE QUI NE PEUT SE CONSTRUIRE SUR OUR FIELDS, WAITING FOR SOMEONE AUCUNE FOSSE COMMUNE, Y COMPRIS CELLES TO NOTICE THEM, TO REMEMBER THEM. DES ROMS. THIS RESEARCH ALBUM CONSTITUTES, PÈRE PATRICK DESBOIS FOR ME, A CALL TO EUROPE. -

Romani Identity and the Holocaust in Autobiographical Writing by German and Austrian Romanies
This thesis has been submitted in fulfilment of the requirements for a postgraduate degree (e.g. PhD, MPhil, DClinPsychol) at the University of Edinburgh. Please note the following terms and conditions of use: • This work is protected by copyright and other intellectual property rights, which are retained by the thesis author, unless otherwise stated. • A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. • This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author. • The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author. • When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given. Journeys into Memory: Romani Identity and the Holocaust in Autobiographical Writing by German and Austrian Romanies Marianne C. Zwicker Doctor of Philosophy University of Edinburgh 2009 Abstract This PhD thesis examines the ‘working through’ of traumatic memories of the Holocaust and representations of Romani cultural identity in autobiographical writing by Romanies in Ger- many and Austria. In writing their memories in German, these Romani writers ended the ‘muteness’ previously surrounding their own experiences of persecution in the Third Reich and demanded an end to the official silence regarding the Romani Holocaust in their home countries. The thesis aims to explore how the writing of these narratives works to create a space for Romani memories within German language written tradition and to assert a more positive Romani identity and space for this identity in their homelands. -

Roma and Sinti Under-Studied Victims of Nazism
UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM CENTER FOR ADVANCED HOLOCAUST STUDIES Roma and Sinti Under-Studied Victims of Nazism Symposium Proceedings W A S H I N G T O N , D. C. Roma and Sinti Under-Studied Victims of Nazism Symposium Proceedings CENTER FOR ADVANCED HOLOCAUST STUDIES UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM 2002 The assertions, opinions, and conclusions in this occasional paper are those of the authors. They do not necessarily reflect those of the United States Holocaust Memorial Council or of the United States Holocaust Memorial Museum. Third printing, July 2004 Copyright © 2002 by Ian Hancock, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2002 by Michael Zimmermann, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2002 by Guenter Lewy, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2002 by Mark Biondich, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2002 by Denis Peschanski, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2002 by Viorel Achim, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2002 by David M. Crowe, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum Contents Foreword .....................................................................................................................................i Paul A. Shapiro and Robert M. Ehrenreich Romani Americans (“Gypsies”).......................................................................................................1 Ian -

Nazi Persecution of the Gypsies in Germany and Austria, 1933–1942
Intent, Failure of Plans, and Escalation: Nazi Persecution of the Gypsies1 in Germany and Austria, 1933–1942 Michael Zimmermann Traditional Gypsy Policy During the nineteenth and early twentieth centuries in Germany, the police exercised monopoly control of Gypsy policy. Churches’, schools’, and welfare organizations’ isolated attempts to assimilate the Gypsies by means of a combination of assistance and discipline were insignificant. The police declared the Gypsies—a group of perhaps 20,000 persons, or not quite 0.03 percent of the German population in 1910—to be a “nuisance” that was to be combated. Police practice was influenced by a sociographic definition of “Gypsies and persons moving about in the manner of Gypsies.” Those who were or whom the police suspected of being on the road in a family group for any significant part of the year were included among those so designated. Expulsion was ordained for the small group of foreign Gypsies; for the German Gypsies discriminatory treatment was more differentiated. The most important was the demand for numerous personal and travel papers, as well as harassment by requiring a “traveling trades permit,” which was essential for travelers to be allowed to work. This “combat against the Gypsies,” the discriminatory character of which is obvious, nonetheless remained without apparent effect. The various local authorities aimed only to keep the Gypsies out of their own areas and therefore came into conflict with each other, rather than collaborating on a single plan to implement the “fight against the Gypsy nuisance.”2 Escalation of Persecution Discrimination against and oppression of the Gypsies in the first years of Nazi rule were not simply a continuation of traditional Gypsy policy.3 Laws and regulations were in many instances made more severe. -

The Romani Holocaust Ian Hancock
| 1 Zagreb May 2013 O Porrajmos: The Romani Holocaust Ian Hancock To understand why Hitler sought to eradicate the Romanies, a people who presented no problem numerically, politically, militarily or economically, one must interpret the underlying rationale of the holocaust as being his attempt to create a superior Germanic population, a Master Race, by eliminating what he viewed as genetic pollutants in the Nordic gene pool, and why he believed that Romanies constituted such contamination. The holocaust itself was the implementation of his Final Solution, the genocidal program intended to accomplish this vision of ethnic cleansing. Just two “racial” populations defined by what they were born were thus targeted: the Jews and the Romanies1. The very inventor of the term, Raphael Lemkin, referred to the genocide of the “gypsies” even before the Second World War was over2. It is also essential to place the holocaust of the Romanies3 in its historical context. For perhaps most Romanies today it lacks the special place it holds for Jews, being seen as just one more hate-motivated crisis— albeit an overwhelmingly terrible one—in their overall European experience. Others refuse to speak about it because of its association with death and misfortune, or to testify or accept reparation for the same reason. The first German anti-Romani law was issued in 1416 when they were accused of being foreign spies, carriers of the plague, and traitors to Christendom; In 1500 Maximilian I ordered all to be out of Germany by Easter; Ferdinand I enforced expulsion -

Julia Von Dem Knesebeck National Socialism in Post-War Germany
hirty years passed before it was accepted, in West Germany and elsewhere, that the Roma (Germany’s Gypsies) THE ROMA STRUGGLE FOR COMPENSATION STRUGGLE THE ROMA Thad been Holocaust victims. And, similarly, it took thirty years for the West German state to admit that the sterilisation of Roma had been part of the ‘Final Solution’. Drawing on a substantial body of previously unseen sources, this book examines the history of the struggle of Roma for recognition as racially persecuted victims of Julia von dem Knesebeck National Socialism in post-war Germany. Since modern academics belatedly began to take an interest in them, the Roma have been described as ‘forgotten victims’. This book looks at the period in West Germany between the end of the War and the beginning of the Roma civil rights movement in the early 1980s, during which the Roma were largely passed over when it came to compensation. The complex reasons for this are at the heart of this Germany in Post-War book. In looking at how the West German compensation process for victims of racial, religious and political persecution affected Roma, Dr von dem Knesebeck shows not only how the Roma were treated but also how they themselves perceived the process. The case of the Roma reveals how the West German administrative and legal apparatus defined and classified National Socialist injustice, and in particular where pejorative attitudes were allowed to continue unchallenged. The main obstacle for Roma seeking compensation was the question, unresolved for many years, of whether National Socialist policies against Roma had been racially motivated as opposed to having been mere policing measures. -

Wandering Memories
WANDERING MEMORIES MARGINALIZING AND REMEMBERING THE PORRAJMOS Research Master Thesis Comparative Literary Studies Talitha Hunnik August 2015 Utrecht University Thesis Supervisor: Dr. Susanne Knittel Second Reader: Prof. Dr. Ann Rigney CONTENTS Acknowledgements ............................................................................................................................. 3 A Note on Terminology ...................................................................................................................... 4 A Note on Translations ...................................................................................................................... 4 Introduction ...................................................................................................................................... 5 Antiziganism and the Porrajmos ................................................................................................. 8 Wandering Memories ................................................................................................................. 12 Marginalized Memories: Forgetting the Porrajmos ......................................................... 19 Cultural Memory Studies: Concepts and Gaps ........................................................................ 24 Walls of Secrecy ........................................................................................................................... 34 Remembering the Holocaust and Marginalizing the Porrajmos ........................................ -

Tell Ye Your Children
Tell Ye Your Children… Your Ye Tell Tell Ye Your Children… STÉPHANE BRUCHFELD AND PAUL A. LEVINE A book about the Holocaust in Europe 1933-1945 – with new material about Sweden and the Holocaust THE LIVING HISTORY FORUM In 1997, the former Swedish Prime Minister Göran Persson initiated a comprehensive information campaign about the Holocaust entitled “Living History”. The aim was to provide facts and information and to encourage a discussion about compassion, democracy and the equal worth of all people. The book “Tell Ye Your Children…” came about as a part of this project. The book was initially intended primarily for an adult audience. In 1999, the Swedish Government appointed a committee to investigate the possibilities of turning “Living History” into a perma- nent project. In 2001, the parliament decided to set up a new natio- nal authority, the Living History Forum, which was formally establis- hed in 2003. The Living History Forum is commissioned to work with issues related to tolerance, democracy and human rights, using the Holocaust and other crimes against humanity as its starting point. This major challenge is our specific mission. The past and the pre- sent are continuously present in everything we do. Through our continuous contacts with teachers and other experts within education, we develop methods and tools for reaching our key target group: young people. Tell Ye Your Children… A book about the Holocaust in Europe 1933–1945 – THIRD REVISED AND EXPANDED ENGLISH EDITION – STÉPHANE BRUCHFELD AND PAUL A. LEVINE Tell Ye Your -

University of Cape Town
ASHES SCATTERED IN THE WIND The Romanies as Marginalised Victims of Racial Persecution, Genocide and the Holocaust Robynne Botha BTHROB008 A minor dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Philosophy in Justice and Transformation Faculty of the Humanities University of Cape Town 2019 University of Cape Town COMPULSORY DECLARATION This work has not been previously submitted in whole, or in part, for the award of any degree. It is my own work. Each significant contribution to, and quotation in, this dissertation from the work, or works, of other people has been attributed, and has been cited and referenced. Signature: Date: 16/09/2019 The copyright of this thesis vests in the author. No quotation from it or information derived from it is to be published without full acknowledgementTown of the source. The thesis is to be used for private study or non- commercial research purposes only. Cape Published by the University ofof Cape Town (UCT) in terms of the non-exclusive license granted to UCT by the author. University Abstract The experiences of the Romanies on the European continent have been marked by centuries of prejudice, abuse, slavery and murder. Central to this history of oppression is the Nazi regime’s racial persecution and genocide of the Romanies during the Holocaust. However, in the Federal Republic of Germany, the devastating experiences of the Romanies during the Holocaust received minimal attention in the decades that followed. As such, this thesis aims to answer the question: Did the transitional justice process in the Federal Republic of Germany, in the aftermath of the Third Reich, fail Romanies as victims of racial persecution, genocide and the Holocaust? It provides an overview of the suffering experienced by the Romanies at the hands of the Nazi regime, situating their plight within the framework of racial persecution, genocide and the Holocaust. -

Fall 2005 an Interesting Acquisition
THE BULLETIN OF Volume 10, Number 1 Fall 2005 An Interesting Acquisition The Center for Holocaust Studies recently joined with Special Collec- tions to purchase a pair of artists’ books by Tatana Kellner. Kellner, a photog- rapher, printmaker, and book artist based at the Women’s Studio Workshop in Rosendale, New York, is also the daughter of Holocaust survivors. The two volumes B-11226: Fifty years of silence, Eugene Kellner’s story and 71125: Fifty years of silence, Eva Kellner’s story give artistic expression to her parents’ memories of internment in several concentration and extermi- nation camps. The titles come from the parents’ de- cades-long refusal to talk about their experience, a silence not uncommon among survivors. What is unusual is what Kellner has done with their hand- written testimony. Artists’ books are handmade volumes, unified in content in such a way as to have a singular impact on the reader. Kellner’s two creations are striking examples of the genre, presented in simple wooden boxes marked solely by the number painted on each lid. When the cover is removed, a flesh-colored papier-mâché cast of the parent’s forearm is revealed, complete with tattooed number. The pages of the books, die-cut to fit around the cast, contain two sets of text. Images of the hand-written Czech accounts are printed on translucent pages, while the English translations are superimposed on contemporary and historical images. Family photographs add a personal context and provide specificity to the horrors of the Holocaust. continued on page -

Romani Worlds
ROMANI WORLDS: ACADEMIA, POLICY, AND MODERN MEDIA A selection of articles, reports, and discussions documenting the achievements of the European Academic Network on Romani Studies Edited by Eben Friedman / Victor A. Friedman Romani worlds: Academia, policy, and modern media A selection of articles, reports, and discussions documenting the achievements of the European Academic Network on Romani Studies Edited by Eben Friedman and Victor A. Friedman Cluj-Napoca: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2015 ISBN: 978-606-8377-40-7 Design: Marina Dykukha Layout: Sütő Ferenc Photos: László Fosztó, Network Secretary, unless other source is indicated © Council of Europe and the contributors The opinions expressed in this work are the responsibility of the authors and do not necessarily reflect the official policy of the Council of Europe or the European Commission. 2 CONTENTS CONTENTS INTRODUCTION TO THE VOLUME __________________________________________ 6 Eben Friedman, Victor A. Friedman with Yaron Matras PART ONE: THE STRASBOURG SHOWCASE EVENT ____________________________ 11 Edited by Eben Friedman with Victor A. Friedman Opening statement by Ágnes Dároczi (European Roma and Travellers Forum) _______ 12 Opening statement by Eben Friedman (European Centre for Minority Issues) ________ 18 Opening statement by Margaret Greenfields Buckinghamshire( New University) _____ 24 Europe’s neo-traditional Roma policy: Marginality management and the inflation of expertise ____________________________________________ 29 Yaron Matras The educational and school inclusion of Roma in Cyprus and the SEDRIN partners’ country consortium _______________________________ 48 Loizos Symeou 3 CONTENTS PART TWO: EMAIL DISCUSSIONS _________________________________________ 72 Edited by Eben Friedman and Victor A. Friedman, with Judit Durst Network Discussion 1: Measuring and reporting on Romani populations ___________ 74 Edited by Eben Friedman with Victor A.