Nachrichten Aus Dem Stadtarchiv Gera
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
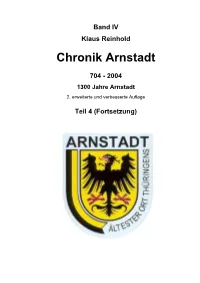
Chronik Band 4
Band IV Klaus Reinhold Chronik Arnstadt 704 - 2004 1300 Jahre Arnstadt 2. erweiterte und verbesserte Auflage Teil 4 (Fortsetzung) Hebamme Anna Kessel (Weiße 50) verhalf am 26.10.1942 dem viertausendstem Kind in ihrer langjährigen beruflichen Laufbahn zum Leben. 650 „ausgebombte“ Frauen und Kinder aus Düsseldorf trafen am 27.10.1942 mit einem Son- derzug in Arnstadt ein. Diamantene Hochzeit feierte am 28.10.1942 das Ehepaar Richard Zeitsch (86) und seine Ehefrau Hermine geb. Hendrich (81), Untergasse 2. In der Nacht vom Sonntag, dem 1. zum 2.11.1942, wurden die Uhren (um 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr) um eine Stunde zurückgestellt. Damit war die Sommerzeit zu Ende und es galt wieder Normalzeit. Zum ersten Mal fand am 14.11.1942 in Arnstadt eine Hochzeit nach dem Tode statt. Die Näherin Silva Waltraud Gertrud Herzer heiratete ihren am 9.8.1941 gefallenen Verlobten, den Obergefreiten Artur Erich Hans Schubert mit dem sie ein Töchterchen namens Jutta (7 30.8.1939 in Arnstadt) hatte. Die Heirat erfolgte mit Wirkung des Tages vor dem Tode, also 8.8.1941. Die Tochter wurde „durch diese Eheschließung legitimiert“. 1943 Der Sturm 8143 des NS-Fliegerkorps baute Anfang 1943 auf dem Fluggelände Weinberg bei Arnstadt eine Segelflugzeughalle im Werte von 3500 RM. Die Stadt gewährte einen Zuschuß von 1000 RM und trat dem NS-Fliegerkorps als Fördermitglied mit einem Jahres- beitrag von 100,00 RM bei. Der fast 18-jährige Schüler Joachim Taubert (7 24.2.1925 in Arnstadt) wurde am 6.1.1943, 9.00 Uhr, in der Wohnung seiner Mutter, der Witwe Gertrud Elisabeth Taubert geb. -

Zeittafel Amateurtheater Sachsen Von 1945 Bis 1990 Einschließlich Relevanter Ereignisse Aus Kulturpolitik Für Die Volkskunst
Zeittafel Amateurtheater Sachsen von 1945 bis 1990 Einschließlich relevanter Ereignisse aus Kulturpolitik für die Volkskunst In dieser Ereignistafel wurden viele Fakten aufgenommen, die scheinbar nur bedingt mit dem nichtprofes- sionellen Theater zu tun haben. Dennoch sind sie mir wichtig, da sie die Bedingungen aufzeigen unter dem das nichtprofessionelle Theater wirkte. Besonders in den Anfangsjahren, etwa bis 1955, verzichtet man noch auf eine genaue fachspezifische Trennung in der Arbeit der Volkskunst, so daß sich hinter den aufgeführten Veranstaltungen häufig auch Beteiligungen von Akteuren aus dem nichtprofessionellen Thea- ter verbergen. Bei den hervorgehobenen Datierungen handelt es sich um Ereignisse, die nachweislich mit dem nichtpro- fessionellen Theater zu tun haben, aber nicht durchweg mit dem sächsischen. Die hier getroffen Auswahl erfolgte auf dem subjektiven Urteil des Webseitenbetreibers. Eine Vollständig- keit wird nicht erhoben. Dennoch wurde der Versuch unternommen, möglichst viele relevante Daten zu erfassen. Der Nutzer findet auf dieser Webseite noch weitere spezielle Auflistungen, die zusätzliche Infor- mationen liefern. Abkürzungen werden am Ende der Zeittafel erklärt. Die neue Rechtschreibung findet hier keine Anwen- dung. Gern werden weitere Informationen mit Quellenangaben entgegengenommen. 1945 Nach der Niederlage Deutschlands im 2. Weltkrieg verhängten die Besatzungsmächte ein Vereinigungs- verbot über das Land. 1945 Theatergruppe Hoflößnitz, Radebeul, spielt Hans-Sachs-Stücke. - Hametner, Michael: Sächsisches Amateurtheater nach 1945. In: Auf der Scene, S. 180; s. a. Stave, Gabriele: Rolf Ludwig. Nüchtern betrachtet, S. 40/3, S. 53. 1945, 12.5. „Beschluss Nr. 64 des Kriegsrates der 1. Belorussischen Front, die kommunale Wirtschaft der Stadt Berlin in Gang zu bringen. Vorgesehen sind u. a. auch die Instandsetzung der Kinos und Theater.“ - http://www.ddr-lexikon.de/Chronik_der_DDR_1945. -
© in This Web Service Cambridge University
Cambridge University Press 978-1-107-00636-2 - Rereading East Germany: The Literature and Film of the GDR Edited by Karen Leeder Index More information Index Abusch, Alexander, 39, 45, 46, 73, 79 Babel, Isaak, 148 Ackermann, Anton, 39 Bahro, Rudolf, 27 Adan, G.P., 178n22 Baierl, Helmut, 74, 78, 79, 81 Adorno, Theodor W., 25, 43 Bakhtin, Mikhail M., 9, 18, 135–136, 144 Aeschylus, 126 Bammer, Angelika, 124n37 Prometheus Bound, 126 Barck, Simone, 149 afterlife, 186, 214, 216, 222, 228, 230 Barlach, Ernst, 61 agitprop, 72 Bartel, Kurt, 76 Akademie der Künste (Berlin), 149 Terra incognita, 76 Albers, Hans, 70 Bartsch, Kurt, 26, 80 Alewyn, Richard, 37, 43 Bastian, Uwe, 166, 177n11 Alexanderplatz, xv, 85, 201 Bathrick, David, 2, 26, 146, 154, 225 Demonstration of 4 November 1989, 85, 201 Battersby, Christine, 123n10 Alltag (Alltagsleben – everyday life), 2, 18, 113, Baudelaire, Charles, 24 139, 219 Baum, Georgina, 127–128, 130 Anderson, Sascha, 28, 153, 163, 169, 171, 183, 192, Becher, Johannes R., 12, 20, 22, 38–39, 41–43, 44, 193, 209 46, 47–48, 52, 90, 92, 147–148 Sascha Anderson, 192, 196n58 Abschied, 90 Andress, Reinhard, 124n43 Auf andere Art so große Hoffnung, 92 Ankunftsliteratur, 23, 113 ‘Auferstanden aus Ruinen’, 47, 147 antifascism, 13–16, 18, 22, 24, 27, 38–42, 52–67, Becker, 30 74, 93, 132, 241 Becker, Jurek, 23, 24, 26, 30, 66, Anz, Thomas, 181, 205, 209 198–199, 210 Apitz, Bruno, 16, 18, 66 Jakob der Lügner, 24, 66 Nackt unter Wölfen, 16, 18, 63, 66 Becker, Wolfgang, 5, 218 Appadurai, Arjun, 28 Goodbye, Lenin!, 5, 218, 225 Arendt, -

9781469657585 WEB.Pdf
Theater in the Planned Society COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES ImUNCI Germanic and Slavic Languages and Literatures From 1949 to 2004, UNC Press and the UNC Department of Germanic & Slavic Languages and Literatures published the UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures series. Monographs, anthologies, and critical editions in the series covered an array of topics including medieval and modern literature, theater, linguistics, philology, onomastics, and the history of ideas. Through the generous support of the National Endowment for the Humanities and the Andrew W. Mellon Foundation, books in the series have been reissued in new paperback and open access digital editions. For a complete list of books visit www.uncpress.org. Theater in the Planned Society Contemporary Drama in the German Democratic Republic in its Historical, Political, and Cultural Context h. g. huettich UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures Number 88 Copyright © 1978 This work is licensed under a Creative Commons cc by-nc-nd license. To view a copy of the license, visit http://creativecommons. org/licenses. Suggested citation: Huettich, H. G.Theater in the Planned Society: Contemporary Drama in the German Democratic Republic in its Histor- ical, Political, and Cultural Context. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1978. doi: https://doi.org/ 10.5149/9781469657585_ Huettich Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Huettich, H. G. Title: Theater in the planned society : contemporary drama in the German Democratic Republic in its historical, political, and cultural context / by H. G. Huettich. Other titles: University of North Carolina studies in the Germanic languages and literatures ; no. -

Uniwersytet Śląski W Katowicach
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ FILOLOGICZNY INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ Joanna Graca KONSTRUKTIONEN DER IDENTITÄT IN DER PROSA VON WERNER HEIDUCZEK Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Grażyny Barbary Szewczyk Katowice 2014 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ FILOLOGICZNY INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ Joanna Graca KONSTRUKCJE TOŻSAMOŚCI W PROZIE WERNERA HEIDUCZKA Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Grażyny Barbary Szewczyk Katowice 2014 INHALTSVERZEICHNIS EINLEITUNG .................................................................................................... 6 1. HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER IDENTITÄTSFORSCHUNG .... 10 1.1 Begriffserklärung .................................................................................... 10 1.2 Problem der Identität in den wissenschaftlichen Theorien von der Antike bis zum 19. Jahrhundert ................................................................................ 10 1.3 Identitätsforschung im 20. Jahrhundert .................................................. 11 1.3.1 Identität und Identitätsbildung in der Postmoderne ......................... 24 1.3.2 Identität und Erinnerung .................................................................. 26 2. DIE LITERATURPOLITIK DER DDR ...................................................... 34 2.1 Ausgangssituation – die Nachkriegsjahre und Gründung der DDR ....... 34 2.2 Kultur- und Literaturpolitik .................................................................... 35 2.3 Die Stellung des -

Sie Lebt Für Ihre Arbeit
SIE LEBT FÜR IHRE ARBEIT. DIE SCHÖNE ARBEIT. GEHEN SIE AN DIE ARBEIT. DIE INSZENIERUNG VON ARBEIT UND GESCHLECHT IN DRAMATIK UND SPIELFILM DER DDR Peggy Mädler Bianca Schemel SIE LEBT FÜR IHRE ARBEIT. DIE SCHÖNE ARBEIT. GEHEN SIE AN DIE ARBEIT. Die Inszenierung von Arbeit und Geschlecht in Dramatik und Spielfilm der DDR Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades doctor philosophiae (Dr. phil.) eingereicht an: der Philosophischen Fakultät III der Humboldt-Universität zu Berlin von Peggy Mädler, Bianca Schemel Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin: Prof. Dr. Christoph Markschies Dekan der Philosophischen Fakultät III: Prof. Dr. Bernd Wegener Gutachter: 1. Prof. Dr. Karin Hirdina 2. Prof. Dr. Wolfgang Engler Datum der Promotion: 16.03.2009 2 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT 9 1. THEORETISCHE UND METHODISCHE GRUNDLAGEN 15 1.1. DER BEGRIFF DER ARBEIT, Peggy Mädler 16 1.2. AUSWAHL DES MATERIALS UND DES ZEITRAUMS, Bianca Schemel 20 1.3. DAS KONZEPT DER PERFORMATIVITÄT, Peggy Mädler 22 1.3.1. AUFHEBUNG DER DICHOTOMIEN 25 1.3.2. DIE BETONUNG DER SPRECHSITUATION 27 1.4. DER BEGRIFF GESCHLECHT, Bianca Schemel 28 1.5. SOZIALE POSITIONIERUNGEN, Bianca Schemel 30 2. MENSCHWERDUNG UND EMANZIPATION DURCH ARBEIT 37 2.1. „DENN SEINE ARBEIT IST/ NICHT MEHR SEIN FEIND“ Die Inszenierung von Arbeit als Vollzug der Menschwerdung in Theatertexten der DDR, Peggy Mädler 38 2.1.1. „DIESEN SOMMER HAT MEIN LEBEN ANGEFANGEN.“ Die Emanzipation der Dienstmagd 41 2.1.2. „KRAMER, ERIKA, GEBORENE KLEINSCHMIDT. BERUF: OHNE“ Die Emanzipation der Hausfrau 47 2.1.3. „RENTNERTAG, SAUTAG, HUNDETAG, TODESTAG, ROSTTAG, WEGWERFTAG.“ Die Scham der ruhelosen RentnerInnen 56 2.2. -

Wechselschritt Zwischen Anpassung Und Aufrechtem Gang
‘Wechselschritt zwischen Anpassung und aufrechtem Gang’: Negotiating the Tensions between Literary Ambition and Political Constraints at the Institut für Literatur ‘Johannes R. Becher’ Leipzig (1950-1990) A thesis submitted to The University of Manchester for the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Humanities 2015 Marina Micke School of Arts, Languages and Cultures CONTENTS INTRODUCTION .................................................................................................................... 7 CHAPTER 1 1. ‘Dichterschule oder Kaderschmiede’? The Literature on the Institut für Literatur ‘Johannes R. Becher’ Leipzig .............................. 14 CHAPTER 2 2. Developing an Analytical Framework for the Practices at the Becher Institute ........... 43 2.1 Fields and Capital: Investigating Sites of Struggle and Domination in Society 44 Capital in Its Different Forms and States ............................................................. 54 2.2 Habitus: Accounting for Individual Behaviour ..................................................... 60 CHAPTER 3 3. Institutionalised Capital: Creating a Literary Institute in the Unstable East German Literary Field of the Early 1950s .................................... 69 Three Stages of the Institute’s Founding Process ............................................... 71 3.1. Difficulties of Accumulating Initial Capital: First Proposals for the Founding of a Literary Academy (1950-1952) ............ 76 Johannes R. Becher versus Franz Hammer ......................................................... -

Konstruktionen Der Identität in Der Prosa Von Werner Heiduczek
Title: Konstruktionen der Identität in der Prosa von Werner Heiduczek Author: Joanna Graca Citation style: Graca Joanna. (2014). Konstruktionen der Identität in der Prosa von Werner Heiduczek. Praca doktorska. Katowice : Uniwersytet Śląski UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ FILOLOGICZNY INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ Joanna Graca KONSTRUKTIONEN DER IDENTITÄT IN DER PROSA VON WERNER HEIDUCZEK Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Grażyny Barbary Szewczyk Katowice 2014 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ FILOLOGICZNY INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ Joanna Graca KONSTRUKCJE TOŻSAMOŚCI W PROZIE WERNERA HEIDUCZKA Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Grażyny Barbary Szewczyk Katowice 2014 INHALTSVERZEICHNIS EINLEITUNG .................................................................................................... 6 1. HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER IDENTITÄTSFORSCHUNG .... 10 1.1 Begriffserklärung .................................................................................... 10 1.2 Problem der Identität in den wissenschaftlichen Theorien von der Antike bis zum 19. Jahrhundert ................................................................................ 10 1.3 Identitätsforschung im 20. Jahrhundert .................................................. 11 1.3.1 Identität und Identitätsbildung in der Postmoderne ......................... 24 1.3.2 Identität und Erinnerung .................................................................. 26 2. DIE LITERATURPOLITIK DER DDR .....................................................