Heilige Als Vorbilder Protestantischer Frömmigkeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Download Booklet
Johann Sebastian Bach 1685-1750 Cantatas Vol 6: Köthen/Frankfurt SDG134 COVER SDG134 CD 1 54:53 For the Twelfth Sunday after Trinity Lobe den Herrn, meine Seele BWV 69a Geist und Seele wird verwirret BWV 35 Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren BWV 137 Katharine Fuge soprano, Robin Tyson alto Christoph Genz tenor, Peter Harvey bass CD 2 57:03 For the Thirteenth Sunday after Trinity Du sollt Gott, deinen Herren, lieben BWV 77 C Ihr, die ihr euch von Christo nennet BWV 164 M Allein zu dir, Herr Jesu Christ BWV 33 Y Gillian Keith soprano, Nathalie Stutzmann alto K Christoph Genz tenor, Jonathan Brown bass The Monteverdi Choir The English Baroque Soloists John Eliot Gardiner Live recordings from the Bach Cantata Pilgrimage Jakobskirche, Köthen, 10 September 2000 Dreikönigskirche, Frankfurt, 17 September 2000 Soli Deo Gloria Volume 6 SDG 134 P 2007 Monteverdi Productions Ltd C 2007 Monteverdi Productions Ltd www.solideogloria.co.uk Edition by Reinhold Kubik, Breitkopf & Härtel Manufactured in Italy LC13772 8 43183 01342 5 SDG 134 Bach Cantatas Gardiner 6 Bach Cantatas Gardiner CD 1 54:53 For the Twelfth Sunday after Trinity The Monteverdi Choir The English Flute 1-6 17:18 Lobe den Herrn, meine Seele BWV 69a Baroque Soloists Sopranos Rachel Beckett 7-13 24:32 Geist und Seele wird verwirret BWV 35 Suzanne Flowers First Violins Oboes 14-18 12:49 Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren BWV 137 Lucinda Houghton Kati Debretzeni Marcel Ponseele Gillian Keith Nicolette Moonen Mark Baigent Emma Preston-Dunlop Foskien Kooistra Cherry -

The Musical Heritage of the Lutheran Church Volume I
The Musical Heritage of the Lutheran Church Volume I Edited by Theodore Hoelty-Nickel Valparaiso, Indiana The greatest contribution of the Lutheran Church to the culture of Western civilization lies in the field of music. Our Lutheran University is therefore particularly happy over the fact that, under the guidance of Professor Theodore Hoelty-Nickel, head of its Department of Music, it has been able to make a definite contribution to the advancement of musical taste in the Lutheran Church of America. The essays of this volume, originally presented at the Seminar in Church Music during the summer of 1944, are an encouraging evidence of the growing appreciation of our unique musical heritage. O. P. Kretzmann The Musical Heritage of the Lutheran Church Volume I Table of Contents Foreword Opening Address -Prof. Theo. Hoelty-Nickel, Valparaiso, Ind. Benefits Derived from a More Scholarly Approach to the Rich Musical and Liturgical Heritage of the Lutheran Church -Prof. Walter E. Buszin, Concordia College, Fort Wayne, Ind. The Chorale—Artistic Weapon of the Lutheran Church -Dr. Hans Rosenwald, Chicago, Ill. Problems Connected with Editing Lutheran Church Music -Prof. Walter E. Buszin The Radio and Our Musical Heritage -Mr. Gerhard Schroth, University of Chicago, Chicago, Ill. Is the Musical Training at Our Synodical Institutions Adequate for the Preserving of Our Musical Heritage? -Dr. Theo. G. Stelzer, Concordia Teachers College, Seward, Nebr. Problems of the Church Organist -Mr. Herbert D. Bruening, St. Luke’s Lutheran Church, Chicago, Ill. Members of the Seminar, 1944 From The Musical Heritage of the Lutheran Church, Volume I (Valparaiso, Ind.: Valparaiso University, 1945). -
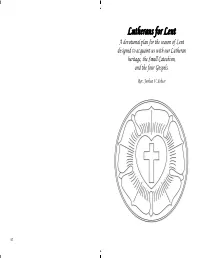
Lutherans for Lent a Devotional Plan for the Season of Lent Designed to Acquaint Us with Our Lutheran Heritage, the Small Catechism, and the Four Gospels
Lutherans for Lent A devotional plan for the season of Lent designed to acquaint us with our Lutheran heritage, the Small Catechism, and the four Gospels. Rev. Joshua V. Scheer 52 Other Notables (not exhaustive) The list of Lutherans included in this devotion are by no means the end of Lutherans for Lent Lutheranism’s contribution to history. There are many other Lutherans © 2010 by Rev. Joshua V. Scheer who could have been included in this devotion who may have actually been greater or had more influence than some that were included. Here is a list of other names (in no particular order): Nikolaus Decius J. T. Mueller August H. Francke Justus Jonas Kenneth Korby Reinhold Niebuhr This copy has been made available through a congregational license. Johann Walter Gustaf Wingren Helmut Thielecke Matthias Flacius J. A. O. Preus (II) Dietrich Bonheoffer Andres Quenstadt A.L. Barry J. Muhlhauser Timotheus Kirchner Gerhard Forde S. J. Stenerson Johann Olearius John H. C. Fritz F. A. Cramer If purchased under a congregational license, the purchasing congregation Nikolai Grundtvig Theodore Tappert F. Lochner may print copies as necessary for use in that congregation only. Paul Caspari August Crull J. A. Grabau Gisele Johnson Alfred Rehwinkel August Kavel H. A. Preus William Beck Adolf von Harnack J. A. O. Otteson J. P. Koehler Claus Harms U. V. Koren Theodore Graebner Johann Keil Adolf Hoenecke Edmund Schlink Hans Tausen Andreas Osiander Theodore Kliefoth Franz Delitzsch Albrecht Durer William Arndt Gottfried Thomasius August Pieper William Dallman Karl Ulmann Ludwig von Beethoven August Suelflow Ernst Cloeter W. -

ISBN 978-3-7995-0510-9 Musik In
Sonderdruck aus: Michael Fischer, Norbert Haag, Gabriele Haug-Moritz (Hgg.) MUSIK IN NEUZEITLICHEN KONFESSIONS KULTUREN (16. BIS 19. JAHRHUNDERT) Räume – Medien – Funktionen Jan Thorbecke Verlag 005109_sonderdruck.indd5109_sonderdruck.indd 1 227.01.147.01.14 111:471:47 Gedruckt mit Unterstützung der Geisteswissenschaftlichen Fakultät und des Vizerektorats für Forschung und Nachwuchsförderung der Karl-Franzens-Universität Graz Gedruckt mit Unterstützung des Deutschen Volksliedarchivs in Freiburg Gedruckt mit Unterstützung des Evangelischen Oberkirchenrats Stuttgart sowie des Vereins für württembergische Kirchengeschichte. Für die Schwabenverlag AG ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Maßstab ihres Handelns. Wir achten daher auf den Einsatz umweltschonender Ressourcen und Materialien. Dieses Buch wurde auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt. FSC (Forest Stewardship Council®) ist eine nicht staatliche, gemeinnützige Organisation, die sich für eine ökologische und sozial verantwortliche Nutzung der Wälder unserer Erde einsetzt. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National- bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Alle Rechte vorbehalten © 2014 Jan Thorbecke Verlag der Schwabenverlag AG, Ostfildern www.thorbecke.de Umschlaggestaltung: Finken & Bumiller, Stuttgart Umschlagabbildung: Stahlstich Eine feste Burg ist unser Gott von H. Gugeler (Gesangbuch für die evangelische Kirche in Württemberg, -

Christian Education in the Seventh-Day Adventist Church in Remo, Ogun State, Nigeria, 1959-2004
CHRISTIAN EDUCATION IN THE SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH IN REMO, OGUN STATE, NIGERIA, 1959-2004 BY ADESEGUN, ABIODUN AYODEJI B.A. (Andrews), M.A. (Ibadan) MATRIC NO 40172 A THESIS IN THE DEPARTMENT OF RELIGIOUS STUDIES, SUBMITTED TO THE FACULTY OF ARTS IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY, UNIVERSITY OF IBADAN, IBADAN, NIGERIA FEBRUARY, 2009 DEDICATION To the glory of God, and to my darling wife, Mrs.Olubusola Iretiola Adesegun, Chief Nursing Officer, Olabisi Onabanjo University Teaching Hospital, Sagamu, a pearl of inestimable value. ii CERTIFICATION I certify that this work was carried out by Mr. Abiodun Ayodeji ADESEGUN, under my direct supervision in the Department of Religious Studies, Faculty of Arts, University of Ibadan, Ibadan in Partial Fulfillment for the award of the degree of Doctor of Philosophy in Religious Studies …………………………… …………………………… Date Supervisor ‘Deji Ayegboyin B.A. Hons, (Legon), M.A. (Ibadan), Ph.D (Ibadan) iii ACKNOWLEDGMENTS I wish to express my profound gratitude to the triune God who gave me the grace, health and the means of sustenance with which I was able to undertake doctoral studies. He has intervened in my life in positive ways in years past and He has shown Himself as a reliable and present help in time of need. I am grateful and deeply indebted to my supervisor, Dr. ‘Deji Ayegboyin, an erudite intellectual and a humble and loving son of Africa who through sound scholarship, patience, and experience guided me through. In spite of his loaded academic schedule, he treated me and my colleagues in a thorough and personal way. -

May 2 Order of Worship
FIRST BAPTIST CHURCH Historic | Liturgical | Vibrant FIFTH SUNDAY OF EASTERTIDE May 2, 2021 at 11:00 am WE GATHER TO PRAISE GOD Music Notes CHIMING OF THE HOUR Much of the music used in today’s worship service will be excerpts from “Der WELCOME Rev. Katie Callaway & Rev. John Callaway Himmel lacht! Die Erde jubilieret” (Heaven Laughs! Earth Exults) by INVOCATION Johann Sebastian Bach. This work is Bach’s 31st PRELUDE - “Sonata” from Cantata No. 31 by Johann Sebastian Bach church cantata and was North Carolina Baroque Orchestra written for the first day of the Easter season. It was first performed in CALL TO WORSHIP - Psalm 22:25-31 Ellen Davis, Lay Reader Weimar, Germany, on April 21, 1715 and later HYMN - “Christ Is Risen, Shout Hosanna” Tune: HYMN TO JOY reworked for performances in Leipzig. The work is scored for five Christ is risen! Shout hosanna! part choir, large Celebrate this day of days! orchestra, and soprano, tenor, and bass soloists. Christ is risen! Hush in wonder: All creation is amazed. In the desert all surrounding, Guest Musicians See, a spreading tree has grown. Healing leaves of grace abounding Today we welcome the Bring a taste of love unknown. choir of Wake Forest University from Winston Salem, NC. They are Christ is risen! Raise your spirits under the direction of Dr. From the caverns of despair. Christopher Gilliam and Walk with gladness in the morning. accompanied by the North See what love can do and dare. Carolina Baroque Orchestra. The choral Drink the wine of resurrection, program at Wake Not a servant, but a friend. -

The Organ Music of Ethel Smyth
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by IUScholarWorks THE ORGAN MUSIC OF ETHEL SMYTH: A GUIDE TO ITS HISTORY AND PERFORMANCE PRACTICE BY SARAH M. MOON Submitted to the faculty of the School of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree, Doctor of Music, Indiana University May, 2014 Accepted by the faculty of the Jacobs School of Music, Indiana University, in partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Music. __________________________________ Janette Fishell, Research Director __________________________________ Gretchen Horlacher __________________________________ Bruce Neswick __________________________________ Christopher Young ii Copyright © 2014 Sarah M. Moon iii This document is dedicated to my family. iv ACKNOWLEDGEMENTS I would foremost like to thank the members of my Doctoral Committee: Professor Janette Fishell, Professor Gretchen Horlacher, Professor Bruce Neswick, and Professor Christopher Young. I truly appreciate my five years at Indiana University under their guidance and admire their inspirational models of character and excellence. I would especially like to thank Dr. Janette Fishell, my organ professor and research director, who has provided invaluable musical and academic encouragement. I am also grateful to many people and institutions in England who helped with my research: Fiona McHenry and the helpful staff at the British Library’s Music and Rare Books Reading Room; Michael Mullen and the librarians at the Royal College of Music; Peter Graham Avis, a fellow Ethel Smyth scholar; and Alex Joannides from Boosey and Hawkes for granting me permission to make a copy of “Prelude on a Traditional Irish Air” for study purposes. -

Brass Quartet Score Catalog
Richard Jordan Lutheran-Hymnal.Com 1307 Tanager Ave Ocheyedan, Iowa 51354 USA Brass Quartet Scores for Sale At Lutheran-Hymnal.Com Scores are $3.00 each and are sent via email in adobe acrobat format. Please enclose check with order, payable in US dollars, and made out to Richard Jordan. Please double check your email address, so that we can deliver your score. Name Street City/State/Zip Email Scores @ $3.00ea bq280 Abends - Herbet Oakeley 1871 bq087 Antioch - George Handel 1742 TLH280 Return, O Wanderer, Return TLH087 Joy to the World, the Lord is Come bq292 Ach bleib bei uns - Leipzig 1580 bq192 Auf, auf, mein Herz - Johann Cruger 1648 TLH292 Lord Jesus Christ, with Us Abide TLH192 Awake, My Heart, with Gladness bq102 Adeste fidelus - English? c.1700 bq473 Aurelia - Samuel Wesley 1864 TLH102 Oh, Come, All Ye Faithful TLH473 The Church's One Foundation bq476 Alford - John Dykes 1875 bq248lw Aus Tiefer Not II - Strassburg 1525 TLH476 Ten Thousand Times Ten Thousand LW 248 Lord Jesus Christ, Life-Giving Bread bq236 All Ehr un Lob - Strassburg 1541 bq548 Aus meines Herzens Grunde - Hamburg 1598 TLH236 Creator Spirit, by Whose Aid TLH548 My Inmost Heart Now Raises bq452 All Saints New - Henry Cutter 1872 bq281 Azmon - Carl Glaser 1829 TLH452 The Son of God Goes Forth to War TLH281 The Savior Calls; Let Every Ear bq282 Alles ist an Gottes Segen - Johann Konig 1732 bq481 Baltimore - Bernard Schumacher 1910 TLH282 Christians, Come, in Sweetest Measures TLH481 Through the Night of Doubt and Sorrow bq352 Angel's Story - Arthur -

Music and Bell Ringing Catalog
Catalog of Music and Bell Ringing for the Chime Master VERSION 3.0 www.ChimeMaster.com Selections Catalog This catalog is provided as a supplement to the Chime Master System Millennium manual. It contains lists of frequently used bell ringing functions as well as specific music selection numbers. Should you need additional instruction, please refer to the Overview and Scheduling Automatic Performances sections of the operating manual. Typically you will only need to enter selection numbers when editing your program schedule, programming function buttons or using the Play Selections menu for special occasions. We highly recommend using random music groups for your weekly program schedule. This both saves you time and the community will always have a great variety of music to enjoy. Entering Selections New selections may be entered over the existing program selections. Entering all zeros for a selection will delete it. In the Setup Function Button menu, and the Play Selections menu, if only one selection is entered, 001 Time(s) will be displayed allowing you to repeat the selection up to 199 times. These repeats are usually used to program the number of strikes of a toll. On Screen Title Lookup Whenever a four digit number is flashing on the editing display, and you don’t remember the number for your favorite selection, press the [NO] cursor down button (as in “No, I don’t know what number I want"). This will bring up the Title Lookup Screen which is subdivided into four groups: User Recordings Titles of recordings that have been recorded by you. Any untitled selections will be displayed as untitled nnnn with its catalog number. -

Heinrich Albert's Pumpkin
Heinrich Albert’s Pumpkin Hut Dorothee Mields Hathor Consort Romina Lischka 1 Programme Ensemble English text German text French text Poetry Imprint Heinrich Albert’s Pumpkin Hut Heinrich Albert’s Pumpkin Hut Fighting the Horrors of the Thirty Years’ War with Music, Poetry and Friendship Mit Freundschaft, Musik und Poesie gegen die Grauen des Dreissigjährigen Krieges Avec amitié, musique et poésie contre les atrocités de la guerre de Trente Ans I War 1 Samuel Scheidt (1587–1654) Galliard Battaglia à 5, SSWV 59 3:47 2 Heinrich Schütz (1585–1672) Es steh Gott auf, SWV 356 5:59 3 Samuel Scheidt Paduan Dolorosa à 4, SSWV 42 6:06 4 Johann Hildebrand (1614–1684) Der V. Kriegs-Angst-Seufft zer 2:03 5 Samuel Scheidt Courant Dolorosa à 4, SSWV 47 2:12 II Longing for Peace in the Face of Mortality — Heinrich Albert’s Pumpkin Garden in Königsberg Heinrich Albert (1604–1651) from: Musicalische Kürbs-Hütte 6 i Mit der Zeit ich kommen bin 1:05 7 iv Mensch, ich kann es leichtlich gläuben 0:26 8 vi Sieh mich an und denke dran 1:12 9 ix Die Zeit und wir vergehn 0:40 10 x Ich und meine Blätter wissen 0:52 11 Johann Bach (1604–1673) Unser Leben ist ein Schatten 6:06 ^menu III A Fragile Truce 12 Heinrich Schütz Siehe, wie fein und lieblich ist’s (Prima pars), SWV 48 4:27 13 Heinrich Albert Jetzund liebet 1:01 14 Andreas Hammerschmidt (1611–1675) from Suite a 5 in d: Gagliard 0:57 15 Heinrich Albert Auf und springet 0:51 16 Andreas Hammerschmidt from Suite a 5 in d: Sarabande 0:21 17 Heinrich Albert In seiner Liebsten Armen 0:33 18 Andreas Hammerschmidt from Suite a 5 in C: Gagliard 0:42 19 Andreas Hammerschmidt from Suite a 5 in C: Ballet 0:48 20 Heinrich Albert Mein liebstes Seelchen, lasst uns leben 2:23 21 Johann Nauwach (c. -

(Cycle A) 2019 - 2020
TAKING FAITH HOME (CYCLE A) 2019 - 2020 HYMNS OF THE WEEK LISTING OF TEXT AND MUSIC AUTHORS SEASON DATE TFH INSERT HYMN TEXT MUSIC 1-Dec-19 FIRST SUNDAY OF ADVENT This Little Light of Mine African American Spiritual African American Spiritual 8-Dec-19 SECOND SUNDAY OF ADVENT Come Now, O Prince of Peace Geonyong Lee (1947- ) Geonyong Lee (1947- ) ADVENT 15-Dec-19 THIRD SUNDAY OF ADVENT Joy to the World Isaac Watts (1674-1748) George F. Handel (1685-1759) 22-Dec-19 FOURTH SUNDAY OF ADVENT Light One Candle Wayne L. Wold (1954- ) Yiddish folk tune 25-Dec-19 CHIRSTMAS EVE, CHRISTMAS DAY Away in a Manger North American (19th century) James R. Murray (1841-1905) 29-Dec-19 FIRST SUNDAY AFTER CHRISTMAS O Little Town of Bethlehem Phillips Brooks (1835-1893) Lewis H. Redner (1831-1908) CHRISTMAS 1-Jan-20 NEW YEARS EVE, NEW YEARS DAY O God, Our Help in Ages Past Isaac Watts (1674-1748) William Croft (1678-1727) 5-Jan-20 SECOND SUNDAY AFTER CHRISTMAS Hark the Herald Angels Sing Charles Wesley (1707-1788) Felix Mendelssohn (1809-1847) 6-Jan-20 EPIPHANY OF OUR LORD Rise, Shine, You People! Ronald A. Klug (1939- ) Dale Wood (1934-2003) 12-Jan-20 BAPTISM OF OUR LORD Christ, When for Us You Were Baptized F. Bland Tucker (1895-1984) Nikolaus Herman (1480-1561) 19-Jan-20 SECOND SUNDAY AFTER EPIPHANY Will You Come and Follow Me John L. Bell (1949- ) Scottish traditional 26-Jan-20 THIRD SUNDAY AFTER EPIPHANY Christ, Be Our Light Bernadette Farrell (1957- ) Bernadette Farrell (1957- ) EPIPHANY 2-Feb-20 FOURTH SUNDAY AFTER EPIPHANY Blest Are They David Haas (1957- ) David Haas (1957- ) 9-Feb-20 FIFTH SUNDAY AFTER EPIPHANY Let Us Ever Walk with Jesus Sigismund von Birken (1626-1681) Georg G. -

Nicht-Edierte Texte Von Bucer
1 Heidelberger Akademie der Wissenschaften Bucer-Forschungsstelle Dezember 2016 Texte (exkl. Briefe) von Martin Bucer, die nicht in einer modernen kritischen Edition vorliegen, zeitgenössische Texte über Bucer, Testimonien etc. A. Gedruckte lateinische Texte B. Handschriftlich überlieferte lateinische Texte C. Gedruckte deutsche Texte (auch Dubiosa) D. Handschriftlich überlieferte deutsche Texte E. Weitere Überlieferungen bereits edierter deutscher und lateinischer Texte F. Nachgewiesene, nicht mehr vorhandene bzw. nicht aufgefundene Texte G. Gedruckte und handschriftliche zeitgenössische Texte über Bucer H. Verschiedene Testimonien, Sonstiges 2 A. Gedruckte lateinische Texte Enarrationes Martini Lutheri in Epistolas D. Petri duas, et Iudae unam. Straßburg: Johann Herwagen, 1524 (VD 16 L 4599; Bucer-Bibliographie 5) Auch in: [Augsburg: Simprecht Ruff] 1525 (VD 16 L 4600; Bucer-Bibliographie 10). Bucer bezeichnet sich in seiner Vorrede als Übersetzer. Ediert in WA 12 Umfang: 320 Seiten 2008 vorgesehener Editor: Thomas Kaufmann Apologia ... qua fidei suae atque doctrinae, circa Christi Caenam ... [Straßburg: Johann Herwagen d.Ä.] 1526 (VD 16 B 8848; Bucer-Bibliographie 21) Umfang: 72 Seiten 2008 vorgesehener Editor: Reinhold Friedrich Enarrationum in evangelia Matthaei, Marci, et Lucae libri duo, Straßburg: [Johann Herwagen] 1527 (VD 16 B 8871; Bucer-Bibliographie 22, 1. Teil) Auch in: Enarrationes perpetuae in sacra quatuor evangelia..., Straßburg: Georg Ulricher, 1530 (VD 16 B 8872; Bucer-Bibliographie 39); In sacra quatuor evangelia