Einfach in Sie Eintreten: Biologie in Mittelerde
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
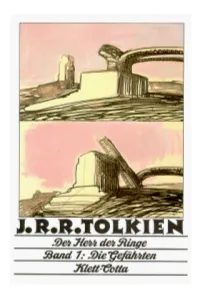
Der Herr Der Ringe Band 1: Die Gefährten
DER HERR DER RINGE BAND I Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht, Sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein, Den Sterblichen, ewig dem Tode verfallen, neun, Einer dem Dunklen Herrn auf dunklem Thron Im Lande Mordor, wo die Schatten dröhn. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, Ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden Im Lande Mordor, wo die Schatten dröhn. VORWORT Diese Erzählung wuchs und wuchs, während ich sie erzählte, bis sie zur Geschichte des Großen Ringkrieges wurde, in der immer wieder die noch ältere Geschichte flüchtig auftauchte. Ich hatte damit begonnen, kurz nachdem Der Hobbit geschrieben und noch ehe das Buch 1937 erschienen war; aber dann fuhr ich mit der Erzählung nicht fort, denn zuerst wollte ich die Mythologie und Legenden der Altvorderenzeit, die damals schon seit einigen Jahren Gestalt angenommen hatten, vervollständigen und ordnen. Das wollte ich gern zu meiner eigenen Freude tun, und ich hatte wenig Hoffnung, daß andere Leute sich für diese Arbeit interessieren würden, zumal sie in erster Linie sprachwissenschaftlich inspiriert war und ursprünglich darauf zielte, den notwendigen »geschichtlichen« Hin- tergrund für die Elbensprachen zu schaffen. Als jene, die ich um Rat und ihre Meinung befragte, mich berichtigten, daß nicht wenig Hoffnung, sondern gar keine Hoffnung bestünde, nahm ich dann die Erzählung wieder auf, ermutigt durch die Bitten von Lesern, ihnen mehr über Hobbits und ihre Abenteuer zu sagen. Aber die Dar- stellung wurde unwiderstehlich zur älteren Welt hingezogen und wurde gleichsam zu einem Bericht über deren Ende und Vergehen, bevor ihr Be- ginn und die Zwischenzeit erzählt waren. -

To JRR Tolkien In
Volume 18 Number 3 Article 7 Summer 7-15-1992 Index to J.R.R. Tolkien in Mythlore Issues 1-69 Trevor Reynolds Follow this and additional works at: https://dc.swosu.edu/mythlore Part of the Children's and Young Adult Literature Commons Recommended Citation Reynolds, Trevor (1992) "Index to J.R.R. Tolkien in Mythlore Issues 1-69," Mythlore: A Journal of J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Charles Williams, and Mythopoeic Literature: Vol. 18 : No. 3 , Article 7. Available at: https://dc.swosu.edu/mythlore/vol18/iss3/7 This Article is brought to you for free and open access by the Mythopoeic Society at SWOSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Mythlore: A Journal of J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Charles Williams, and Mythopoeic Literature by an authorized editor of SWOSU Digital Commons. An ADA compliant document is available upon request. For more information, please contact [email protected]. To join the Mythopoeic Society go to: http://www.mythsoc.org/join.htm Mythcon 51: A VIRTUAL “HALFLING” MYTHCON July 31 - August 1, 2021 (Saturday and Sunday) http://www.mythsoc.org/mythcon/mythcon-51.htm Mythcon 52: The Mythic, the Fantastic, and the Alien Albuquerque, New Mexico; July 29 - August 1, 2022 http://www.mythsoc.org/mythcon/mythcon-52.htm Abstract Subject index to articles and book reviews related primarily or substantially to Tolkien. Additional Keywords Mythlore—Indexes; Tolkien, J.R.R.—Bibliography This article is available in Mythlore: A Journal of J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Charles Williams, and Mythopoeic Literature: https://dc.swosu.edu/mythlore/vol18/iss3/7 Page 70 Issue 69 - Sumn>eRl992 CPyTHLORe lodge to J.RJR. -

9783608964028.Pdf
TolkienSCHÖPFER VON MITTELERDE TolkienSCHÖPFER VON MITTELERDE Catherine McIlwaine Aus dem Englischen übersetzt von Helmut W. Pesch und Marcel Aubron-Bülles Hobbit Presse www.klett-cotta.de/hobbitpresse Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Tolkien: Maker of Middle-earth« im Verlag der Bodleian Library, University of Oxford, Oxford 2018. Einführende Texte © 2018 bei den Autoren. Katalogtexte © 2018 Bodleian Library, Universität Oxford. und ›Tolkien‹® sind eingetragene Markenzeichen der Tolkien Estate Limited. Managing Editor: Deborah Susman. Project Editor: Emily Brand. Herstellung: Nicola Denny. Design: Dot Little an der Bodleian Library. Für die deutsche Ausgabe Hinweis für den Leser © 2018 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart Bei den Katalogeinträgen ist als Autor Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten Gedruckt und gebunden von Great Wall Printing Co. Ltd, oder Künstler, falls nicht anders Hongkong auf 140 g Neo matt art Papier. angegeben, J.R.R. Tolkien anzunehmen © Umschlaggestaltung VH-7 Medienküche GmbH Unter Verwendung der Originalausgabe (mit Ausnahme der Familienfotos Gesetzt von VH-7 Medienküche GmbH und der Katalognummern 15a–d, 21, ISBN 978-3-608-96402-8 24, 84, 125–127, 132). Wo ein Datum Zitate sowie Bilder von Manuskripten und Zeichnungen aus Tolkiens veröffentlichten Werken unterliegen dem in eckigen Klammern steht, ist das Copyright von The Tolkien Estate Limited und The Tolkien Objekt nicht datiert, das Datum jedoch Trust, wie in den jeweiligen Publikationen vermerkt. Zitate aus Tolkiens bisher unveröffentlichten Werken sind gesichert, sofern kein Fragezeichen © The Tolkien Estate Limited 2018. Zuvor unveröffentlichte oder »c.« notiert ist. Wenn nicht Bilder von Manuskripten und Zeichnungen Tolkiens sind © The Tolkien Estate Limited/The Tolkien Trust 2018. -

CZ Professor Tolkien Geht Zur Kirche
PROFESSOR TOLKIEN GEHT ZUR KIRCHE Christopher Zimmer PROFESSOR TOLKIEN GEHT ZUR KIRCHE UND ERFINDET SICH MITTELERDE MIT WISSENSCHAFTLICHER AKRIBIE Zum 125. Geburtstag von J.R.R. Tolkien am 3. Januar 2017 2014 wurde ich von der Volkshochschule beider Basel und dem Forum für Zeit- fragen eingeladen, im Rahmen einer Kursreihe zu ‹Populäre Literatur und Reli- gion› einen Vortrag mit anschliessender Diskussion zu Tolkiens Der Herr der Ringe zu halten. Weitere Abende von anderen Angefragten sollte es zu Karl Mays Winnetou, zu Dan Browns Sakrileg und Paulo Coelhos Der Alchimist geben. Die Kursreihe kam zwar leider nicht zustande, doch war sie für mich ein willkomme- ner Anlass, mich noch einmal so intensiv wie nostalgisch mit Tolkien zu befassen. Daraus entstand dieser nie gehaltene Vortrag, den ich nun leicht bearbeitet vor- lege, «als Einführung für Uneingeweihte und kleine Erinnerungsstütze für die Wissenden». Ein Leben in Mittelerde. Der Herr der Ringe kann mit Fug und Recht als Kult- buch bezeichnet werden. «Kaum ein anderes Buch hat so viele Menschen begei- stert wie dieser zum Fantasy-Klassiker avancierte Bestseller, dessen epische Handlung das seit der Antike in unterschiedlichsten Spielarten abgewandelte Motiv des Kampfes zwischen Gut und Böse thematisiert. In Tolkiens Werk findet man alles, was die Fantasy-Literaturgattung geprägt hat: Zauberer, Elfen [wobei man hier korrekterweise von Elben sprechen sollte, Anm. CZ], Zwerge, Drachen, Mythen und Legenden sowie das Thema der Suche (der Queste), der Freundschaft und des Edelmuts.»1 Mit geschätzten 200 Millionen verkauften Büchern (aufgrund der vielen Raub- kopien kann man diese Zahl nur schätzen) «liegt die Herr der Ringe-Saga in den Top 10 der meist gelesenen Bücher der Menschheit, direkt nach der Bibel, dem roten Buch von Mao, dem Koran und dem chinesischen Wörterbuch»2 – wobei bemerkenswert ist, dass mit Harry Potter inzwischen ein weiteres Werk der Gat- tung Fantasy in diese illustre Gesellschaft aufgestiegen ist, was nicht nur den neuen Verbreitungsmöglichkeiten des digitalen Zeitalters zu verdanken ist. -

Vorwort Von Den Kleinen Leuten 7 Bibliografi Sche Information Vorwort Der Deutschen Nationalbibliothek
Vorwort Von den kleinen Leuten 7 Bibliografi sche Information Vorwort der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbbliothek verzeichnet diese eschichten von Kleinen Leuten, wie die in diesem Kurzgeschichtenband, Publikation in der Deutschen Nationalbibliografi e; sind auf den ersten Blick phantastische Berichte, die Erstaunliches aus detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet G Welten der Fantasie und Imagination berichten. Doch wie alle Phantastik über http://dnb.ddb.de abrufbar. behandeln sie doch »nur«, was ihre menschlichen Erzählerinnen und deren Publikum bewegt. Kleine Leute sind deshalb, trotz ihrer oft unmenschlich ISBN: 978-3–932683–13–8 kleinen Erscheinungsform, doch nur »Menschen wie Du und ich«: kleine Leute eben, die uns unterhalten, uns einen Spiegel vorhalten oder uns als ISSN 1860–9252 Vorbild oder Warnung dienen und dabei doch immer auf uns zurückver- weisen, so dass wir von ihnen lernen können. 20,00 Euro Vor zwei Jahren erschien in diesem Verlag eine Anthologie mit Geschichten, die in Mittelerde spielen, jener Welt, die uns Tolkien schenkte und die Mil- lionen von Menschen in ihren Bann zieht. Einige der Texte in jenem Buch beschäftigen sich mit den »kleinen« Leuten in Tolkiens Welt, besonders den Hobbits. Die Reaktion darauf veranlasste uns, zu einer Anthologie aufzu- rufen, in der es speziell um die kleinen Varianten der Humanoiden gehen sollte, und zwar keineswegs nur in Tolkiens Kosmos, sondern allgemein, in Märchen, Sagen und Legenden, in den Welten, die andere Autoren und Autorinnen geschaffen hatten, aber auch in ganz eigenen Entwürfen und nicht zuletzt in Bezug auf unsere ganz reale Welt. Denn »kleine Leute« sind eben nicht nur Halblinge und Zwerge. -

Der Herr Der Ringe
Der Herr der Ringe Sonderausgabe Bearbeitet von J.R.R. Tolkien, Wolfgang Krege 1. Auflage 2015. Taschenbuch. 1543 S. Paperback ISBN 978 3 608 96089 1 Format (B x L): 13,5 x 21,5 cm Gewicht: 1190 g schnell und portofrei erhältlich bei Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte. Dies ist eine Leseprobe der Hobbit Presse. Dieses Buch und unser gesamtes Programm finden Sie unter www.hobbitpresse.de J.R.R. TOLKIEN DER HERR DER RINGE Erster Teil: DIE GEFÄHRTEN Aus dem Englischen übersetzt von Wolfgang Krege KLETT-COTTA DER HERRሀ DER RINGE Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht, Sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein, Den Sterblichen, ewig dem Tode verfallen, neun, Einer dem Dunklen Herrn auf dunklem Thron Im Lande Mordor, wo die Schatten drohn. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, Ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden Im Lande Mordor, wo die Schatten drohn. ERSTESሀ KAPITEL EIN LANGERWARTETES FEST ls Herr Bilbo Beutlin von Beutelsend ankündigte, dass er seinen A bevorstehenden einundelfzigsten Geburtstag mit einem rau- schenden Fest zu feiern gedenke, begann in Hobbingen ein erregtes Getuschel. Bilbo war sehr reich und sehr eigensinnig, und seit seinem auffäl- ligen Verschwinden und seiner unerwarteten Rückkehr vor sechzig Jahren hatte man im Auenland nicht aufgehört, sich über ihn zu wundern. -
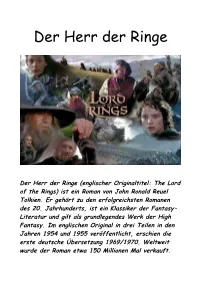
Der Herr Der Ringe
Der Herr der Ringe Der Herr der Ringe (englischer Originaltitel: The Lord of the Rings) ist ein Roman von John Ronald Reuel Tolkien. Er gehört zu den erfolgreichsten Romanen des 20. Jahrhunderts, ist ein Klassiker der Fantasy- Literatur und gilt als grundlegendes Werk der High Fantasy. Im englischen Original in drei Teilen in den Jahren 1954 und 1955 veröffentlicht, erschien die erste deutsche Übersetzung 1969/1970. Weltweit wurde der Roman etwa 150 Millionen Mal verkauft. Die Personen aus Teil 1 Frodo ist die Hauptfigur von Der Herr der Ringe Teil 1 . Der junge Hobbit Frodo erhält an seinem 33. Geburtstag den "Einen Ring" von Bilbo und macht sich 18 Jahre später auf den Weg, ihn zu zerstören . Sam Weiß Gamdschi ist die zweite Hauptfigur von Der Herr der Ringe Teil1. Von Bilbo lernt Sam Lesen und Schreiben. Als er darum bittet, seinen Freund Frodo auf dessen Reise nach Bruchtal begleiten zu dürfen, ist seine Begründung, dass er unbedingt Elben sehen wolle, von denen er schon so viel gehört habe. Peregrin Tuk, von seinen Freunden schlicht Pippin genannt, ist der Sohn von Paladin Tuk, dem 31. Thain des Auenlandes und Heiderose Tuk. Pippin wohnt in Weißbrunn. Er heiratet Juweline From the Long Cleves. Seinen Sohn nannte er Faramir, dieser heiratete Sams Tochter Goldlöckchen. Aufgrund seiner großen Neugier und Tollpatschigkeit gerät Pippin oft in gefährliche Situationen. Meriadoc Brandybock, schlicht Merry genannt (weshalb nicht selten vergessen wurde, dass er eigentlich Meriadoc hieß), war der Sohn von Saradoc Brandybock und Esmeralda, einer Schwester von Peregrin Tuks Vater Paladin. Als Sohn eines Herrn von Bockland lebte er im Brandygut zu Bockenburg in Bockland. -

Tolkien Bibliography
Tolkien Bibliography This bibliography includes those entries in the MLA bibliography that contain the word “Tolkien”. Since the full title of Mythlore is Mythlore: A Journal of J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, Charles Williams, and the Genres of Myth and Fantasy Studies and of Mallorn is Mallorn: The Journal of the Tolkien Society some of these titles are not about Tolkien. Still, it may be useful to have it. Aadnanes, Per M. "Diktekunsten og eventyrlandet." Edda (1977): 227-35. Abbott, Joe. "Tolkien's Monsters: Concept and Function in The Lord of the Rings (Part 1): The Balrog of Khazad-dum." Mythlore 16.1 (59) (1989): 19-26. ---. "Tolkien's Monsters: Concept and Function in The Lord of the Rings, II: Shelob the Great; III: Sauron." Mythlore 16.2 (60) (1989): 40-47. Adderley, C.M. "Preliminary Matters: The Neglected Preludes to Charles Williams' Arthuriad." Mythlore 21.1 (79) (1995): 23-28. ---. "Meeting Morgan le Fay: J. R. R. Tolkien's Theory of Subcreation and the Secondary World of Sir Gawain and the Green Knight." Mythlore 22.4 (86) (2000): 48-58. Agoy, Nils Ivar. "Mr. Bliss: The Precursor of a Precursor." Mallorn 20 (Sept. 1983): 25-27. ---. "Tolkien in Norway." Inklings: Jahrbuch für Literatur and Ästhetik. 3 (1985): 159-67. ---. "Quid Hinieldus cum Christo? New Perspectives on Tolkien's Theological Dilemma and His Sub-Creation Theory." Mythlore 33.2 (80) (1996): 31-38. Aldrich, Kevin. "The Sense of Time in J. R. R. Tolkien's The Lord of the Rings." Mythlore 15.1 (55) (1988): 5-9. Algeo, John. -

Frodo, Ein Außergew¨Ohnlicher Held
Universitat¨ Bielefeld Fakultat¨ fur¨ Padagogik,¨ Seminar: Strukturale Filmanalyse - Der Herr der Ringe Veranstalter: Dr. Thomas Walden WS 2006/07 Frodo, ein außergewohnlicher¨ Held; Die Wirkung der Figur Frodo auf den Zuschauer vorgelegt von: Viktor Fast 1. Semester Erziehungswissenschaft MA (GHR) E-mail: [email protected] 22. Februar 2007 Vorwort Die folgende Arbeit ist im Rahmen des Padagogikstudiums¨ als Fallstudie im Profil Medien angefertigt. Grundlage der Untersuchung bildet die Extended Edition des Films Der Herr der Ringe. An dieser Stelle mochte¨ ich mich fur¨ die engagierte Betreuung bei Dr. Thomas Walden bedanken. Inhaltsverzeichnis Einleitung 1 1 Ein Held mit Schwachen¨ 2 1.1 Frodos erste Heldenfahrt . 3 1.2 Frodos zweite Heldenfahrt . 5 1.3 Frodos dritte Heldenfahrt . 10 1.4 Zusammenfassung . 12 2 Frodos Wirkung auf den Rezipienten 15 3 Fazit 19 Literatur 20 I Einleitung Frodo, ein Held? Ich muss mal was zu Frodo sagen. Ich finde es naturlich¨ toll, dass er den Ring vernichtet beziehungsweise hilft ihn zu vernichten, 1 aber ich finde nicht, dass er ein Held ist. [...] Wieso ist Frodo ein Held?? Er hat nichtmal den Ring zerstort!¨ Harry hat 2 sich schon mehrere Male seinem argsten¨ Gegner gestellt! Diese Aussagen aus Herr-der-Ringe-Foren spiegeln sicherlich den Eindruck vieler Zuschauer des Films wider. Obwohl Frodo die zentrale Figur des Films ist und die entscheidenden Handlungen zur Rettung Mittelerdes vornimmt, wirkt er nicht wie ein Held. Dieser Eindruck entsteht dadurch, dass Frodo in vielen Punkten vom gewohn- ten Heldenschema abweicht. Dass ein Held in mythischen Geschichten einem bestimmten Schema entsprechen muss, bewies Campbell in seinem Werk Der Heros in tausend Gestalten, in dem er alle mythologischen Geschichten verschiedener Lander¨ auf ein Schema zuruckf¨ uhrte¨ [CAMPBELL 1986, S. -

Die Entstehung Der Welt - Arda
Die Entstehung der Welt - Arda Am Anfang erschuf Eru (Illuvatar; "Der Eine") die Ainur (Valar und Maiar) durch seine Gedanken. Den Ainur gab er dann drei Themen vor und sie spielten Musik dazu. Anhand dieser Musik erbaute Eru dann Arda. In dieser Musik wurden die Elben und Menschen die sog. "Kinder Illuvatars" angekündigt. 15 der Ainur (Die Valar) stiegen auf Arda hinab, um sie für die Elben und Menschen zu formen und vorzubereiten. Allerdings mußten sich diese Ainur verpflichten ihre Kräfte auf Arda zu beschränken und dort zu bleiben bis das Ende der Welt kommt. Mit den Valar stiegen auch viele Maiar hinab. Jedoch bald spalteten sie sich in zwei Lager. Der stärkste Valar namens Melkor (später Morgoth genannt) wollte eine Welt voller Extreme und Gegensätze und somit auch lebensfeindlich für die Elben und Menschen. Manwe dagegen wollte eine milde und mäßige Welt erschaffen. Durch sein egoistisches und aggressives Auftreten brachte Melkor die anderen Valar gegen sich auf, aber einige der Maiar (u.a. auch Sauron) folgten ihm. Für eine unermeßlich lange Zeit tobte der Kampf und keine Seite konnte über die andere siegen. Daher hat das Aussehen der Welt von beidem etwas; das Extreme und das Mäßige. Schließlich zog sich Melkor mit seiner Schar in den tiefen Norden in eine unterirdische Festung zurück und die anderen Valar und Maiar gingen in den Westen nach Aman. Es blieb noch ein Kontinent in der Mitte, Mittelerde (Endor) genannt, wo beide Seiten ihre Einflüsse hatten. Das erste Zeitalter der Sonne Dieses Zeitalter -Altvorderenzeit- hat viel länger gedauert, als die Geschichtsschreibung geht. Es ist manchmal die Rede von mehreren zehntausenden von Jahren. -

Tolkien and the Viking Heritage“
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Tolkien and the Viking Heritage“ verfasst von Sophie Hinger angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2014 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 190 344 313 Studienrichtung lt. Studienblatt: Lehramtsstudium UF Englisch UF Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung Betreut von: Univ.-Prof. Dr. Werner Huber Acknowledgements I would like to say thank you to all those people without whom the writing of this thesis would not have been possible. First and foremost, I would like to express my gratitude to Prof. Dr. Werner Huber for agreeing to supervise my diploma thesis and accepting the topic. I am thankful for his support during the writing process and his valuable feedback. I would also like to thank Prof. Christina Lee of the University of Nottingham for giving me the idea for thesis with her interesting lecture on the Viking World. Thank you to my mum for lending me her flip chart to organise my thoughts and for proofreading this thesis. Thank you to both my parents for supporting me throughout my studies and allowing me the time I needed to finish them. I also owe them my gratitude for introducing me to Tolkien’s books at an early age and thus kindling my enthusiasm for them. Special thanks to my sister, brother and cousins for never letting this enthusiasm weaken. Thank you for showing me that I can still enjoy The Lord of the Rings after writing this thesis. Table of Contents 1. Introduction ................................................................................................. 3 2. Background ................................................................................................. 5 2.1. J.R.R. Tolkien ......................................................................................... 5 2.1.1. Biography ........................................................................................ -

Der Herr Der Ringe Und Die Philosophie
Der Herr der Ringe und die Philosophie Klüger werden mit dem beliebtesten Buch der Welt Herausgegeben von Gregory Bassham und Eric Bronson Aus dem Amerikanischen von Susanne Held Klett-Cotta hhdrphilosophie_kern.indddrphilosophie_kern.indd 3 330.06.090.06.09 119:059:05 Diese deutsche Ausgabe gibt eine gekürzte Fassung des amerikanischen Originals wieder. Klett-Cotta www.klett-cotta.de Die Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel »The Lord of the Rings and Philosophy« im Verlag Open Court, Chicago and La Salle, Illinois Copyright © by Carus Publishing Für die deutsche Ausgabe © J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart 2009 Fotomechanische Wiedergabe nur mit Genehmigung des Verlags Printed in Germany Umschlag: Klett-Cotta Design Unter Verwendung einer Illustration von Katja Wesner, Fellbach Gesetzt in den Topen Studios, Leipzig Auf säure- und holzfreiem Werkdruckpapier gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck ISBN 978-3-608-93879-1 hhdrphilosophie_kern.indddrphilosophie_kern.indd 4 330.06.090.06.09 119:059:05 Inhalt Vorwort – Die Weisheit von Mittelerde 9 Abkürzungen 13 Teil I Der Ring Die Ringe von Tolkien und Platon: Über Macht, Moral und Wahl 17 Eric Katz Die Schicksalsklüfte: Tolkiens Ringe der Macht und die Bedrohung durch neue Technologien 43 Theodore Schick »Mein Schatz«: Tolkiens Ring als Fetisch 62 Alison Milbank Teil II Die Suche nach Glück Tolkiens sechs Schlüssel zum Glück 83 Gregory Bassham hhdrphilosophie_kern.indddrphilosophie_kern.indd 5 330.06.090.06.09 119:059:05 »Lebwohl Lórien«: Von der Freude und ihren Grenzen bei Existentialisten und Elben 102 Eric Bronson Teil III Gut und Böse in Mittelerde Überhobbits? Tolkien, Nietzsche und der Wille zur Macht 125 Douglas K.