Bachelorarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Niedersächsischer Fußballverband Ev
Niedersächsischer Fußballverband e.V. Ausschreibung für den Spielbetrieb des Spieljahres 2016/17 der Oberliga Niedersachsen (Gültig ab 01.07.2016) Für die Durchführung der Spiele haben nur die Ordnungen und Satzung des NFV, des DFB und diese Ausschreibung Gültigkeit. 1. Mannschaftsbeiträge und andere Zahlungen 1.1. Nach § 12 (2) b) FiWO erhebt der Verband für jede gemeldete Mannschaft einen jährlichen Mannschaftsbeitrag. Die Höhe der Beiträge beschließt der Verbandstag. 1.2. Nach § 13 m) der Verbandssatzung ist dem Verband eine Einzugsermächtigung zur Durchführung eines Lastschriftverfahrens für fällige Gebühren, Beiträge und sonstige Forderungen zu erteilen. 2. Meisterschaft, Auf- und Abstieg, Zuordnung 2.1. Niedersachsenmeister & Aufstieg zur Regionalliga Nord 2.1.1. Der Meister der Oberliga Niedersachsen ist Niedersachsenmeister. 2.1.2. Maßgeblich für den Aufstieg in die Regionalliga Nord sind die Vorgaben des Norddeutschen Fußballverbandes. 2.1.3. Der Niedersachsenmeister steigt in die Regionalliga Nord auf. Sollte er nicht zum Aufstieg berechtigt sein, steigt die nächstplatzierte aufstiegsberechtigte Mannschaft in die Regionalliga Nord auf. 2.1.4. Der Zweitplatzierte qualifiziert sich für die Relegation mit den Vertretern aus Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Sollte der Zweitplatzierte nicht aufstiegsberechtigt sein, geht das Recht zur Teilnahme an der Relegation an die nächstplatzierte aufstiegsberechtigte Mannschaft über. 2.2. Abstieg aus der Regionalliga Aus der Regionalliga Nord steigen grundsätzlich 3 Mannschaften in die für sie zuständigen Landesverbände ab. 2.3. Abstieg aus der Oberligen Niedersachsen 2.3.1. Die Sollzahl der Oberliga Niedersachsen (OLN) beträgt 16 Mannschaften. 2.3.2. Am Ende des Spieljahres 2016/17 steigen die Mannschaften ab Tabellenplatz 13 in die räumlich für sie zuständigen Bezirke ab. -

Fussballmagazin 17 2012
NSP Seite 41 FussballMagazin 17 2012 Viktoria Lübeck gewinnt Qualifikationsturnier zum Metropol-Cup Titelstory 2012 vor der Kulisse des | „Circus Olympia“, der gera- Der Wettergott war ein de in Tangstedt neben dem Morgenmuffel und der Minispielfeld gastierte. So Fußballgöttin des Turniers kamen zu den angereisten zunächst nicht gewogen. Zuschauern noch Pferde Das diesjährige Qualifikati- und Dromedare des Circus onsturnier zum Metropol- und bildeten zusammen ei- region-Hamburg Cup be- ne eindrucksvolle und un- gann am Dienstag, d. 24. gewöhnliche Kulisse für das April, wie das letztjährige Turnier. So manches Ball- endete: Es regnete in Strö- holen gestaltete sich für men. Doch die Organisato- den einen oder die andere ren und vor allem die Spie- dann auch zu einer kleinen lerinnen der angereisten Mutprobe. sieben Mannschaften lie- Angesichts dieses Anbli- DasTeamdes vom SVViktoria 08 Lübeck freut sich über den Sieg ßen sich davon noch beir- ckes und der Begeisterung, und 300 € Prämie. ren. Begrüßt wurden die die die Mädchen und die Mannschaften vom Vertre- Zuschauer zeigten, er- in Lüneburg. Am Ende be- € Preisgeld gestiftet von der ter der Unfallkasse Nord, barmte sich das Wetter und legte der SV Viktoria 08 Lü- Unfallkasse Nord. Turnier- Frank Alster, und von Klaus es wurde nach den ersten beck 2 den vierten Platz. sieger der schleswig-hol- Moseleit von der Metropol- Spielen trocken. Das Spiel Den dritten Platz errangen steinischen Qualifikation region Hamburg, den Tur- der Mannschaften schien die Spielerinnen des Koper- wurde das Team 1 vom SV nierpartnern des Wettbe- dem Wettergott dann so ge- nikus Gymnasium Bargte- Viktoria 08 Lübeck. Die werbs. Dann kam der An- fallen zu haben, dass sich heide und konnten sich zu- Mannschaft erhielt eben- pfiff und die Spielerinnen schließlich sogar die Sonne sätzlich zur Qualifikation falls einen Pokal und 300 € spielten munter drauf los zur Siegerinnenehrung über einen Pokal und 100 € Preisgeld. -

Silversports Football Odds
SILVERSPORTS Football Odds - Saturday, October 02, 2021 Last updated at 02 October 2021 15:30 (ODDS ARE INDICATIVE ONLY) Full Time Half Time First Team Both Team Under 2.5 / Double 90min 45min To Score To Score Over 2.5 Chance Time Match Code Home Draw Away Code Home Draw Away Code Home Away No Goal Code Yes No Code Under 2.5Over 2.5 Code H/D H/A A/D Saturday, 02 October Argentina: Primera B 19:10 CA San Miguel v CA Colegiales 19400 350 253 227 24695 432 178 304 24692 200 161 24704 136 216 19401 135 124 118 22:00 Club Atletico Acassuso v Sacachispas FC 19403 246 249 319 24709 325 177 401 24706 198 162 24718 135 217 19404 120 125 130 22:00 Comunicaciones v CA Villa San Carlos 19406 228 252 351 24723 303 179 430 24720 198 163 24732 137 214 19407 117 124 134 22:00 Canuelas FC v Justo Jose de Urquiza 19409 232 264 322 24737 311 181 406 24734 194 166 24746 140 206 19410 120 122 133 22:30 CA Talleres de Remedios v Club Atletico Fenix 19412 222 266 340 24751 303 179 428 24748 199 162 24760 138 210 19413 118 122 136 Argentina: Primera C 22:00 CA Claypole v Deportivo Espanol 24922 262 248 298 24931 354 171 392 24930 212 154 24924 130 233 24927 122 125 127 Argentina: Primera Nacional 18:30 Barracas Central v CA All Boys 10722 214 260 373 10732 292 178 457 10731 175 242 645 10730 203 159 10724 136 215 10727 116 123 138 22:00 CA Chacarita Juniors v CD Maipu 18550 243 260 308 18560 334 174 405 18559 191 220 623 18558 208 156 18552 133 224 18555 121 123 131 23:00 Guillermo Brown v Tristan Suarez 23564 284 249 272 23574 367 176 355 23573 207 202 623 -

England Top Leagues 2018 - 2019
England Top Leagues 2018 - 2019 England - Premier League 2018/19 England - Championship 2018/19 P T Team PL W D L GH W D L GA W D L GT PT Last RES P T Team PL W D L GH W D L GA W D L GT PT Last RES 1 ● MAN CITY 9 7 2 0 26:3 5 0 0 18:2 2 2 0 8:1 23 Champions L.. W D W 1 ● LEEDS 14 7 5 2 25:11 4 2 1 12:4 3 3 1 13:7 26 Promotion W L D 2 ▲ LIVERPOOL 9 7 2 0 16:3 3 1 0 8:0 4 1 0 8:3 23 Champions L.. W D D 2 ● MIDDLESBROUGH 14 7 5 2 16:7 4 2 1 7:2 3 3 1 9:5 26 Promotion D W L 3 ▼ CHELSEA 9 6 3 0 20:7 3 2 0 12:6 3 1 0 8:1 21 Champions L.. D W D 3 ● SHEFF UTD 14 8 2 4 23:16 4 2 1 12:7 4 0 3 11:9 26 Prom Poffs D L W 4 ● ARSENAL 9 7 0 2 22:11 4 0 1 10:4 3 0 1 12:7 21 Champions L.. W W W 4 ● WEST BROM 14 7 3 4 32:22 5 0 2 21:11 2 3 2 11:11 24 Prom Poffs L L W 5 ● TOTTENHAM 9 7 0 2 16:7 2 0 1 5:3 5 0 1 11:4 21 Europa Lea. -

Niedersächsischer Fußballverband Ev Ausschreibung Für Den
Niedersächsischer Fußballverband e.V. Ausschreibung für den Spielbetrieb des Spieljahres 2015/16 der Oberliga Niedersachsen (Gültig ab 01.07.2015) Für die Durchführung der Spiele haben nur die Ordnungen und Satzung des NFV, des DFB und diese Ausschreibung Gültigkeit. 1. Mannschaftsbeiträge und andere Zahlungen 1.1. Nach § 12 (2) b) FiWO erhebt der Verband für jede gemeldete Mannschaft einen jährlichen Mannschaftsbeitrag. Die Höhe der Beiträge beschließt der Verbandstag. 1.2. Nach § 13 m) der Verbandssatzung ist dem Verband eine Einzugsermächtigung zur Durchführung eines Lastschriftverfahrens für fällige Gebühren, Beiträge und sonstige Forderungen zu erteilen. 2. Meisterschaft, Auf- und Abstieg, Zuordnung 2.1. Niedersachsenmeister & Aufstieg zur Regionalliga Nord 2.1.1. Der Meister der Oberliga Niedersachsen ist Niedersachsenmeister. 2.1.2. Maßgeblich für den Aufstieg in die Regionalliga Nord sind die Vorgaben des Norddeutschen Fußballverbandes. 2.1.3. Der Niedersachsenmeister steigt in die Regionalliga Nord auf. Sollte er nicht zum Aufstieg berechtigt sein, steigt die nächstplatzierte aufstiegsberechtigte Mannschaft in die Regionalliga Nord auf. 2.1.4. Der Zweitplatzierte qualifiziert sich für die Relegation mit den Vertretern aus Bremen, Hamburg und Schleswig Holstein. Sollte der Zweitplatzierte nicht aufstiegsberechtigt sein, geht das Recht zur Teilnahme an der Relegation an die nächstplatzierte aufstiegsberechtigte Mannschaft über. 2.2. Abstieg aus der Regionalliga Aus der Regionalliga Nord steigen 3 Mannschaften in die für sie zuständigen Landesverbände ab. 2.3. Abstieg aus der Oberligen Niedersachsen 2.3.1. Die Sollzahl der Oberliga Niedersachsen (OLN) beträgt 16 Mannschaften. 2.3.2. Am Ende des Spieljahres 2015/16 steigen die Mannschaften ab Tabellenplatz 13 in die räumlich für sie zuständigen Bezirke ab. -

HSG Augustdorf / Hövelhof HSG Augustdorf / Hövelhof
1 In einem Ambiente zum Wohlfühlen bieten wir unseren Gästen in zahlreichen Centern innovatives Entertainment vom Feinsten. Dart, Touc h-Screen und Internet-Terminals gehören ebenso zu unserem Angebot wie die neuesten Geldspielgeräte. Lindau, Königsberger Str. 4 Spielteilnahme ab 18 Jahren. Übermäßiges Spiel ist keine Lösung bei persönlichen Problemen! Beratung / Info Tel. 0800/ 1372700 kostenlos). M 5_90x122_HSG 2 3 Herzlich willkommen zum 33. Flippo-Silvestercup! Allen Zuschauern und Spielern wünschen wir, die Vorstände von HSG Rhumetal und vom HSG-Förderverein, ein gesundes neues Jahr 2017, verbunden mit einem herzlichen Willkommensgruß zum diesjährigen Flippo-Silvestercup! Wir als Veranstalter hoffen auf zwei tolle Handballtage mit spannenden, attraktiven und fairen Be- gegnungen! Wie in den letzten Jahren wird unser Turnier wieder in zwei Leistungsklassen unterteilt, die an zwei unterschiedlichen Ta- gen spielen werden. Am Sonnabend spielen neben unserem Ver- bandsligateam Mannschaften aus vier verschiedenen Oberligen. Besonders freuen wir uns aber, dass wir auch ein namhaftes Spit- zenteam aus der Jugendhandball-Bundesliga zu einer Teilnahme an unserem traditionsreichen Turnier bewegen konnten. Das erste Spiel im A-Turnier unseres Flippo-Silvestercupswird am Samstag um 12.00 Uhr beginnen. Hier sind mit dem Titelverteidiger MT Melsungen 2 (Oberliga Hessen), der HG 85 Köthen (Mitteldeut- sche Oberliga), derHSG Augustdorf/Hövelhof (Oberliga Westfalen), dem TV Jahn Duderstadt (Oberliga Niedersachsen) und der 1. Mannschaft unserer HSG Rhumetal fünf überaus interessante Mannschaften am Start. Als sechstes Team komplettiert die Bun- desliga-A-Jugend der Füchse Berlin das Teilnehmerfeld. Die Gruppenauslosung ergab folgende Gruppeneinteilung: In der Gruppe 1 spielen die HSG Rhumetal, der TV Jahn Duderstadt und die HG 85 Köthen. -

NBV-Ausschreibung Spielzeit 2021-2022
Ausschreibung für die Spielzeit 2021/2022 Inhaltsverzeichnis Präambel ...................................................................................................................................................................... 2 1. Ausschreibungen ............................................................................................................................................... 2 2. Spielregeln ......................................................................................................................................................... 2 3. Teilnahmeberechtigungen ................................................................................................................................ 2 4. Meldungen ........................................................................................................................................................ 2 5. Meldetermine .................................................................................................................................................... 3 6. Meldegelder ...................................................................................................................................................... 3 7. Schiedsrichter .................................................................................................................................................... 4 8. Spieltermine ..................................................................................................................................................... -

England Top Leagues 2018 - 2019
England Top Leagues 2018 - 2019 England - Premier League 2018/19 England - Championship 2018/19 P T Team PL W D L GH W D L GA W D L GT PT Last RES P T Team PL W D L GH W D L GA W D L GT PT Last RES 1 ● MAN CITY 13 11 2 0 40:5 7 0 0 27:4 4 2 0 13:1 35 Champions L.. W W W 1 ● NORWICH 19 11 4 4 32:21 6 0 3 14:12 5 4 1 18:9 37 Promotion D W W 2 ● LIVERPOOL 13 10 3 0 26:5 5 1 0 14:1 5 2 0 12:4 33 Champions L.. W W D 2 ▲ LEEDS 19 10 6 3 32:17 6 3 1 16:5 4 3 2 16:12 36 Promotion W W L 3 ● TOTTENHAM 13 10 0 3 23:11 3 0 2 8:5 7 0 1 15:6 30 Champions L.. W W W 3 ▼ MIDDLESBROUGH 19 9 8 2 22:10 5 3 1 10:3 4 5 1 12:7 35 Prom Poffs D W W 4 ● CHELSEA 13 8 4 1 28:11 4 3 0 15:7 4 1 1 13:4 28 Champions L.. L D W 4 ● WEST BROM 19 10 4 5 41:27 6 1 2 26:13 4 3 3 15:14 34 Prom Poffs W W W 5 ● ARSENAL 13 8 3 2 28:16 4 2 1 12:6 4 1 1 16:10 27 Europa Lea. -

Dpuna 31.08. Subota
Dupla Prvo Poluvreme-kraj Ukupno golova STAR BET Serbia 2 šansa poluvreme 2+ 1 X 2 1X 12 X2 1-1 X-1 X-X X-2 2-2 1 X 2 0-2 2-3 3+ 4+ 5+ 1p. Sub 17:00 3140 Dinamo Vranje 1.39 3.85 7.40 Zlatibor 1.03 1.18 2.62 - - - - - - - - - 1.82 2.00 1.81 3.20 6.40 Sub 17:00 3709 Zemun 1.72 3.15 4.60 Kolubara 1.13 1.27 1.91 - - - - - - - - - 1.68 1.98 1.97 3.65 7.70 Dupla Prvo Poluvreme-kraj Ukupno golova STAR BET Croatia 2 šansa poluvreme 2+ 1 X 2 1X 12 X2 1-1 X-1 X-X X-2 2-2 1 X 2 0-2 2-3 3+ 4+ 5+ 1p. Sub 16:00 3147 Kustošija 3.05 2.90 2.15 Rudes 1.53 1.29 1.26 5.35 7.10 4.25 5.30 3.55 3.65 1.85 2.70 3.15 1.57 1.87 2.08 4.00 7.90 Sub 16:00 3703 Solin 2.40 2.70 2.80 Cibalia 1.31 1.33 1.42 4.05 6.00 4.05 6.70 4.80 2.88 1.87 3.30 3.05 1.61 1.87 2.03 3.85 7.50 Sub 19:00 3704 Sibenik 1.70 3.05 4.50 NK Osijek II 1.12 1.26 1.90 2.70 4.50 4.55 10.0 8.00 2.22 1.95 4.50 2.90 1.68 1.87 1.91 3.50 6.70 Sub 20:00 3705Medjimurje Čakovec 2.50 2.85 2.50 Sesvete 1.38 1.30 1.38 4.30 6.10 4.20 6.10 4.30 3.10 1.86 3.10 3.05 1.60 1.87 2.04 3.85 7.60 Oba tima Oba tima daju Kombinacije Tim 1 golova Tim 2 golova Kombinacije VG STAR BET daju gol gol kombinacije golova GG GG GG1& GG1/ 1 & 2 & T1 T1 T1 T2 T2 T2 1 & 2 & 1 & 2 & 1-1& 2-2& 1-1& 2-2& 1+I& 1+I& 2+I& GG 1>2 2>1 &3+ &4+ GG2 GG2 GG GG 2+ I 2+ 3+ 2+ I 2+ 3+ 3+ 3+ 4+ 4+ 3+ 3+ 4+ 4+ 1+II 2+II 2+II 3147 Kustošij Rudes 1.86 2.40 4.25 20.0 2.38 6.90 4.70 10.0 3.15 9.50 7.30 2.28 5.60 6.00 4.05 13.0 9.75 10.0 6.60 23.0 14.0 3.00 1.95 1.82 3.45 7.70 3703 Solin Cibalia 1.80 2.35 4.00 19.0 2.30 4.90 6.00 7.70 2.38 6.10 9.25 2.80 7.90 4.50 5.45 11.0 12.0 7.70 9.00 17.0 20.0 3.00 1.95 1.78 3.35 7.30 3704 Sibenik NK Osije 1.88 2.38 3.95 19.0 2.30 3.75 9.50 5.45 1.80 3.75 13.0 4.00 14.0 2.95 9.25 6.25 21.0 4.40 17.0 8.00 50.0 2.95 1.92 1.71 3.10 6.60 3705 Medimurj Sesvete 1.80 2.35 4.05 19.0 2.30 5.30 5.30 8.50 2.60 6.90 8.50 2.60 6.90 4.90 4.70 11.0 10.0 8.00 8.00 17.0 17.0 3.00 1.95 1.78 3.35 7.40 Dupla Prvo Poluvreme-kraj Ukupno golova STAR BET Montenegro 1 šansa poluvreme 2+ 1 X 2 1X 12 X2 1-1 X-1 X-X X-2 2-2 1 X 2 0-2 2-3 3+ 4+ 5+ 1p. -
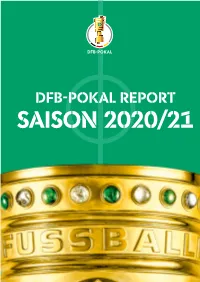
DFB-Pokal Report Saison 2020/21 02 DFB-POKAL REPORT 2020/21 INHALT DFB-POKAL REPORT 2020/21 INHALT 03
DFB-Pokal report saison 2020/21 02 DFB-POKAL REPORT 2020/21 INHALT DFB-POKAL REPORT 2020/21 INHALT 03 INHALT DFB-POKAL REPORT 2020/21 VORWORT 05 EDITORIAL Liebe Freund*innen des DFB-Pokal, ir blicken auf eine Saison, Hauptstadt Gastgeber des deutschen Pokal- W in der der DFB-Pokal einmal endspiels. Das Flair der Stadt, die Aura des mehr und unter besonderen Um- Stadions, all das bot auch in diesem Jahr einen ständen bewiesen hat, wofür er würdigen Rahmen. Borussia Dortmund und steht: für die Einheit des deutschen RB Leipzig waren würdige Finalisten, angeleitet Fußballs. Denn der DFB-Pokal ist von großartigen Trainern haben sie den Fans der Wettbewerb, der Basis und vor dem Fernseher ein schönes Fußballerlebnis Spitze miteinander verbindet. bereitet. Peter Frymuth Diese Spielzeit hat viel von dem gezeigt, Wir haben Gänsehautmomente erlebt, große Vizepräsident Spielbetrieb was den Pokal ausmacht. Wir haben große und echte Gefühle, Emotionen, die den Pokal und Fußballentwicklung Emotionen erlebt, große Momente, große auszeichnen. Ermöglicht wurde dies einmal Überraschungen, große Gesten. Und am Ende mehr durch zahlreiche helfende Hände. Im mit Borussia Dortmund eine große Mannschaft Namen des gesamten DFB möchte ich allen als großen Sieger. Es war eine bemerkenswerte Beteiligten, allen Ehrenamtlichen, allen, die Saison, es war keine Saison wie jede andere. sich freiwillig engagieren, ein herzliches Es war eine Spielzeit, in der gefehlt hat, was Dankeschön sagen. Wenn die Fans das Herz den Fußball groß macht: die Fans. Am ersten des Fußballs sind, seid ihr das Rückgrat. Euer Spieltag waren zwar vereinzelte Unterstützer Einsatz ist vorbildlich, ihr verdient Respekt und vor Ort, die restliche Pokalsaison hingegen Anerkennung. -

Beschluss Nr. 6 Zur 3. Ordentlichen Präsidiumssitzung Des SHFV Am 26.05.2018 Antrag: Zulassungsbestimmungen
Beschluss Nr. 6 zur 3. ordentlichen Präsidiumssitzung des SHFV am 26.05.2018 Antrag: Zulassungsbestimmungen Antragsteller: Geschäftsführendes Präsidium auf Anraten der AG Spielbetrieb Antrag: Das Präsidium des SHFV hat die folgenden Änderungen einstimmig beschlossen: f) Zulassungsrichtlinie zum Spielbetrieb der Oberligen Schleswig-Holstein Präambel Vereine, die am Spielbetrieb der Oberligen Schleswig-Holstein im Bereich der Herren, Frauen, Junioren oder Juniorinnen teilnehmen wollen, werden für diese Spielklassen nur zugelassen, wenn sie die nachfolgend dargestellten Voraussetzungen sowohl im sportlich-organisatorischen wie auch technisch-organisatorischen Bereich erfüllen. Im Bereich der Oberliga Schleswig-Holstein Herren gilt dies auch ausdrücklich für die Bestimmungen der separaten Richtlinie für Sicherheitsmaßnahmen bei Fußballspielen der Oberliga Schleswig-Holstein Herren. Nach erfolgter Zulassung zum Spielbetrieb der Oberligen Schleswig-Holstein gilt die nachträgliche Nichteinhaltung der Voraussetzungen dieser Richtlinie bzw. der Richtlinie für Sicherheitsmaßnahmen der Oberliga Schleswig-Holstein Herren als Ordnungswidrigkeit und kann neben einem Ordnungsgeld auch mit der Aberkennung der Zulassung zum laufenden Spielbetrieb der Oberligen Schleswig-Holstein geahndet werden. Bei fortgesetzter Nichteinhaltung der Voraussetzungen kann der zuständige Ausschuss gemäß § 1 a der Spielordnung die Nichtzulassung der betreffenden Mannschaft zum Spielbetrieb der Oberligen Schleswig-Holstein im darauffolgenden Spieljahr, ungeachtet der sportlichen -

15-07-20 Durchführungsbestimmungen
Bestimmungen für die Durchführung der Hallenhandball–Meisterschaftsspiele der Oberligen Niedersachen und Nordsee der Männer, Frauen, der Verbandsliga der Männer sowie der Landesligen der Männer und Frauen im Spieljahr 2015/2016 Inhaltsverzeichnis Seite Ziffer 1 Durchführung 1 Ziffer 2 Spieltechnische Bestimmungen 1 - 3 Ziffer 3 Schiedsrichter 3 Ziffer 4 Zeitnehmer/Sekretär 4 Ziffer 5 Anreise 4 Ziffer 6 Entscheidung bei PunKtgleichheit 4 - 5 Ziffer 7 Ergebnisdienst/Ergebnsimeldung 5 Ziffer 8 Vereinsbeobachtung 5 Ziffer 9 Auf- und Abstiegsregelung 6 - 9 Ziffer 10 Wirtschaftliche Bestimmungen 9 Ziffer 11 Geldbußen 10 Ziffer 12 Rechtswesen 10 Ziffer 13 Schlussbestimmung 10 1. DURCHFÜHRUNG Über die Durchführung der Spiele der dem HVN unterstehenden Mannschaften, entscheidet der Spielausschuss des Handball-Verbandes Niedersachsen. Es gelten die SatZungen und Ordnungen des Deutschen Handballbundes (DHB) einschließlich der Richtlinien und Zusatzbestimmungen des HVN. Gespielt wird nach den internationalen Hallenhandball-Regeln in der jeweils für den Bereich des DHB gültigen Fassung. Die Spielfläche muss grundsätZlich 20 x 40 Meter betragen. Hallen, die eine LängendifferenZ bis 3,00 Meter und/oder BreitendifferenZ bis 1,50 Meter aufweisen, Können auf Antrag vom Spielausschuss genehmigt werden. Die Tore, der Wechselraum und die Linien müssen den IHF-Hallenhandball-Regeln entsprechen. Die in den Oberligen, Verbandsligen und Landesligen spielenden Vereine verpflichten sich, den Wettbewerb bis Zum Ende der Saison durchZuspielen sowie alle finanZiellen Verpflichtungen gegenüber dem HVN und den mitspielenden Vereinen Zu erfüllen. Das Präsidium des HVN, der Spielausschuss und die von ihnen beauftragten Personen überwachen die Einhaltung dieser Durchführungsbestimmungen. Der gesamte SchriftverKehr (Spielverlegungen, OrdnungswidrigKeiten, u.a.) wird ausschließlich nur noch per Email über die offiZiell Handball gemeldete -Verband Niedersachsen Postanschrift des – Tel.