7. Philharmonisches Konzert Klänge Der Heimat Mi 15
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
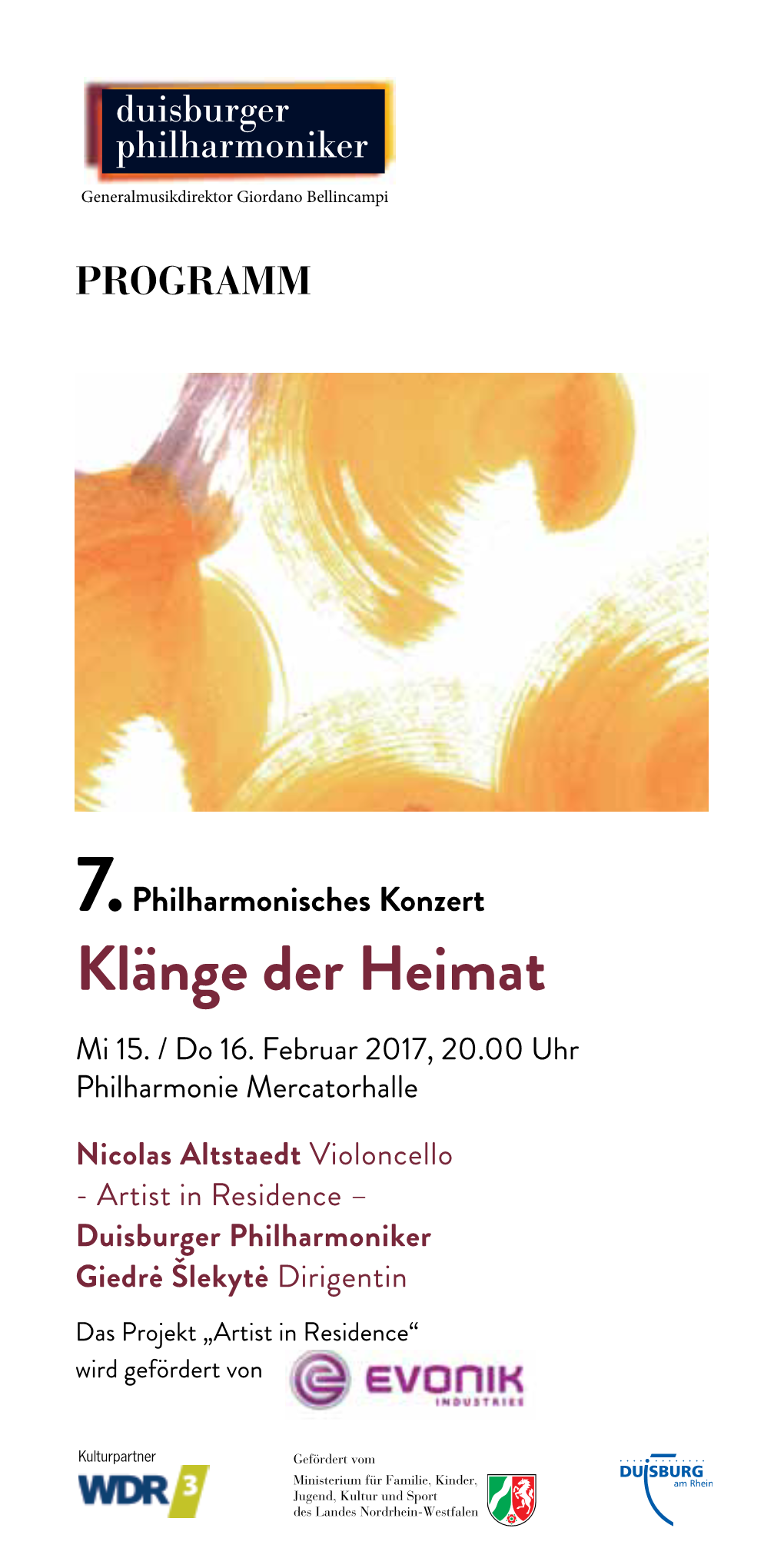
Load more
Recommended publications
-

The Chamber Music Society of Lincoln Center
Concerts from the Library of Congress 2013-2014 THE DINA KOSTON AND ROGER SHAPIRO fUND fOR nEW mUSIC THE CHAMBER MUSIC SOCIETY oF LINCOLN CENTER Thursday, April 10, 2014 ~ 8 pm Coolidge Auditorium Library of Congress, Thomas Jefferson Building THE DINA KOSTON AND ROGER SHAPIRO FUND FOR NEW MUSIC Endowed by the late composer and pianist Dina Koston (1929-2009) and her husband, prominent Washington psychiatrist Roger L. Shapiro (1927-2002), the DINA KOSTON AND ROGER SHAPIRO FUND FOR NEW MUSIC supports commissions and performances of contemporary music. Please request ASL and ADA accommodations five days in advance of the concert at 202-707-6362 or [email protected]. Latecomers will be seated at a time determined by the artists for each concert. Children must be at least seven years old for admittance to the concerts. Other events are open to all ages. Presented in association with: The Chamber Music Society’s touring program is made possible in part by the Lila Acheson and DeWitt Wallace Endowment Fund. Please take note: Unauthorized use of photographic and sound recording equipment is strictly prohibited. Patrons are requested to turn off their cellular phones, alarm watches, and any other noise-making devices that would disrupt the performance. Reserved tickets not claimed by five minutes before the beginning of the event will be distributed to stand-by patrons. Please recycle your programs at the conclusion of the concert. The Library of Congress Coolidge Auditorium Thursday, April 10, 2014 — 8 pm THE DINA KOSTON AND ROGER SHAPIRO fUND fOR nEW mUSIC THE CHAMBER MUSIC SOCIETY oF LINCOLN CENTER • Gilles Vonsattel, piano Nicolas Dautricourt, violin Nicolas Altstaedt, cello Amphion String Quartet Katie Hyun, violin David Southorn, violin Wei-Yang Andy Lin, viola Mihai Marica, cello Tara Helen O'Connor, flute Romie de Guise-Langlois, clarinet Jörg Widmann, clarinet Ian David Rosenbaum, percussion 1 Program PIERRE JALBERT (B. -

Vilde Frang Violon Nicolas Altstaedt Violoncelle Andreas Ottensamer Clarinette Julien Quentin Piano
2019 20:00 25.11.Salle de Musique de Chambre Lundi / Montag / Monday Soirées de musique de chambre Vilde Frang violon Nicolas Altstaedt violoncelle Andreas Ottensamer clarinette Julien Quentin piano résonances 19:30 Salle de Musique de Chambre Artist talk: Andreas Ottensamer im Gespräch mit Tatjana Mehner (D) Eugène Ysaÿe (1858–1931) Sonate pour violon seul N° 5 en sol majeur (G-Dur) op. 27 N° 5 «Pastorale» (1923) L’Au ro re Danse rustique 9’ Alexander Zemlinsky (1871–1942) Trio op. 3 pour clarinette, violoncelle et piano (1896/97) Allegro ma non troppo Andante Allegro 25’ — Claude Debussy (1862–1918) Première Rhapsodie pour clarinette et piano (1909/10) 9’ Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur (d-moll) (1915) Prologue: Lent, sostenuto e molto risoluto Sérénade: Modérément animé Final: Animé, léger et nerveux 12’ Béla Bartók (1881–1945) Contrasts Sz 111 (1938) 1. Recruiting Dance (Verbunkos) 2. Relaxation (Pihenö) 3. Fast Dance (Sebes) 20’ D’Knipserten Martin Fengel Quand le morceau de concours brise son destin Marie-Anne Maršálek En 1910, Claude Debussy (1862–1918) s’adressait ainsi, non sans humour, à son éditeur : « Dimanche, plaignez-moi, j’entendrai onze fois la Rhapsodie pour clarinette en si bémol : je vous raconterai cela si je suis encore en vie. » Cette œuvre souvent donnée voit en effet le jour lors d’une occasion bien particulière, évoquée en filigrane dans le propos cité : dédiée à Prosper Mimart, professeur de clarinette au Conservatoire National Supérieur de Paris entre 1905 et 1918, elle constitue l’imposé du Concours de clarinette organisé par la prestigieuse institution, alors dirigée par Gabriel Fauré (1845–1924). -
Saisonbroschüre 2017/2018
simmenauer impresariat Impresariat SAI S ON 2017/2018 Simmenauer VORWORT Liebe Kollegen, Angst, Krieg, Leid, Terror, Flucht und selbstverschuldete Klimakatastrophen, aber auch Hilfe, Mut und Mensch- lichkeit prägen das Bild der letzten Monate. Wir sind tief verunsichert. Was in der Gesellschaft noch nicht sichtbar zu keimen vermag, gelingt offensichtlich auf wundersame Weise in der Welt der Musik: der Amalgam der Kulturen und der verschiedenen Zeitalter, die Mischung der Genres und deren Interpreten – mit Respekt und Neugier für einander, die Rückbesinnung auf alte Formen und Instrumente – meist ohne reaktionäre und dogmatische Begleiterscheinungen. All dies ist keine Utopie, sondern wird gelebt und rezipiert: eine große Zeit für Kammermusik ohne Grenzen. simmenauer Es heißt, die Künste sind der Gesellschaft immer einen Schritt voraus. Gibt es damit Grund zur Hoffnung, dass dieser Trend immer lauter wird und die dadurch auch immer größer und bunter werdende Musikcommunity impresariat das Grobe, Erschreckende, Rassistische und Rückwärts- gewandte übertönen wird? Wir haben die Ideen unserer Künstler gesammelt und laden Sie herzlich ein, sich mit dem einen oder anderen Programm von dieser Energie anstecken zu lassen. Mit vielen Grüßen sonia simmenauer BEETHOVEN NICOLAS ALTSTAEDT & ALEXANDER LONQUICH Mit musikalischem Freund und Duopartner Lonquich und einer Pause spielt Nicolas Altstaedt (im Mai 2016 geehrter Träger des Beethovenrings!) alle fünf Cello- sonaten an einem Abend. ALEXANDER MELNIKOV B32 Die Klaviersonaten und das Hammerklavier Beethoven schrieb seine Klaviersonaten, indem er stets das Äußerste von Interpret und Instrument forderte. So wird der Zyklus chronologisch und je nach Periode auf dem entsprechenden, immer neueren (Hammer-)Klavier aufgeführt. BELCEA QUARTET »in mysterious company« »blind gehört«: Beethovens op. -

2016/17 Season Preview and Appeal
2016/17 SEASON PREVIEW AND APPEAL The Wigmore Hall Trust would like to acknowledge and thank the following individuals and organisations for their generous support throughout the THANK YOU 2015/16 Season. HONORARY PATRONS David and Frances Waters* Kate Dugdale A bequest from the late John Lunn Aubrey Adams David Evan Williams In memory of Robert Easton David Lyons* André and Rosalie Hoffmann Douglas and Janette Eden Sir Jack Lyons Charitable Trust Simon Majaro MBE and Pamela Majaro MBE Sir Ralph Kohn FRS and Lady Kohn CORPORATE SUPPORTERS Mr Martin R Edwards Mr and Mrs Paul Morgan Capital Group The Eldering/Goecke Family Mayfield Valley Arts Trust Annette Ellis* Michael and Lynne McGowan* (corporate matched giving) L SEASON PATRONS Clifford Chance LLP The Elton Family George Meyer Dr C A Endersby and Prof D Cowan Alison and Antony Milford L Aubrey Adams* Complete Coffee Ltd L American Friends of Wigmore Hall Duncan Lawrie Private Banking The Ernest Cook Trust Milton Damerel Trust Art Mentor Foundation Lucerne‡ Martin Randall Travel Ltd Caroline Erskine The Monument Trust Karl Otto Bonnier* Rosenblatt Solicitors Felicity Fairbairn L Amyas and Louise Morse* Henry and Suzanne Davis Rothschild Mrs Susan Feakin Mr and Mrs M J Munz-Jones Peter and Sonia Field L A C and F A Myer Dunard Fund† L The Hargreaves and Ball Trust BACK OF HOUSE Deborah Finkler and Allan Murray-Jones Valerie O’Connor Pauline and Ian Howat REFURBISHMENT SUMMER 2015 Neil and Deborah Franks* The Nicholas Boas Charitable Trust The Monument Trust Arts Council England John and Amy Ford P Parkinson Valerie O’Connor The Foyle Foundation S E Franklin Charitable Trust No. -

Cello Biennale 2018
programmaoverzicht Cellists Harald Austbø Quartet Naoko Sonoda Nicolas Altstaedt Jörg Brinkmann Trio Tineke Steenbrink Monique Bartels Kamancello Sven Arne Tepl Thu 18 Fri 19 Sat 20 Sun 21 Mon 22 Tue 23 Wed 24 Thu 25 Fri 26 Sat 27 Ashley Bathgate Maarten Vos Willem Vermandere 10.00-16.00 Grote Zaal 10.00-12.30 Grote Zaal 09.30 Grote Zaal 09.30 Grote Zaal 09.30 Grote Zaal 09.30 Grote Zaal 09.30 Grote Zaal 09.30 Grote Zaal Kristina Blaumane Maya Beiser Micha Wertheim First Round First Round (continued) Bach&Breakfast Bach&Breakfast Bach&Breakfast Bach&Breakfast Bach&Breakfast Bach&Breakfast Arnau Tomàs Matt Haimovitz Kian Soltani Jordi Savall Sietse-Jan Weijenberg Harriet Krijgh Lidy Blijdorp Mela Marie Spaemann Santiago Cañón NES Orchestras and Ensembles 10.15-12.30 10.15-12.30 10.30-12.45 Grote Zaal 10.15-12.30 10.15-12.30 10.15-12.30 10.15-12.30 10.30 and 12.00 Kleine Zaal Master class Master class Second Round Masterclass Masterclass Masterclass Masterclass Valencia Svante Henryson Accademia Nazionale di Santa Show for young children: Colin Carr (Bimhuis) Jordi Savall (Bimhuis) Jean-Guihen Queyras Nicolas Altstaedt (Bimhuis) Roel Dieltiens (Bimhuis) Matt Haimovitz (Bimhuis) Colin Carr Quartet Cecilia Spruce and Ebony Jakob Koranyi (Kleine Zaal) Giovanni Sollima (Kleine (Bimhuis) Michel Strauss (Kleine Zaal) Chu Yi-Bing (Kleine Zaal) Reinhard Latzko (Kleine Zaal) Zaal) Kian Soltani (Kleine Zaal) Hayoung Choi The Eric Longsworth Amsterdam Sinfonietta 11.00 Kleine Zaal Chu Yi-Bing Project Antwerp Symphony Orchestra Show for young children: -

Network Notebook
Network Notebook Summer Quarter 2017 (July - September) A World of Services for Our Affiliates We make great radio as affordable as possible: • Our production costs are primarily covered by our arts partners and outside funding, not from our affiliates, marketing or sales. • Affiliation fees only apply when a station takes three or more programs. The actual affiliation fee is based on a station’s market share. Affiliates are not charged fees for the selection of WFMT Radio Network programs on the Public Radio Exchange (PRX). • The cost of our Beethoven and Jazz Network overnight services is based on a sliding scale, depending on the number of hours you use (the more hours you use, the lower the hourly rate). We also offer reduced Beethoven and Jazz Network rates for HD broadcast. Through PRX, you can schedule any hour of the Beethoven or Jazz Network throughout the day and the files are delivered a week in advance for maximum flexibility. We provide highly skilled technical support: • Programs are available through the Public Radio Exchange (PRX). PRX delivers files to you days in advance so you can schedule them for broadcast at your convenience. We provide technical support in conjunction with PRX to answer all your distribution questions. In cases of emergency or for use as an alternate distribution platform, we also offer an FTP (File Transfer Protocol), which is kept up to date with all of our series and specials. We keep you informed about our shows and help you promote them to your listeners: • Affiliates receive our quarterly Network Notebook with all our program offerings, and our regular online WFMT Radio Network Newsletter, with news updates, previews of upcoming shows and more. -

Nicolas Altstaedt Shostakovich Weinberg Cello Concertos
CHANNEL CLASSICS CCS 38116 NICOLAS ALTSTAEDT SHOSTAKOVICH WEINBERG CELLO CONCERTOS Deutsches Symphonie-Orchester Berlin Michał Nesterowicz NICOLAS ALTSTAEDT Symphony Orchestra Stuttgart, Strasbourg Philharmonic and Basel Symphony Orchestra. In 2012 he was invited by Gidon Kremer to be Artistic Director of the Lockenhaus Festival German/French cellist Nicolas Altstaedt is and in 2014, Adam Fischer asked him to follow renowned worldwide for his creativity and in his footsteps as Artistic Director of the Haydn versatility, in his captivating performances of Philharmonie, with whom he regularly performs repertoire on both modern and gut strings. at the Vienna Konzerthaus, Esterhazy Festival Awarded the Credit Suisse Young Artist Award and will tour both China and Japan in the next in 2010, he performed the Schumann concerto seasons. with the Vienna Philharmonic under Gustavo In recital, Nicolas performs solo and with Dudamel at the Lucerne Festival. Since then, he partners, Fazil Say and Alexander Lonquich. has performed worldwide with orchestras such He will tour both Europe and the US in 2016/17 as Tonhalle Orchestra Zurich, Czech Philharmonic season and will visit Istanbul, London Wigmore Orchestra, Tokyo Metropolitan Orchestra, Hall, Amsterdam Concertgebouw and New York Melbourne Symphony Orchestra and all the Carnegie Hall amongst others. In Autumn 17, BBC Orchestras working with conductors Sir Nicolas will tour Australia extensively as part of a Roger Norrington, Sir Neville Marriner, Vladimir Musica Viva recital tour. Ashkenazy and -

[email protected] FOREIGN B
FOR IMMEDIATE RELEASE ARTIST UPDATE January 17, 2018 Contact: Katherine E. Johnson (212) 875-5700; [email protected] FOREIGN BODIES Conducted and Hosted by ESA-PEKKA SALONEN The Marie-Josée Kravis Composer-in-Residence June 8, 2018 Esa-Pekka SALONEN’s Foreign Bodies WORLD PREMIERE of Live Video Installation by TAL ROSNER NEW YORK PREMIERE of Daníel BJARNASON’s Violin Concerto with PEKKA KUUSISTO OBSIDIAN TEAR Choreography by Wayne McGregor Performed by Members of BOSTON BALLET Set to Esa-Pekka SALONEN’s Lachen verlernt and Nyx The New York Philharmonic announces Foreign Bodies, a one-night-only multidisciplinary event conducted and hosted by Esa-Pekka Salonen, concluding his tenure as The Marie-Josée Kravis Composer-in-Residence. The concert, Friday, June 8, 2018, at 8:00 p.m., will feature Esa-Pekka Salonen’s Foreign Bodies, accompanied by the World Premiere of a live video installation by Tal Rosner; the New York Premiere of Daníel Bjarnason’s Violin Concerto, with Pekka Kuusisto in his New York Philharmonic debut; and Obsidian Tear, a dance work choreographed by Wayne McGregor performed by members of Boston Ballet (Philharmonic debut) and set to Mr. Salonen’s Nyx and Lachen verlernt, the latter of which will be performed by violinist Simone Porter. Foreign Bodies will be casual and multi-sensory; drinks and conversation will flow as attendees mingle with the performers, who will give additional impromptu performances throughout the event. The program showcases several cross-pollinating collaborations related to Esa-Pekka Salonen. Tal Rosner previously created a video installation for Lachen verlernt (most recently presented at London’s Barbican Centre in December 2017), and Wayne McGregor previously choreographed a ballet to Foreign Bodies. -
Nicolas Altstaedt SWR Symphonie- Orchester Michael Sanderling
Kölner Sonntagskonzerte 1 Nicolas Altstaedt SWR Symphonie- orchester Michael Sanderling Sonntag 22. September 2019 18:00 Bitte beachten Sie: Ihr Husten stört Besucher und Künstler. Wir halten daher für Sie an den Garderoben Ricola-Kräuterbonbons bereit. Sollten Sie elektronische Geräte, insbesondere Mobiltelefone, bei sich haben: Bitte schalten Sie diese zur Vermeidung akustischer Störungen unbedingt aus. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Bild- und Tonaufnahmen aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet sind. Wenn Sie einmal zu spät zum Konzert kommen sollten, bitten wir Sie um Verständnis, dass wir Sie nicht sofort einlassen können. Wir bemühen uns, Ihnen so schnell wie möglich Zugang zum Konzertsaal zu gewähren. Ihre Plätze können Sie spätestens in der Pause einnehmen. Bitte warten Sie den Schlussapplaus ab, bevor Sie den Konzertsaal verlassen. Es ist eine schöne und respektvolle Geste den Künstlern und den anderen Gästen gegenüber. Mit dem Kauf der Eintrittskarte erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Bild möglicherweise im Fernsehen oder in anderen Medien ausgestrahlt oder veröffentlicht wird. Vordruck/Lackform_1920.indd 2-3 17.07.19 10:18 Kölner Sonntagskonzerte 1 Nicolas Altstaedt Violoncello SWR Symphonieorchester Michael Sanderling Dirigent Teodor Currentzis muss leider seine Mitwirkung an den Konzerten des SWR Symphonieorchesters in den kommenden zwei Wochen absagen, auch das heutige Konzert. Wir freuen uns, dass sich Michael Sanderling kurzfristig bereit erklärt hat, das Dirigat zu übernehmen. Damit geht eine Programmänderung einher: Anstelle von György Kurtágs Stele op. 33 spielt Nicolas Altstaedt das Solowerk Trois Strophes sur le nom de SACHER von Henri Dutilleux. Sonntag 22. September 2019 18:00 Pause gegen 18:55 Ende gegen 20:05 17:00 Einführung in das Konzert durch Oliver Binder PROGRAMM Henri Dutilleux 1916 – 2013 Trois Strophes sur le nom de SACHER (1982) für Violoncello solo Un poco indeciso Andante sostenuto Vivace Dmitrij Schostakowitsch 1906 – 1975 Konzert für Violoncello und Orchester Nr. -

Shostakovich (1906-1975)
RUSSIAN, SOVIET & POST-SOVIET CONCERTOS A Discography of CDs and LPs Prepared by Michael Herman Dmitri Shostakovich (1906-1975) Born in St. Petersburg. He entered the Petrograd Conservatory at age 13 and studied piano with Leonid Nikolayev and composition with Maximilian Steinberg. His graduation piece, the Symphony No. 1, gave him immediate fame and from there he went on to become the greatest composer during the Soviet Era of Russian history despite serious problems with the political and cultural authorities. He also concertized as a pianist and taught at the Moscow Conservatory. He was a prolific composer whose compositions covered almost all genres from operas, ballets and film scores to works for solo instruments and voice. Piano Concerto No. 1 in C minor with Trumpet and String Orchestra, Op. 35 (1933) Dmitri Alexeyev (piano)/Philip Jones (trumpet)/Jerzy Maksymiuk/English Chamber Orchestra ( + Piano Concerto No. 2, Unforgettable Year 1919, Gadfly: Suite, Tahiti Trot, Suites for Jazz Orchestra Nos. 1 and 2) CLASSICS FOR PLEASURE 382234-2 (2007) Victor Aller (piano)/Murray Klein (trumpet)/Felix Slatkin/Concert Arts Orchestra ( + Hindemith: The Four Temperaments) CAPITOL P 8230 (LP) (1953) Leif Ove Andsnes (piano)/Håkan Hardenberger (trumpet)/Paavo Järvi/City of Birmingham Symphony Orchestra ( + Britten: Piano Concerto and Enescu: Legende) EMI CLASSICS 56760-2 (1999) Annie d' Arco (piano)/Maurice André (trumpet)/Jean-François Paillard/Orchestre de Chambre Jean François Paillard (included in collection: "Maurice André Edition - Volume -

Walton Violoncellokonzert ROBIN Mahler Symphonie Nr.1TICCIATI ROBIN Ticciatinicolas Altstaedt Violoncello Programm 2 3 Introduktion
So 29.09. 20 Uhr Philharmonie Präludium Improvisation Walton Violoncellokonzert Mahler ROBIN Symphonie Nr.1TICCIATI ROBIN TICCIATI Nicolas Altstaedt Violoncello Programm 2 3 introduktion So 29 09 | 20 Uhr — – Ein Novum in der Geschichte des DSO: präludium FREiHEiT iN DER MUSiK Das Orchester spielt nicht nach Noten, improvisation des Orchesters sondern improvisiert. Uraufführung am 25. Januar 1957 in William Walton (1902–1983) Das heutige Konzert beginnt mit einer improvisation. Nicht einer allein führt Boston durch das Boston Symphony Konzert für Violoncello und Orchester op. 68 (1956) sie aus, auch nicht nur eine kleine, eingespielte Combo, sondern das DSO als Orchestra unter der Leitung von Charles Munch; Solist: Gregor Piatigorsky, der I. Moderato Ganzes. Ein solches Experiment hat in den Arbeitsplänen von Orchestern das Werk in Auftrag gab. II. Allegro appassionato Seltenheitswert. Es schärft die Sensibilität des zusammenspiels – und es wird III. Lento – Con moto – Risoluto tempo giusto. Brioso – Allegro molto – nahegelegt durch das Programm. William Walton, der britische Komponist, Rapsodicamente – A tempo di primo movimento, ma un po’ più lento – Adagio der ab 1948 seinen Lebensmittelpunkt sukzessive auf die italienische insel ischia verlagerte und ab 1956 ganz dort wohnte, bezeichnete das Finale pAuse seines Violoncellokonzerts als »Tema ed improvvisazioni«, nicht als Thema mit Variationen, obwohl der Satz nach diesem tradierten Muster gebaut ist. Uraufführung am 20. November 1889 Gustav mahler (1860–1911) Doch der Urgedanke wirkt für die vier Teile, die aus ihm entspringen, eher in Budapest im Rahmen eines Phil- Symphonie Nr. 1 D-Dur (1888|1896; rev. 1909|1910) harmonischen Konzerts unter der als auslösender impuls und Materialfundus denn als verbindliche Mitte und Leitung des Komponisten. -
NICOLAS ALTSTAEDT ALEXANDER LONQUICH So 7
Generalmusikdirektor Giordano Bellincampi PROGRAMM Foto: Marco Borggreve Marco Foto: 8. Kammerkonzert NICOLAS ALTSTAEDT ALEXANDER LONQUICH So 7. Mai 2017, 19.00 Uhr Philharmonie Mercatorhalle Nicolas Altstaedt Violoncello – Artist in Residence – Alexander Lonquich Klavier Das Projekt „Artist in Residence“ wird gefördert von der Kulturpartner Gefördert vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen Duisburger Kammerkonzerte Sonntag, 7. Mai 2017, 19.00 Uhr Philharmonie Mercatorhalle Nicolas Altstaedt Violoncello – Artist in Residence – Alexander Lonquich Klavier Ludwig van Beethoven, Gemälde von Christian Hornemann, 1803 Programm Pause Ludwig van Beethoven (1770-1827) Ludwig van Beethoven Sonate für Klavier und Violoncello Sonate für Klavier und Violoncello F-Dur op. 5 Nr. 1 (1796) C-Dur op. 102 Nr. 1 (1815) I. Allegro sostenuto – Allegro I. Andante – Allegro vivace II. Rondo. Allegro vivace II. Adagio – Tempo d’Andante – Allegro vivace Sonate für Klavier und Violoncello Sonate für Klavier und Violoncello g-Moll op. 5 Nr. 2 (1796) D-Dur op. 102 Nr. 2 (1815) I. Adagio sostenuto ed espressivo – I. Allegro con brio Allegro molto più tosto presto II. Adagio con molto sentimento d’affetto II. Rondo. Allegro III. Allegro – Allegro fugato Pause Sonate für Klavier und Violoncello A-Dur op. 69 (1807/08) I. Allegro ma non tanto „Konzertführer live“ mit Ulrich Schardt um II. Scherzo. Allegro molto 18.15 Uhr in der Philharmonie Mercatorhalle. III. Adagio cantabile – Allegro vivace Das Konzert endet um ca. 21.45 Uhr. 2 3 Ludwig van Beethoven instrument besser für die sachlichen Zwecke der duettieren- Die fünf Sonaten für Violoncello und Klavier den Kammermusik als die Violine.