ZEIT Reisen Here Comes The
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Casiopea 1979 Full Album Download
casiopea 1979 full album download IsraBox - Music is Life! Casiopea - Best of Casiopea-Alfa Collection (2009) Artist : Casiopea Title : Best of Casiopea-Alfa Collection Year Of Release : 2009 Label : Alfa Records Genre : Jazz, Jazz Fusion Quality : MP3/320 kbps Total Time : 77:28 Total Size : 183 MB(+3%) Casiopea - Jive Jive (2002) [24bit FLAC] Artist : Casiopea Title : Jive Jive Year Of Release : 1983 / 2002 Label : Village Records / Alfa – ALR 28052 / Vinyl, LP Genre : Jazz-Rock, Jazz- Funk, Smooth Jazz, Fusion Quality : FLAC (tracks+.cue,log scans) / FLAC (tracks) 24bit-192kHz Total Time : 38:18 Total Size : 245 Mb / 1.48 Gb. Casiopea - Dramatic (1993) Artist : Casiopea Title : Dramatic Year Of Release : 1993 Label : Alfa Records Genre : Jazz, Fusion Quality : FLAC (tracks+.cue, log) Total Time : 51:04 Total Size : 351 MB. Casiopea - Answers (1994) Artist : Casiopea Title : Answers Year Of Release : 1994 Label : Alfa Genre : Smooth Jazz, Jazz-Funk, Fusion Quality : FLAC (image+.cue, log, Artwork) Total Time : 54:13 Total Size : 356 MB. Casiopea - Material (1999) CD Rip. Artist : Casiopea Title : Material Year Of Release : 1999 Label : Pony Canyon[PCCR-00304] Genre : Jazz, Fusion Quality : FLAC (tracks + .cue,log,scans) Total Time : 49:15 Total Size : 323 MB(+3%) Casiopea - Down Upbeat (1984) Artist : Casiopea Title : Down Upbeat Year Of Release : 1984 Label : Alfa Records Genre : jazz, funk, fusion Quality : APE (image+.cue,log,scans) Total Time : 38:26 Total Size : 228 MB. Casiopea - Main Gate (2001) Artist : Casiopea Title : Main -

20171030-SORS-2018-1.7.Pdf
SMITHSONIAN OPPORTUNITIES FOR RESEARCH AND STUDY 2018 Office of Fellowships and Internships Smithsonian Institution Washington, DC The Smithsonian Opportunities for Research and Study Guide Can be Found Online at http://www.smithsonianofi.com/sors-introduction/ Version 1.7 (Updated October 30, 2017) Copyright © 2017 by Smithsonian Institution Table of Contents Table of Contents..................................................................................................................................................................................... 1 How to Use This Book ........................................................................................................................................................................... 1 Anacostia Community Museum (ACM) .......................................................................................................................................... 3 Archives of American Art (AAA) ........................................................................................................................................................ 5 Asian Pacific American Center (APAC) ........................................................................................................................................... 7 Center for Folklife and Cultural Heritage (CFCH) ...................................................................................................................... 8 Cooper-Hewitt, National Design Museum (CHNDM) .......................................................................................................... -

Pasic 2001 Marching Percussion Festival
TABLE OF CONTENTS 2 Welcome Messages 4 PASIC 2001 Planning Committee 5 Sponsors 8 Exhibitors by Name/Exhibitors by Booth Number 9 Exhibitors by Category 10 Exhibit Hall Map 12 Exhibitors 24 PASIC 2001 Map 26 PASIC 2001 Area Map 29 Wednesday, November 14/Schedule of Events 34 Thursday, November 15/Schedule of Events 43 Friday, November 16/Schedule of Events 52 Saturday, November 17/Schedule of Events 60 Artists and Clinicians 104 Percussive Arts Society History 2001 111 Special Thanks/PASIC 2001 Advertisers NASHVILLE NOVEMBER 14–17 2 PAS President’s Welcome It is a grim reminder of the chill- from this tragedy. However, in a happier world that lies ® ing events that shook the U.S. this land of diversity, we all deal ahead for all of us. on September 11. I am espe- with grief and healing in differ- cially grateful to all of our PAS ent ways. I’m in no way international members who sent trivializing this tragedy when I personal messages to me, tell you that I’m especially look- members of the Board of Direc- ing forward to seeing friends tors, and into the PAS office in and colleagues from around the www.pas.org Lawton, Oklahoma. Your out- globe at PASIC in Nashville. pouring of support and conso- Percussion is the passion that oday, as I sit to write my lation are deeply appreciated. binds us all and allows us to T“welcome to PASIC” I applaud those of you who come together in a common message, I realize that our have offered to use your re- place to see our friends, hear world has forever changed. -

Swarthmore Folk Alumni Songbook 2019
Swarthmore College ALUMNI SONGBOOK 2019 Edition Swarthmore College ALUMNI SONGBOOK Being a nostalgic collection of songs designed to elicit joyful group singing whenever two or three are gathered together on the lawns or in the halls of Alma Mater. Nota Bene June, 1999: The 2014 edition celebrated the College’s Our Folk Festival Group, the folk who keep sesquicentennial. It also honored the life and the computer lines hot with their neverending legacy of Pete Seeger with 21 of his songs, plus conversation on the folkfestival listserv, the ones notes about his musical legacy. The total number who have staged Folk Things the last two Alumni of songs increased to 148. Weekends, decided that this year we’d like to In 2015, we observed several anniversaries. have some song books to facilitate and energize In honor of the 125th anniversary of the birth of singing. Lead Belly and the 50th anniversary of the Selma- The selection here is based on song sheets to-Montgomery march, Lead Belly’s “Bourgeois which Willa Freeman Grunes created for the War Blues” was added, as well as a new section of 11 Years Reunion in 1992 with additional selections Civil Rights songs suggested by three alumni. from the other participants in the listserv. Willa Freeman Grunes ’47 helped us celebrate There are quite a few songs here, but many the 70th anniversary of the first Swarthmore more could have been included. College Intercollegiate Folk Festival (and the We wish to say up front, that this book is 90th anniversary of her birth!) by telling us about intended for the use of Swarthmore College the origins of the Festivals and about her role Alumni on their Alumni Weekend and is neither in booking the first two featured folk singers, for sale nor available to the general public. -
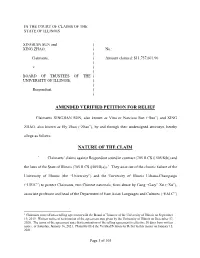
UIUC Amended COC Complaint
IN THE COURT OF CLAIMS OF THE STATE OF ILLINOIS XINGJIAN SUN and ) XING ZHAO, ) No.: ) Claimants, ) Amount claimed: $11,737,601.90 ) v. ) ) BOARD OF TRUSTEES OF THE ) UNIVERSITY OF ILLINOIS, ) ) Respondent. ) ) AMENDED VERIFIED PETITION FOR RELIEF Claimants XINGJIAN SUN, also known as Vina or Narcissa Sun (“Sun”) and XING ZHAO, also known as Ely Zhao (“Zhao”), by and through their undersigned attorneys, hereby allege as follows: NATURE OF THE CLAIM Claimants’ claims against Respondent sound in contract (705 ILCS § 505/8(b)) and the laws of the State of Illinois (705 ILCS §505/8(a)).1 They arise out of the chronic failure of the University of Illinois (the “University”) and the University of Illinois Urbana-Champaign (“UIUC”) to protect Claimants, two Chinese nationals, from abuse by Gang “Gary” Xu (“Xu”), associate professor and head of the Department of East Asian Languages and Cultures (“EALC”) 1 Claimants entered into a tolling agreement with the Board of Trustees of the University of Illinois on September 19, 2019. Written notice of termination of the agreement was given by the University of Illinois on December 17, 2020. The terms of the agreement state that termination of the tolling agreement is effective 30 days from written notice, or Saturday, January 16, 2021. Plaintiffs filed the Verified Petition for Relief in this matter on January 15, 2021. Page 1 of 101 and a serial abuser and violent rapist, even after being put on repeated notice of his abuse and mistreatment of UIUC students. Instead, the University helped this professor as he perpetrated horrific abuse against his students, including trafficking them. -

Island Sun News Sanibel Captiva
PRSRT STD U.S. POSTAGE PAID FT MYERS, FL PERMIT #5718 Read Us Online at Postal Customer IslandSunNews.com ECRWSS NEWSPAPER VOL. 21, NO. 17 SANIBELSanibel & CAPTIVA& Captiva ISLANDS, Islands FLORIDA OctOber 18, 2013 OCTOBER SUNRISE/SUNSET: 18 7:29 • 6:58 19 7:30 • 6:57 20 7:30 • 6:56 21 7:31 • 6:55 22 7:31 • 6:54 23 7:32 • 6:54 24 7:33 • 6:53 Fish Caught Above, FGCU students at a cleanup on Picnic Island October 5 SCCF Sponsors Underwater Marine Cleanup At The Sanibel Pier n Friday, October 25, OSCCF and Sammy Rose hits the deck with the fish caught by the Rose family during a recent offshore FGCU students will trip. See page 21 for story and more photographs. work together to remove underwater In the meantime, citizens can monitor marine debris and Family Fun Day www.dingdarlingdays.com, www.dingda- monofilament line rlingsociety.org and the “Ding” Darling from the Sanibel Cancelled Wildlife Society Facebook page for status Pier. The City of Sanibel will close ecause of the lapse in appropria- updates about “Ding” Darling Days. Cancellations of wildlife-related recre- the pier from 10:30 tions that has caused the federal a.m. until 2:30 p.m. government shutdown, the U.S. Fish ational activities including hunting, fishing B and environmental education are being to enable easy access and Wildlife Service announced that the beneath the pier. annual Family Fun Day, which is the tradi- evaluated as the shutdown continues and decisions are being made based on logisti- Dive Master tional kick-off to “Ding” Darling Days on Nathan Engler will Sunday, October 20 at JN “Ding” Darling cal requirements and the time needed to support them. -

Embedded Lights out Manager Administration Guide for the Sun Fire X4150 and X4450 Servers • April 2008 ▼ to Clear the Event Log 25
Embedded Lights Out Manager Administration Guide for the Sun Fire™ X4150 and X4450 Servers Sun Microsystems, Inc. www.sun.com Part No. 820-1855-13 April 2008, Revision A Submit comments about this document at: http://www.sun.com/hwdocs/feedback Copyright © 2007 - 2008 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved. THIS PRODUCT CONTAINS CONFIDENTIAL INFORMATION AND TRADE SECRETS OF SUN MICROSYSTEMS, INC. USE, DISCLOSURE OR REPRODUCTION IS PROHIBITED WITHOUT THE PRIOR EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF SUN MICROSYSTEMS, INC. This distribution may include materials developed by third parties. Sun, Sun Microsystems, the Sun logo, Java, Netra, Solaris, StarOffice, Sun Ray, Sun Fire and the SunSpectrum Pac (Sunburst design) logo are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and other countries. Intel is a trademark or registered trademark of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. Intel Inside is a trademark or registered trademark of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. This product is covered and controlled by U.S. Export Control laws and may be subject to the export or import laws in other countries. Nuclear, missile, chemical biological weapons or nuclear maritime end uses or end users, whether direct or indirect, are strictly prohibited. Export or reexport to countries subject to U.S. embargo or to entities identified on U.S. export exclusion lists, including, but not limited to, the denied persons and specially designated nationals lists is strictly prohibited. Use of any spare or replacement CPUs is limited to repair or one-for-one replacement of CPUs in products exported in compliance with U.S. -

Portland Daily Press: December 08,1869
PORTLAND .rune zs, isez. rot. PORTLAND. WEDNESDAY MORNING, DECEMBER 8, 1869. T„m„ «._ ts.00 per annum< in The Portland uaiiy Press REMOVALS. INSURANCE. MISCELLANEOUS. MISCELLANEOUS. TEXAS. Is every day (Sundays published excepted) by This State will be entitled to four member! lh* DAILY PRESS. REMOV AL* MARINE. N T hepArf?°i,8tructed- The election has just Portland Publishing Co., FIRF, O I O eT behl, but its POUTLAND. result is not yet known. Exchange -AND Choice VERMONT. At 109 Street, Portland. have this day admitted Samuel H. Brackett, « /il WE SHALL OPES OUK a Security! 3 G. Smith. Terms:—Eight Dollars a Year in advance. WE partner in the firm ot Sheri Jan <$ Griffiths, I. Luke P.p-oU»a"J- Worth’gton and will continue the Plastering, Stucco and Mastic io name of Wednesday Moraine;, December 1869. business all its branches, under the firm Seven Per Cent. Gold, 8, VIRGINIA. The Maine State Press New Store 49 Life Sheridan, Griffiths & Brackett, also have purchased I. D. M. Norton. 5. Robert Hi.lcwzv Exchange St., Insurance 164 the stock and stand ot Jos. Wescott & Sou, No. Fuee of t. James H. Jr. 0. Govenment Tax. FORTY -FIRMT Platt, William Millies Jr Commarcial street, for the of carrying on CONOREBM. ]. Charles H. Porter. 7. Is at purpose Lewis McKenzie. published every Thursday Morning AGENCY. the Commission w ll constantly a if Business,ami keep Ten Pet' Cent. I. George W. Booker. $2.50 year; paid in advance, at $2.00 a on band the best quality ot Lime, Plaster, (Nearly Currency.) Cement, Ill Bccond Btmloa-l.isi at Of tbe memberselect from year. -

Desert Skies Tucson Amateur Astronomy Association
Desert Skies Tucson Amateur Astronomy Association Volume LV, Number 1 January, 2009 Cassiopeia A Supernova Remnant ♦ School star parties ♦ TAAA Astronomy Complex Updates ♦ Constellation of the month Desert Skies: January, 2009 2 Volume LV, Number 1 Cover Photo: This image is a composite of Chandra (X-ray), Spitzer (IR) and Hubble space telescopes (JPL-CalTech, NASA, Steward Observatory) TAAA Web Page: http://www.tucsonastronomy.org TAAA Phone Number: (520) 792-6414 Office/Position Name Phone E-mail Address President Ken Shaver 762-5094 [email protected] Vice President Keith Schlottman 290-5883 [email protected] Secretary Luke Scott 749-4867 [email protected] Treasurer Terri Lappin 977-1290 [email protected] Member-at-Large George Barber 822-2392 [email protected] Member-at-Large John Kalas 620-6502 [email protected] Member-at-Large Teresa Plymate 883-9113 [email protected] Past President Bill Lofquist 297-6653 [email protected] Chief Observer Dr. Mary Turner 743-3437 [email protected] AL Correspondent (ALCor) Nick de Mesa 797-6614 [email protected] Astro-Imaging SIG Steve Peterson 762-8211 [email protected] Beginners SIG JD Metzger 760-8248 [email protected] Newsletter Editor George Barber 822-2392 [email protected] School Star Party Scheduling Coordinator Paul Moss 240-2084 [email protected] School Star Party Volunteer Coordinator Roger Schuelke 404-6724 [email protected] -

November 1996
"Hey, man, did you hear that Lars' second bass drum got ripped off on the way to the studio, so he just decided to bag the whole blazin' thing?" "Yeah, and the new album, Load, is like this massive groove thing!" "Awesome! But what's up with the hair?" by Matt Peiken 38 Tribal Tech was already the hottest con- Amazingly,Rage Against The Machine's long-await- temporary fusion band on the scene, but a ed second album, Evil Empire, is even heavier than new jamming-based aesthetic is taking the band's self-titled barnstormer. Despite the heavy- these sonic explorers into even farther ness, though, Brad Wilk says he's managed to infuse galaxies. And you thought Kirk Covington more delicacy into the thunder. was throwing some stuff at you before! by Ken Micallef by Bill Milkowski 76 58 photo by Jay Blakesberg Volume 2O, Number 11 Cover photo by Mark Leialoha / Terri Berg Photographic education equipment 88 IN THE STUDIO 24 NEW AND NOTABLE The Reinvention Of Neil Peart by William F. Miller 28 PRODUCT CLOSE-UP Bison Snare Drum 100 HEAD TALK by Rick Mattingly Head Games: A "Good Time" Had By All 29 Vic Firth Accessories by Luther Rix by Rick Mattingly 112 ROCK 'N' JAZZ CLINIC 33 Engineered Percussion A New Look At An Old Idea Axis X Bass Drum And Hi-Hat Pedals by David Garibaldi by Chap Ostrander 114 ROCK PERSPECTIVES Stewart Copeland: news Style & Analysis, Part 1 12 UPDATE by John Xepoleas Jason Cooper of the Cure, Goldfinger's Darrin Pfeiffer, Bernie Dresel 116 STRICTLY TECHNIQUE of the Brian Setzer Orchestra, and Al Webster, plus News Groupings, -

The May 2017 Rivah Visitor's Guide
May 2017 • FREE Places to go and things to do in the Northern Neck and Middle Peninsula Inside: • A home away from home: Local Airbnbs • Uncover the history of Fairfield Plantation • Lost Films of the Northern Neck • Dining at Hana Sushi in Gloucester Advertise in the 2017 Rivahs! Issue ................... AdDeadline .......... On June ................... Newsstands May 15 .............. May 25 July .................... June 19 ............. June 29 August .................. July 17 .............. July 27 September ............... August 21 ........... August 31 Fall/Holiday .............. October 9 ............ October 19 SUPER SAVINGS by advertising in more than one issue! Call the Southside Sentinel at 758-2328 or the Rappahannock Record at 435-1701 or email [email protected] or [email protected] July 2016 • FREE Places to go and things August 2016 • to do in the Northern Neck FREE and Middle Peninsula Places to go and things June 2016 • FREE to do in the Northern Neck Places to go and things and Middle Peninsula to do in the Northern Neck and Middle Peninsula September/October 2016 FREE Places to go and things May 2016 • to do in the Northern Neck and Middle Peninsula FREE Places to go and things to do in the Northern Neck and Middle Peninsula November/December 2016 Places to go and things to do in the Northern Neck and Middle Peninsula FREE Inside: Inside:Insid • Local beaches:es: Sun,Sununnn,, sassandandd andand susurf Best e: e h T f • On CallCall • Cool down with homemadehomomemememaemadmadeadee ice crcreameam OfO The with -

Desert Skies Tucson Amateur Astronomy Association
Desert Skies Tucson Amateur Astronomy Association Volume LIV, Number 2 February, 2008 Messenger to Mercury ♦ Learn about the 2009 Interna- ♦ Bernhard Schmidt, developer of tional Year of Astronomy the Schmidt camera ♦ School star parties ♦ A Martian Christmas Eve ♦ Viewing at A Total Solar Eclipse ♦ Constellation of the month Desert Skies: February, 2008 2 Volume LIV, Number 2 Cover Photo: Spacecraft Messenger shows views of an interesting crater, ridges, and cliffs during a close approach of Mercury. Images from http://messenger.jhuapl.edu TAAA Web Page: http://www.tucsonastronomy.org TAAA Phone Number: (520) 792-6414 Office/Position Name Phone E-mail Address President Bill Lofquist 297-6653 [email protected] Vice President Ken Shaver 762-5094 [email protected] Secretary Steve Marten 307-5237 [email protected] Treasurer Terri Lappin 977-1290 [email protected] Member-at-Large George Barber 822-2392 [email protected] Member-at-Large Keith Schlottman 290-5883 [email protected] Member-at-Large Teresa Plymate 883-9113 [email protected] Chief Observer Wayne Johnson 586-2244 [email protected] AL Correspondent (ALCor) Nick de Mesa 797-6614 [email protected] Astro-Imaging SIG Steve Peterson 762-8211 [email protected] Computers in Astronomy SIG Roger Tanner 574-3876 [email protected] Beginners SIG JD Metzger 760-8248 [email protected] Newsletter Editor George Barber 822-2392 [email protected]