Tabakmultis (Ttcs*) Und Gesundheitspolitik
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tobacco Labelling -.:: GEOCITIES.Ws
Council Directive 89/622/EC concerning the labelling of tobacco products, as amended TAR AND NICOTINE CONTENTS OF THE CIGARETTES SOLD ON THE EUROPEAN MARKET AUSTRIA Brand Tar Yield Nicotine Yield Mg. Mg. List 1 A3 14.0 0.8 A3 Filter 11.0 0.6 Belvedere 11.0 0.8 Camel Filters 14.0 1.1 Camel Filters 100 13.0 1.1 Camel Lights 8.0 0.7 Casablanca 6.0 0.6 Casablanca Ultra 2.0 0.2 Corso 4.0 0.4 Da Capo 9.0 0.4 Dames 9.0 0.6 Dames Filter Box 9.0 0.6 Ernte 23 13.0 0.8 Falk 5.0 0.4 Flirt 14.0 0.9 Flirt Filter 11.0 0.6 Golden Smart 12.0 0.8 HB 13.0 0.9 HB 100 14.0 1.0 Hobby 11.0 0.8 Hobby Box 11.0 0.8 Hobby Extra 11.0 0.8 Johnny Filter 11.0 0.9 Jonny 14.0 1.0 Kent 10.0 0.8 Kim 8.0 0.6 Kim Superlights 4.0 0.4 Lord Extra 8.0 0.6 Lucky Strike 13.0 1.0 Lucky Strike Lights 9.0 0.7 Marlboro 13.0 0.9 Marlboro 100 14.0 1.0 Marlboro Lights 7.0 0.6 Malboro Medium 9.0 0.7 Maverick 11.0 0.8 Memphis Classic 11.0 0.8 Memphis Blue 12.0 0.8 Memphis International 13.0 1.0 Memphis International 100 14.0 1.0 Memphis Lights 7.0 0.6 Memphis Lights 100 9.0 0.7 Memphis Medium 9.0 0.6 Memphis Menthol 7.0 0.5 Men 11.0 0.9 Men Light 5.0 0.5 Milde Sorte 8.0 0.5 Milde Sorte 1 1.0 0.1 Milde Sorte 100 9.0 0.5 Milde Sorte Super 6.0 0.3 Milde Sorte Ultra 4.0 0.4 Parisienne Mild 8.0 0.7 Parisienne Super 11.0 0.9 Peter Stuyvesant 12.0 0.8 Philip Morris Super Lights 4.0 0.4 Ronson 13.0 1.1 Smart Export 10.0 0.8 Treff 14.0 0.9 Trend 5.0 0.2 Trussardi Light 100 6.0 0.5 United E 12.0 0.9 Winston 13.0 0.9 York 9.0 0.7 List 2 Auslese de luxe 1.0 0.1 Benson & Hedges 12.0 1.0 Camel 15.0 1.0 -

The Reason Given for the UK's Decision to Float Sterling Was the Weight of International Short-Term Capital
- Issue No. 181 No. 190, July 6, 1972 The Pound Afloat: The reason given for the U.K.'s decision to float sterling was the weight of international short-term capital movements which, despite concerted intervention from the Bank of England and European central banks, had necessitated massive sup port operations. The U.K. is anxious that the rate should quickly o.s move to a "realistic" level, at or around the old parity of %2. 40 - r,/, .• representing an effective 8% devaluation against the dollar. A w formal devaluation coupled with a wage freeze was urged by the :,I' Bank of England, but this would be politically embarrassing in the }t!IJ light of the U.K. Chancellor's repeated statements that the pound was "not at an unrealistic rate." The decision to float has been taken in spite of a danger that this may provoke an international or European monetary crisis. European markets tend to consider sterling as the dollar's first line of defense and, although the U.S. Treasury reaffirmed the Smithsonian Agreement, there are fears throughout Europe that pressure on the U.S. currency could disrupt the exchange rate re lationship established last December. On the Continent, the Dutch and Belgians have put forward a scheme for a joint float of Common Market currencies against the dollar. It will not easily be implemented, since speculation in the ex change markets has pushed the various EEC countries in different directions. The Germans have been under pressure to revalue, the Italians to devalue. Total opposition to a Community float is ex pected from France (this would sever the ties between the franc and gold), and the French also are adamant that Britain should re affirm its allegiance to the European monetary agreement and return to a fixed parity. -

Carreras-Limited-Annual-Report-2012
Carreras has had a rich history in Jamaica. From as early as the 1930s, Carreras UK sold some of its cigarette brands in Jamaica. In the late 1950's to the early 1960's those cigarettes were distributed by Bonitto Brothers. The relationship with Jamaica deepened when in 1962 Carreras of Jamaica was registered 'to carry on business as tobacco and cigar merchants and importers of and dealers in tobacco, cigars, cigarettes, snuff, matchlights, pipes and any other articles required by or useful to smokers…' From 1975 to 1994, we diversified our operations to own 11 different companies* in the service, agriculture and manufacturing sectors, but divested ourselves of the non- tobacco businesses in 2004. In June 1999, BAT merged with Rothmans International and acquired controlling interest in Carreras Limited. Carreras has a special place in Jamaica's history as the first Company to establish a manufacturing plant in post- independent Jamaica. We take this distinction seriously and have been exemplary in contributing to the nation's growth and development over these last 50 years. We have built a reputation for producing high quality cigarette brands to meet the diverse tastes of our consumers, created employment, especially during the period of our significantly diversified operations, discharged our fiduciary responsibilities with the History utmost care and implemented corporate social responsibility initiatives which have empowered numerous lives. We salute Jamaica as together we celebrate this important milestone in both our histories, -

The Future of Tobacco Sponsorship of Sport in Canada by John Anthony
The Future of Tobacco Sponsorship of Sport in Canada by John Anthony McKibbon A Thesis Submitted to the College of Graduate Studies and Research through the Department of Kinesiology in partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Master of Human Kinetics at the University of Windsor Windsor. Ontario, Canada 2000 National Library Bibliothèque nationale 1*1 of Canada du Canada Acquisitions and Acquisitions et Bibiiographic Services services bibliographiques 395 Wellington Street 395. nw, Welligtori OttawaON KlAOM OttawaON KlAON4 Canada canada The author has granted a non- L'auteur a accordé une licence non exclusive licence allowing the exclusive permettant à la National Library of Canada to Bibliothèque nationale du Canada de reproduce, loan, distribute or sel1 reproduire, prêter, distribuer ou copies of this thesis in microfom, vendre des copies de cette thèse sous paper or electronic formats. la forme de microfiche/film, de reproduction sur papier ou sur format électronique. The author retains ownership of the L'auteur conserve la propriété du copyright in this thesis. Neither the droit d'auteur qui protège cette thèse. thesis nor substantial extracts fiom it Ni la thèse ni des extraits substantiels rnay be printed or otherwise de celle-ci ne doivent être imprimés reproduced without the author's ou autrement reproduits sans son permission. autorisation. The Future of Tobacco Sponsorship of Sport in Canada 02000 John Anthony McKibbon This study was designed to uncover the predictions of experts regarding the fùture of tobacco sponsorship of sport in Canada. The Delphi Technique was used as the research protocol. A census of al1 marketing managers of tobacco brands involved in sport sponsonhip (N=4) and elite sporting events that utilize sponsorship funds from tobacco companies (N=7) were involved in the study. -

Stop Smoking Systems BOOK
Stop Smoking Systems A Division of Bridge2Life Consultants BOOK ONE Written by Debi D. Hall |2006 IMPORTANT REMINDER – PLEASE READ FIRST Stop Smoking Systems is Not a Substitute for Medical Advice: STOP SMOKING SYSTEMS IS NOT DESIGNED TO, AND DOES NOT, PROVIDE MEDICAL ADVICE. All content, including text, graphics, images, and information, available on or through this Web site (“Content”) are for general informational purposes only. The Content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. NEVER DISREGARD PROFESSIONAL MEDICAL ADVICE, OR DELAY IN SEEKING IT, BECAUSE OF SOMETHING YOU HAVE READ IN THIS PROGRAMMATERIAL. NEVER RELY ON INFORMATION CONTAINED IN ANY OF THESE BOOKS OR ANY EXERCISES IN THE WORKBOOK IN PLACE OF SEEKING PROFESSIONAL MEDICAL ADVICE. Computer Support Services Not Liable: IS NOT RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY ADVICE, COURSE OF TREATMENT, DIAGNOSIS OR ANY OTHER INFORMATION, SERVICES OR PRODUCTS THAT YOU OBTAIN THROUGH THIS SITE. Confirm Information with Other Sources and Your Doctor: You are encouraged to confer with your doctor with regard to information contained on or through this information system. After reading articles or other Content from these books, you are encouraged to review the information carefully with your professional healthcare provider. Call Your Doctor or 911 in Case of Emergency: If you think you may have a medical emergency, call your doctor or 911 immediately. DO NOT USE THIS READING MATERIAL OR THE SYSTEM FOR SMOKING CESSATION CONTAINED HEREIN FOR MEDICAL EMERGENCIES. No Endorsements: Stop Smoking Systems does not recommend or endorse any specific tests, products, procedures, opinions, physicians, clinics, or other information that may be mentioned or referenced in this material. -

Annual Report 2020
British American Tobacco (2012) Limited Registered Number 08277101 Annual report and financial statements For the year ended 31 December 2020 British American Tobacco (2012) Limited Contents Strategic report .................................................................................................................................... 2 Directors’ report ................................................................................................................................... 4 Independent auditor's report to the members of British American Tobacco (2012) Limited ............... 6 Profit and loss account and statement of changes in equity ............................................................... 9 Balance sheet .................................................................................................................................... 10 Notes to the financial statements for the year ended 31 December 2020 ........................................ 11 British American Tobacco (2012) Limited Strategic report The Directors present their strategic report on British American Tobacco (2012) Limited (the “Company”) for the year ended 31 December 2020. Principal activities The Company’s principal activity is the holding of investments in companies operating in the tobacco and nicotine industry as members of the British American Tobacco p.l.c. group of companies (the “Group”). Review of the year ended 31 December 2020 The profit for the financial year attributable to British American Tobacco (2012) Limited shareholders -

Annual Report and Accounts 06
Annual Report and Accounts 06 Annual Review and Summary Financial Statement and Directors’ Report and Accounts 2006 WorldReginfo - 98675577-a5f8-41aa-ac01-37c1b8bcb2da About this combined Report The format of our reporting has been changed to accommodate the inclusion, for the first time, of an Operating and Financial Review (OFR). In preparing the OFR, we have sought to take into account, where considered appropriate, the best practice set out in the UK Accounting Standards Board’s ‘Reporting Statement: Operating and Financial Review’. We have responded to the spirit of the OFR by offering shareholders a balanced and comprehensive analysis of our current business and describing the significant industry trends that are likely to influence our future prospects. For the first time, we have published our Key Performance Indicators, some other important Business Measures and the Group’s Key Risk Factors. We have also attempted to avoid having too much information in one publication. Our corporate website bat.com has a wealth of material about the Group and, in May 2007, we plan to publish our latest Social Report, detailing progress during 2006 on a range of commitments and actions. We will carefully consider the structure and content of our future reporting in the light of developments in the field and the advice and comments we receive about this publication. The full content of this combined Report is under this flap. Leave it open as a reference to find your way to the different topics covered. Cautionary Statement: the Operating and Financial Review and certain other sections of this document contain forward looking statements which are subject to risk factors associated with, among other things, the economic and business circumstances occurring from time to time in the countries and markets in which the Group operates. -
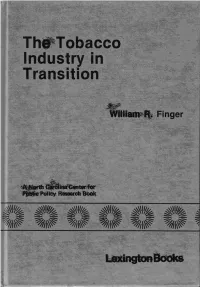
Tobacco Industry in Transition the Tobacco Industry in Transition
•i_r, _ : #w .1o nt. Md' rYrM$ ! i 1ip1 ' _f awret ysrswldsw ° . :' ! • '; : a 1 : I The Tobacco Industry in Transition The Tobacco Industry in Transition Policies for the 1980s Edited by William R. Finger North Carolina Center for Public Policy Research, Inc. LexingtonBooks D.C. Heath and Company Lexington, Massachusetts Toronto Library of Congress Cataloging in Publication Data Main entry under title: The Tobacco industry in transition. 1. Tobacco manufacture and trade-Government policy-United States. 2. Tobacco manufacture and trade-United States. I. Finger, William R. II. North Carolina Center for Public Policy Research. HD9136.T6 338.1'7371'0973 81-47064 ISBN 0-669-04552-7 AACR2 Copyright © 1981 by North Carolina Center for Public Policy Research, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmit- ted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher. Published simultaneously in Canada Printed in the United States of America International Standard Book Number: 0-669-04552-7 Library of Congress Catalog Card Number: 81-47064 Contents Acknowledgments ix Introduction William R. Finger Xi Part I The Tobacco Program and the Farmer 1 Chapter 1 Early Efforts to Control the Market-And Why They Failed Anthony J. Badger 3 Chapter 2 The Federal Tobacco Program: How It Works and Alternatives for Change Charles Pugh 13 Chapter 3 Landmarks in the Tobacco Program Charles Pugh 31 Chapter -

Fifteen Into One?
fifteen into one art 19/11/2002 9:14 am Page 1 EPRU Fifteen into one European Series Fifteen into one? Policy The European Union and its member states Research Unit Series The European Union and the roles of member states is one of the major topics of political debate and academic discourse. The evolution of the political system in Brussels and the developments within the individual member states promise new insights into the European integration process. This book provides a country-by- Fifteen country analysis of how European policy is made and applied in the member states. Its central focus is the involvement of national institutions in European policy-making: governments, parliaments, sub-national governments, the courts and public administrations. Who participates at which stages of the European Union’s policy cycle and how do national institutions and non-state actors interact into one? and fit into the Union’s system? The contributors show how member states have adapted their institutional structures in different ways to European integration, especially since the Maastricht The European Treaty. The editors argue that the extent and intensity of institutional interaction between the EU and its member states have led to a ‘system of institutional fusion’. Wessels, Maurer & Mittag Maurer Wessels, This timely book is the most comprehensive study yet of European policy-making Union and its at the national level and is aimed at scholars of integration studies and comparative politics. Professor Wolfgang Wessels is Jean Monnet Chair of -

Tobacco Industry Activities in Pakistan 1992 – 2002 / World Health Organization
WHO-EM/TFI/055/E Tobacco industry activities in Pakistan 1992–2002 Tobacco industry activities in Pakistan, 1992–2002.indd 6 9/7/2010 11:23:24 AM WHO-EM/TFI/055/E Tobacco industry activities in Pakistan 1992–2002 WHO Library Cataloguing in Publication Data World Health Organization. Regional Office for the Eastern Mediterranean Tobacco industry activities in Pakistan 1992 – 2002 / World Health Organization. Regional Office for the Eastern Mediterranean p. WHO-EM/TFI/055/E 1. Tobacco Industry - Pakistan 2. Tobacco – economics 3. Smoking - prevention and control I. Title II. Regional Office for the Eastern Mediterranean (NLM Classification: HD 9130) This publication is the product of contributions by several individuals. The publication was written, and revised, by Joshua Yang, California State University Fullerton. The draft was reviewed by Farrukh Qureshi and Fatima El Awa, WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean. Financial support for this publication was provided by Bloomberg Philanthropies. © World Health Organization 2010 All rights reserved. The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. The mention of specific companies or of certain manufacturers’ products does not imply that they are endorsed or recommended by the World Health Organization in preference to others of a similar nature that are not mentioned. -

Compagnie Financière Richemont AG Is a Swiss-Based Holding Company Which Exercises Financial and Operational Control Over Compa
Compagnie Financière Richemont AG is a Swiss-based holding company which exercises financial and operational control over companies operating primarily in the fields of tobacco and luxury goods. In addition, Richemont holds investments in the electronic media and direct marketing industries. It is the ultimate parent of a family of some of the world’s leading consumer brands. The Group is managed with a view to the profitable long-term development of successful international brands. 1 C ONTENTS Financial Highlights 3 Directors and Company Information 4 Letter to Unitholders 5 Group Structure 6 Review of the Year 7 Financial Review 41 Consolidated Financial Statements –Directors’ Report 52 –Statement of Accounting Policies 53 –Consolidated Profit and Loss Account 56 –Consolidated Balance Sheet 57 –Consolidated Cash Flow Statement 58 –Notes to the Consolidated Financial Statements 59 Company Financial Statements –Compagnie Financière Richemont AG 73 –Richemont SA 79 Principal Group Companies 86 Notice of Meeting 88 2 F INANCIAL H IGHLIGHTS 1996 1995 Increase £ £ Net sales revenue 4 306.9 m 3 852.1 m 11.8% Operating profit 798.9 m 688.0 m 16.1% Attributable profit – excluding exceptional items and – goodwill amortisation 316.1 m 261.9 m 20.7% – including exceptional items and – goodwill amortisation 416.4 m 279.6 m 48.9% Earnings per unit – excluding exceptional items and – goodwill amortisation 55.05 45.61 20.7% – including exceptional items and – goodwill amortisation 72.52 48.69 48.9% Dividend per unit 8.00 7.00 14.3% 4306.9 798.9 55.05 8.00 7.00 3852.1 3665.1 45.61 6.15 3 5.88 /4 3443.1 688.0 1 5.62 /2 3108.3 36.59 36.42 35.58 608.7 596.3 577.0 92 93 94 95 96 92 93 94 95 96 92 93 94 95 96 92 93 94 95 96 NET SALES REVENUE (£ m) OPERATING PROFIT (£ m) EARNINGS PER UNIT* (£) DIVIDEND PER UNIT (£) *Earnings per unit have been presented on an adjusted basis, excluding the effects of exceptional items and goodwill amortisation. -

Brevets D'invention Uitvindingsoctrooien
ROYAUME DE BELGIQUE - KONINKRIJK BELGIE MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE COMMERCIALE - BESTUUR HANDELSBELEID OFFICE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (OPRI) DIENST VOOR DE INDUSTRIELE EIGENDOM (DIE) RECUEIL DES Brevets d'invention VERZAMELING VAN DE Uitvindingsoctrooien TABLES 1997 TABELLEN Tome 1 – Deel 1 BREVETS D'INVENTION TABLES - 1997 - TABELLEN UITVINDINGSOCTROOIEN RECUEIL DES BREVETS D'INVENTION VERZAMELING VAN DE UITVINDINGSOCTROOIEN TABLES TABELLEN SOMMAIRE INHOUD 1997 - N° 13 Pages - Blz. I TABLE DES BREVETS PUBLIES 1 I TABEL VAN DE GEPUBLICEERDE OCTROOIEN II TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS DES 3 II ALFABETISCHE TABEL VAN DE NAMEN VAN BREVETES DE OCTROOIHOUDERS III TABLE ANALYTIQUE DES INVENTIONS 16 III ANALYTISCHE TABEL VAN DE GEOCTROOI- BREVETEES EERDE UITVINDINGEN … Relatives aux brevets publiés au cours de l'année … Betreffende de octrooien gepubliceerd in de loop van het jaar IV TABLE NUMERIQUE DES BREVETS 26 IV NUMERIEKE TABEL VAN DE VERVALLEN DECHUS (pour défaut de paiement de la taxe OCTROOIEN (wegens niet-betaling van de annuelle due pour le maintien en vigueur verschuldigde jaartaks voor de instandhouding des brevets) van de octrooien) V TABLE ALPHABETIQUE DES BREVETS 115 V ALFABETISCHE TABEL VAN DE VERVALLEN DECHUS (pour défaut de paiement de la taxe OCTROOIEN (wegens niet-betaling van de l annuelle due pour le maintien en vigueur verschuldigde jaartaks voor de instandhouding des brevets) van de octrooien) VI TABLE NUMERIQUE DES BREVETS 211 VI NUMERIEKE TABEL