Geschichte Der Kodifikation Des Zivilrechts in Ungarn
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Criminal Code
Criminal Code Warning: this is not an official translation. Under all circumstances the original text in Dutch language of the Criminal Code (Wetboek van Strafrecht) prevails. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the use of this translation. Criminal Code (Text valid on: 01-10-2012) Act of 3 March 1881 We WILLEM III, by the grace of God, King of the Netherlands, Prince of Orange-Nassau, Grand Duke of Luxemburg etc. etc. etc. Greetings to all who shall see or hear these presents! Be it known: Whereas We have considered that it is necessary to enact a new Criminal Code; We therefore, having heard the Council of State, and in consultation with the States General, have approved and decreed as We hereby approve and decree, to establish the following provisions which shall constitute the Criminal Code: Book One. General Provisions Part I. Scope of Application of Criminal Law Section 1 1. No act or omission which did not constitute a criminal offence under the law at the time of its commission shall be punishable by law. 2. Where the statutory provisions in force at the time when the criminal offence was committed are later amended, the provisions most favourable to the suspect or the defendant shall apply. Section 2 The criminal law of the Netherlands shall apply to any person who commits a criminal offence in the Netherlands. Section 3 The criminal law of the Netherlands shall apply to any person who commits a criminal offence on board a Dutch vessel or aircraft outside the territory of the Netherlands. -

NETHERLANDS Table of Contents
2020 PROXY PAPER™ GUIDELINES AN OVERVIEW OF THE GLASS LEWIS APPROACH TO PROXY ADVICE NETHERLANDS Table of Contents GUIDELINES INTRODUCTION .........................................................................................................................1 Corporate Governance Background ...............................................................................................................................................1 Regulatory Updates ..............................................................................................................................................................................1 Summary of Changes for the 2020 Netherlands Policy Guidelines ..................................................................................2 A SUPERVISORY BOARD THAT SERVES THE INTERESTS OF SHAREHOLDERS ....................3 Election of Board Members...............................................................................................................................................................3 Independence .........................................................................................................................................................................................3 Other Considerations for Individual Board Members .............................................................................................................5 External Commitments ...........................................................................................................................................................................................5 -

Journal of Civil Law Studies
Journal of Civil Law Studies Volume 7 | Number 1 Article 11 10-29-2014 Complete V.7 No.1 Follow this and additional works at: https://digitalcommons.law.lsu.edu/jcls Part of the Civil Law Commons Repository Citation Complete V.7 No.1, 7 J. Civ. L. Stud. (2014) Available at: https://digitalcommons.law.lsu.edu/jcls/vol7/iss1/11 This Complete Issue is brought to you for free and open access by the Law Reviews and Journals at LSU Law Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Journal of Civil Law Studies by an authorized editor of LSU Law Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. Volume 7 Number 1 2014 ___________________________________________________________________________ ARTICLES . Law and the Lodestar: Tunisian Civil Law and the Task of Ordering Plurality in the Aftermath of the Jasmine Revolution .................................................. Dan E. Stigall . Mixed Jurisdiction and the Scottish Legal Tradition: Reconsidering the Concept of Mixture ................................................................. Stephen Thomson . Civil Status and Civil Registry: Current Trends in Spanish Law ...................Sofía de Salas Murillo . Enlarged State Power to Declare Nullity: The Hidden State Interest in the Chinese Contract Law .................................................... Hao Jiang CIVIL LAW TRANSLATIONS . Louisiana Civil Code - Code civil de Louisiane Book III, Titles 7 and 8 ..........................................................................Center of Civil Law Studies CIVIL -

E-Justice and International Land Conveyancing
UNIO - EU Law Journal. Vol. 5, No. 1, January 2019, pp 76-84. ®2019 Centre of Studies in European Union Law School of Law – University of Minho E-justice and international land conveyancing Afonso Patrão* ABSTRACT: This paper explores the obstacles regarding cross-border transactions on immoveable property within the European Union. The existence of obstacles to the exercise of the freedom of movement of capitals, such as travel costs to the country where the property is located and finding a notary there, may even lead the parties not to enter in those contracts. E-justice solutions are being created to solve such situations and this paper reflects if they are enough to overcome the difficulties and rectify current deficiencies. It concludes by examining the tendency of solving the difficulties of international cooperation between non-judicial authorities through e-Justice tools. KEYWORDS: E-justice – freedom of movement of capital – land registrar – notary – international land conveyancing. * Professor at the Faculty of Law of the University of Coimbra. ® UNIO - EU LAW JOURNAL Vol. 5, No. 1, January 2019 I. The problem In cross-border transactions on immoveable property within the European Union, guaranteed by the basic freedoms (specially freedom of movement of capital), a major obstacle exists: because Member States often establish preventive systems on conveyancing – obliging the contract to be concluded before a public notary or other authority, ruling out causes of invalidity, and submitting the production of all legal effects to a Land Registrar’s decision –, contracting in a different Member State of the situation of the plot of land is a difficult task. -

To the Attention Of
To the attention of: Committee on the Rights of Persons with Disabilities Human Rights Treaties Division Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights United Nations Office at Geneva CH – 1201 Geneva Vienna, 6 January 2014 Ref: 2014-outgoing-000009 Subject: Contribution to the Draft General Comment on Article 12 of the CRPD – Equal recognition before the law Dear Madam or Sir, I am pleased to provide you with the EU Agency for Fundamental Rights’ (FRA) contribution to the above-mentioned Draft General Comment. In July 2013, the FRA published a report on Legal capacity of persons with mental health problems and persons with intellectual disabilities. The report presents FRA’s legal analysis of current standards and safeguards concerning the legal capacity of these two groups of persons. It twins this analysis with the lived experiences of a small number of interviewees regarding the loss of legal capacity and other restrictions on their ability to take decisions. The annex of the report, reproduced in this submission, presents an overview of the current legislation in the 28 EU Member States along with an overview of the last significant legislative amendments. I enclose copies of the report for your information. I hope that the information provided will be useful for the finalisation of the Draft General Comment. Should you need any further information, please consult the thematic page on our website and do not hesitate to contact me. Yours sincerely, Martha Stickings Equality & Citizens’ Rights Department European Union -
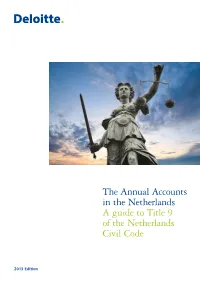
The Annual Accounts in the Netherlands a Guide to Title 9 of the Netherlands Civil Code
The Annual Accounts in the Netherlands A guide to Title 9 of the Netherlands Civil Code 2013 Edition Deloitte The Annual Accounts in the Netherlands – A guide to Title 9 of the Netherlands Civil Code Editorial staff: Ronald Smittenberg Principal authors: Peter Thomson Fred van der Giessen Dingeman Manschot The editorial staff and principal authors are affiliated with or employed by Deloitte Accountants B.V. © Deloitte, December 2013 Preface Before 1971, Dutch law with respect to the annual accounts of companies was rather limited. Over the last forty years, and due to European Directives, the regulations and legislation with respect to the annual accounts in the Netherlands have increased significantly. Following the introduction of the Euro, the European Union published the IAS-Regulation in 2002, which mandated the use of International Financial Reporting Standards as endorsed by the EU (IFRS-EU) for the consolidated financial statements of all listed companies as of 2005. In 2004, the Transparency Directive of the European Commission (Directive No. 2004/109/EG) was issued. This Directive was enacted into Dutch law in 2007 by means of the Financial Markets Supervision Act (Wft). The Wft deals with the supervision by the Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) of, for example, listed companies and financial institutions. The Wft is also covered in this publication. This publication provides a comprehensive overview of Title 9 Book 2 (hereinafter: Title 9) of the Netherlands Civil Code (NCC) with respect to the annual accounts in the Netherlands. It has been updated to reflect recent changes to the NCC, following the enactment of the ‘Flex-bv Act’. -

Declarations of Non-Infringement and Compulsory Licenses
Declarations of non- infringement and compulsory licences Essentials valid and National approaches Remedies UPC regime infringed to damages valid and not infringed Costs invalid and not infringed Declarations of non- Amendment/ Voluntary surrender invalid but infringement and limitations and central revocation infringed compulsory licences Declarations of non-infringement Introduction A patent permits its holder, the patentee, to exclude third parties, for a limited time and upon disclosure of the invention to the public, from doing certain acts without his consent. This right to exclude may be regarded by third parties acting in good faith as a threat to the continuity of their business. A third party may therefore benefit from a declaration by a court that a given product or process does not amount to an infringement of the patent. Consequently, some countries have enacted in their patent and/or procedural law provisions which allow a third party to seek declaratory relief from a national court, whereby the court will state whether or not a given embodiment is outside the scope of a given patent. Such declaratory relief and declaratory procedures are usually referred to as involving a declaration of non-infringement. Definition A declaration of non-infringement is a legally binding adjudication by which a third party involved in or anticipating a possible or actual European Patent Academy Patent litigation. Block 3 | Declarations of non-infringement and compulsory licences | 1 infringement dispute may ask a court to rule on its freedom to perform acts which might otherwise be at risk of being considered infringements. A third party will typically provide a written description of a specific embodiment of a product or process and request that the court hold such embodiment as not falling within the claims of a patent of another party. -

Originality in Belgian Civil Law: Comparing the Code Napoleon with Book 8 of the New Belgian Civil Code by Niels Vandezande and Jessica Schroers
ARTICLE: Originality in Belgian civil law: comparing the Code Napoleon with Book 8 of the New Belgian Civil Code By Niels Vandezande and Jessica Schroers Representatives (de Kamer) and after some small Introduction changes3 was approved on 4 April 2019 and published Originality requirements can be found in several in the Belgian State Gazette on 14 May 2019.4 The branches of Belgian law.1 Within civil law, the legislation enters into force on 1 November 2020. originality requirement stems from its preference for As explained at the hearing, the commission drafting evidence in writing, according a higher probative Book 8 had considered abolishing the legal system of value to written evidence than to other forms of evidence,5 which provides for legal certainty regarding evidence. Moreover, the originality requirement also evidence that is written and signed.6 However, it was exemplifies a certain formalism intended to protect decided to keep the regulated system of evidence, the weaker contract party. As a result of this since France and other European countries also formalism, the original is accorded a higher evidential maintain a degree of formalism in their systems of value than a copy. evidence.7 Nevertheless, the commission considered During the last two decades we have seen the that excessive formalism could impede daily business. introduction of electronic information processes – For this reason, it was proposed that the existing most importantly the electronic signature – in civil law. These processes allow parties to draft and conclude legally valid and binding agreements in 54 3349/001, 31 October 2018) http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3349/54K3349001.pdf electronic form. -

Echtscheiding in Islamitisch Recht
Faculteit Rechtsgeleerdheid Academiejaar 2010-2011 Echtscheiding in Islamitisch recht Masterproef van de opleiding „Master in de rechten‟ Ingediend door Cigdem Sipahi (studentennr. 20003211) (major: burgerlijk recht en stafrecht) Promotor: Professor Dr. Walter De Bondt Commissaris: Lic. Steven Marysse Inhoudstafel Inhoudstafel…………………………………………………………………….......................I Inleiding……………………………………………………………………………………….1 Hoofdstuk 1. Islamitisch recht: historische schets………………………………………….5 Afdeling 1. Betekenissen van “Shari‟a”……………………………………………………….5 §1. “Shari‟a”…………………………………………………………………………………...5 §2. “Shari‟a”-begrippen………………………………………………………………………..7 2.1. “Shari‟a” als door God gegeven maatschappelijk ideaal……………………………….....7 2.2. “Shari‟a” als klassiek rechtsstelsel………………………………………………………..7 2.3. Hedendaagse varianten van “Shari‟a”………………………………………………….....7 §3. “Shari‟a” en nationaal recht………………………………………………………………..8 Afdeling 2. Primaire bronnen van “Shari‟a”…………………………………………………..9 §1. Koran……………………………………………………………………………………….9 §2. Traditie of “sunna”………………………………………………………………………..11 §3. Consensus of “idjmâ”……………………………………………………………………..13 §4. Redenering bij analogie of “qiyâs”……………………………………………………….13 Afdeling 3. Aanvullende bronnen van “Shari‟a”…………………………………………….13 §1. Zelfstandige interpretatie of “idjtihâd”…………………………………………………...14 §2. Gewoonte of “urf”………………………………………………………………………...15 Afdeling 4. Strekkingen en rechtsscholen binnen de Islam…………………………………..15 §1. Ontstaan van Islamitische strekkingen …………………………………………………...15 1.1. Soennieten …………………………………………………………………………….....15 -

On Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters
25 . 11 . 88 Official Journal of the European Communities No L 31 9 / 9 CONVENTION on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters Done at Lugano on 16 September 1988 ( 88 / 592/ EEC ) PREAMBLE THE HIGH CONTRACTING PARTIES TO THIS CONVENTION , ANXIOUS to strengthen in their territories the legal protection of persons therein established , CONSIDERING that it is necessary for this purpose to determine the international jurisdiction of their courts , to facilitate recognition and to introduce an expeditious procedure for securing the enforcement of judgments , authentic instruments and court settlements , AWARE of th6 links between them , which have been sanctioned in the economic field by the free trade agreements concluded between the European Economic Community and the States members of the European Free Trade Association , TAKING INTO ACCOUNT the Brussels Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters , as amended by the Accession Conventions under the successive enlargements of the European Communities , PERSUADED that the extension of the principles of that Convention to the States parties to this instrument will strengthen legal and economic cooperation in Europe , DESIRING to ensure as uniform an interpretation as possible of this instrument , HAVE in this spirit DECIDED to conclude this Convention and HAVE AGREED AS FOLLOWS : TITLE I TITLE II SCOPE JURISDICTION Article 1 This Convention shall apply in civil and commercial matters whatever the nature of the court or tribunal . It shall not Section 1 extend , in particular , to revenue , customs or administrative matters . General provisions The Convention shall not apply to : 1 . -

For • Purchasing Products and Services • (Sub)Contracting Work and • Insourcing Personnel
for • Purchasing products and services • (sub)contracting work and • Insourcing personnel January 2020 Products, Services, Subcontracting for Works and Insourcing of Personnel, as well as any other obligation arising from any such Definitions Contract. These General Conditions also apply to any offers made Unless indicated otherwise by a specific context, capitalised words by A.Hak and any requests from A.Hak to make an offer. and expressions in these General Conditions are words and expressions with the following specific definitions: 1.2 Once these general conditions become part of any Contract between A.Hak and Contractor, they also automatically become Acceptance: part of all subsequent Contracts between A.Hak and Contractor, The Work is deemed to have been completed after it has been also if the applicability of these general conditions is not explicitly approved by A.Hak for integration into the Principal Work. The referred to during the conclusion of any such subsequent date on which the Work is approved is the valid Acceptance Date. Contract; unless expressly agreed upon otherwise by both parties in writing. A.Hak: An entity that is part of the A.Hakpark Group, headquartered in 1.3 These general conditions consist of general and special Tricht, the Netherlands, which uses these conditions in its role as provisions. The general provisions apply to all Contracts between customer. A.Hak and Contractor as stated under 1.1. The special provisions supplement the general provisions and relate to and apply to Contract: defined specific Contracts. The agreement, whether composed of multiple components or not, entered into by A.Hak and Contractor, regarding a Work, 1.4 If multiple special provisions apply to the Contract, because it Delivery, Services, Personnel or a combination thereof, including is a composed Contract, the special provisions apply concurrently. -

Het Nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek- Verleden, Heden, Toekomst *
RECHTSKUNDIG WEEKBLAD 1994-1995- nr. 23-4 februari 1995 HET NIEUWE NEDERLANDSE BURGERLIJK WETBOEK- VERLEDEN, HEDEN, TOEKOMST * 1. Inleiding, plan en overzicht lijnse muur zijn de nieuwe democratieen in het Oosten druk op zoek naar de nodige juridische infrastructuur om een Nederland voert, stapsgewijs, een nieuw Burgerlijk Wet markteconomie te bouwen. De nieuwe staten zijn tot de vast boek in. In een artikel verschenen in een Feestnummer van stelling gekomen dat de meest recente codificatie van het het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht wordt deze burgerlijk en handelsrecht de Nederlandse is. Verscheidene gebeurtenis gevierd onder de titel «waarin ook een klein volk staten hebben dan ook samenwerkingsverbanden gecreeerd groot kan zijn». DeNederlanders zijn trots op hun verwezen met de Nederlanders met het oog op het opstellen van hun lijking. Terecht, want velen voelen zich geroepen om hun eigen burgerlijk wetboek, o.a. Rusland, Kazachstan, Oe burgerlijk recht te herschrijven, weinigen brengen het tot kra'ine, Wit-Rusland, Estland, Hongarije en Albanie. een goed einde. De Belgen kunnen daarover meespreken. Bekeken uit rechtsvergelijkend oogpunt is de hercodificatie 2. Het oude N ederlandse Burgerlijk Wetboek een belangwekkende gebeurtenis. In deze stu die onderzoeken we het verleden, het heden en 2.1. Ret oude N ederlandse Burgerlijk Wetboek werd van de toekomstvan het nieuwe Nederlandse B.W. We starten de kracht «met de klokslag van middernacht 1838». n Merk studie daarwaarwe ze moeten beginnen: in de eerste decen waardig is dat Nederland, met dit wetboek van 1383, reeds nia van de negentiende eeuw. In de periode dus waarin de co aan zijn derde Burgerlijk Wetboek toe was.