Tiroler Gailtal Und Lesachtal.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Impact of Climate and Geology on Event Runoff Characteristics at The
water Article Impact of Climate and Geology on Event Runoff Characteristics at the Regional Scale Xiaofei Chen 1,* , Juraj Parajka 1,2 , Borbála Széles 1 , Peter Valent 2,3, Alberto Viglione 4 and Günter Blöschl 1,2 1 Centre for Water Resource System, TU Wien, Karlsplatz 13, A-1040 Vienna, Austria; [email protected] (J.P.); [email protected] (B.S.); [email protected] (G.B.) 2 Institute of Hydraulic Engineering and Water Resources Management, TU Wien, Karlsplatz 13, A-1040 Vienna, Austria; [email protected] 3 Department of Land and Water Resources Management, Faculty of Civil Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, Slovakia 4 Polytechnico di Torino, Department of Environment, Land and Infrastructure Engineering, Corso Duca degli Abruzzi, 24, 10129 Torino, Italy; [email protected] * Correspondence: [email protected] Received: 11 November 2020; Accepted: 7 December 2020; Published: 9 December 2020 Abstract: The dynamics of flood event characteristics, such as the runoff coefficient and the recession time constant, differ in time and space, due to differences in climate, geology, and runoff generation mechanisms. This study examines the variability of event runoff characteristics and relates them to climatic and hydro-geological characteristics available at the regional scale. The main focus is to examine the role of rainfall patterns (i.e., event precipitation volume, precipitation intensity, and antecedent precipitation) and runoff regime (i.e., initial flow before runoff event and event duration) characteristics on the seasonal dynamics of runoff response. The analysis is performed in four small Austrian catchments representing different hydro-geological settings obtained by field mapping. -

Geological Excursion BASE-Line Earth
Geological Excursion BASE-LiNE Earth (Graz Paleozoic, Geopark Karavanke, Austria) 7.6. – 9.6. 2016 Route: 1. Day: Graz Paleozoic in the vicinity of Graz. Devonian Limestone with brachiopods. Bus transfer to Bad Eisenkappel. 2. Day: Visit of Geopark Center in Bad Eisenkappel. Walk on Hochobir (2.139 m) – Triassic carbonates. 3. Day: Bus transfer to Mezica (Slo) – visit of lead and zinc mine (Triassic carbonates). Transfer back to Graz. CONTENT Route: ................................................................................................................................... 1 Graz Paleozoic ...................................................................................................................... 2 Mesozoic of Northern Karavanke .......................................................................................... 6 Linking geology between the Geoparks Carnic and Karavanke Alps across the Periadriatic Line ....................................................................................................................................... 9 I: Introduction ..................................................................................................................... 9 II. Tectonic subdivision and correlation .............................................................................10 Geodynamic evolution ...................................................................................................16 Alpine history in eight steps ...........................................................................................17 -

Hanginstabilitäten Und Massenbewegungen Im Lesachtal / Kärnten
R. HOLZER, C. GORITSCHNIG: Lesachtal 159 Hanginstabilitäten und Massenbewegungen im Lesachtal / Kärnten R. HOLZER, C. GORITSCHNIG Abstract The present article should be considered as an attempt to register areas with a low slope stability along the river Gail in the Lesach valley in upper Carinthia (Southem Austria) and to divide them fr om areas with an increased slope stability. In many cases unstable slopes and the resulting mass movements are a relevant source of debris and might Iead subsequently to catastrophic mud tlows which endanger villages and agricultural areas quite fr equenly in alpine regions. For this reason any kind of slope fa ilure, old ones, covered with vegetation, and still active ones, has been mapped. The classification of slope fa ilures has been done according to M. MOSER (1973): RotatiOJlal landslides wilhout a preformed sliding plane • Transitional landslides on a prefonned sliding plane • Erosion by fl owing water • Tbc kind of slope fa ilure is mainly detennined by the lithological and structural attributes of the rock. In the Lesach valley the siltic talus cover, which is particularly thick above the Periadriatic Fault, is very often aftected by slope failures and other kinds of mass movements. Apart from that fine foliated cristalline schists, just like mica schists, phyllonites or chloritic schists tend to develop unstable slopes. Also the dcgrce of fracturing by joints and fa ults plays an important role. Many rocks (especially phyllonites) in the mapped area are ragged along their parting planes, so that they now appear as loose rocks. Slope fa ilures in moraines are not very common, however they can bring huge amounts of dcbris if they become unstable. -
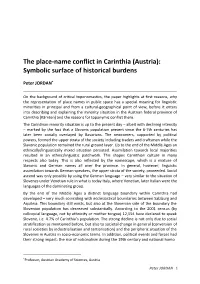
The Place-Name Conflict in Carinthia (Austria): Symbolic Surface of Historical Burdens
The place-name conflict in Carinthia (Austria): Symbolic surface of historical burdens Peter JORDAN* On the background of critical toponomastics, the paper highlights at first reasons, why the representation of place names in public space has a special meaning for linguistic minorities in principal and from a cultural-geographical point of view, before it enters into describing and explaining the minority situation in the Austrian federal province of Carinthia [Kärnten] and the reasons for toponymic conflict there. The Carinthian minority situation is up to the present day – albeit with declining intensity – marked by the fact that a Slavonic population present since the 6-7th centuries has later been socially overlayed by Bavarians. The newcomers, supported by political powers, formed the upper strata of the society including traders and craftsmen while the Slavonic population remained the rural ground layer. Up to the end of the Middle Ages an ethnically/linguistically mixed situation persisted. Assimilation towards local majorities resulted in an ethnic/linguistic patchwork. This shapes Carinthian culture in many respects also today. This is also reflected by the namescape, which is a mixture of Slavonic and German names all over the province. In general, however, linguistic assimilation towards German-speakers, the upper strata of the society, proceeded. Social ascend was only possible by using the German language – very similar to the situation of Slovenes under Venetian rule in what is today Italy, where Venetian, later Italian were the languages of the dominating group. By the end of the Middle Ages a distinct language boundary within Carinthia had developed – very much coinciding with ecclesiastical boundaries between Salzburg and Aquileia. -

LIFE-Projekt Gail – Kurzbericht Die Gail Wieder Lebendig Und Sicher
LIFE+ GAIL NATUR FLUSS LIFE-Projekt Gail – Kurzbericht die gail wieder lebendig und sicher 1 Vorworte Inhalt In den vergangenen fünf Mit dem LIFE-Projekt an Jahren ist an der mitt- der Gail hat die Bundes- leren Gail in den Gemein- wasserbauverwaltung den Feistritz, Nötsch und Kärnten ein eindrucksvol- St. Stefan viel passiert. les Zeichen gesetzt. Das Willkommen im Naturjuwel – Das Europaschutzgebiet Görtschacher Moos...................4 Nicht nur vor Ort am Fluss, sondern auch in Projekt zeigt einen gemeinsamen Weg für Die Gail: ein verbauter Fluss – Hintergründe zum LIFE-Projekt.............................................6 den Köpfen der Menschen. Sie haben ihren ein Optimum an ökologischer Verbesserung Fluss, die Gail, wieder bewusst erlebt und bei gleichzeitiger Einhaltung der schutzwas- Das LIFE-Projekt Gail – Ein Modell für integrative Gewässerentwicklung..........................8 schätzen gelernt – als Lebensader, als Naher- serwirtschaftlichen Vorgaben. Maßnahmen im Überblick..............................................................................................................10 holungsraum oder schlicht als Arbeitgeber In drei Pilotstrecken entlang der Gail wurden in einer ländlichen Region. unterschiedliche Maßnahmenvarianten zur Die Gail wird neu gebettet – Drei „Musterstrecken“ im Vergleich......................................12 Das LIFE-Projekt diente dabei immer wieder Instandhaltung des Abflussprofils umge- Maßnahmen außerhalb der Gail..................................................................................................16 -

Nötsch Im Gailtal – Marktgemeinde Seit 20 Jahren
AMTLICHE MITTEILUNG • ZUGESTELLT DURCH POST.AT SONDERAUSGABE DER MARKTGEMEINDE NÖTSCH IM GAILTAL SEPTEMBER 2019 Nötsch im Gailtal – Marktgemeinde seit 20 Jahren www.noetsch.at 02 Grußwort Die Verleihungsurkunde wurde von Landeshautpmann Dr. Jörg Haider im Zuge einer großen Markterhebungsfeier vom 25. – 27. Juni 1999 feierlich an Bürgermeister DI Franz Staudacher übergeben. 20 Jahre später können wir noch immer mit Stolz behaupten, dass unsere Marktgemeinde im Bereich der Infrastruktur, in der Wirtschaft, im Angebot der Freizeiteinrichtungen, im Tou- rismus und in besonderem Maße auf kulturellem Gebiet ein breites und hervorragendes Spektrum bietet. Mit diesem schönen Jubiläum wollen wir die kontinuierliche positive Entwicklung von der Vergangenheit bis in die Gegen- wart würdigen. Wir wollen dabei aber auch nicht vergessen, dass dies vor allem auch ein Verdienst der Bewohnerinnen und Bewohner von Nötsch im Gailtal ist, die durch ihre Arbeit und ihren Fleiß mit dazu beitragen, dass Nötsch im Gailtal sich ständig weiterentwickelt und in aller Munde ist. In dieser Festbroschüre wollen wir aufzeigen wie sich die Marktgemeinde heute durch ihre zentrale Struktur und durch ihre erhebliche Vielfalt an Angeboten und Versorgungsein- richtungen auszeichnet. In Nötsch im Gailtal wird ein breites Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Spektrum für den täglichen Grundbedarf, längerfristige Dien- Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! ste und Einrichtungen sowie eine Vielzahl an Aktivitäten und Angeboten auf sportlichem, touristischem, wirtschaftlichem, -

The Slovene Carinthians and the 1920 Plebiscite
SPRAWY NARODOWOŚCIOWE Seria nowa / naTiOnaliTIES AFFairs New series, 48/2016: 85–105 DOI: 10.11649/sn.2016.006 Maria isabella reinhard “an isOlaTed Case”*: The slOvene CarinThians and The 1920 PlebisCiTe absTraCT The end of WWI saw the dissolution of the multiethnic Cen- tral European Empires and the formation of new states based on Woodrow Wilson’s concept of national self-determination. This article underlines the limitations of Wilsonian national self-determination, focusing on the Slovene Carinthians and the pro-Austrian result of the 1920 plebiscite. The outcome of the plebiscite exemplifies that minorities are motivated by more than solely ethno-linguistic reasons when deciding what state to belong to. Even though other factors existed, the key motivations for Slovene Carinthians to remain with Austria were of economic and political nature. It will be con- tended that the importance of the centuries long accultura- tion of Slovene Carinthians to Austria brought them closer to Austria than to the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. Additionally the phrasing of the plebiscite made Slovene Car- inthians’ decision a question of state preference rather than ethno-linguistic identity. Moreover, the unpleasant occupation of parts of Carinthia by the troops of the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes and the higher effectiveness of Austri- an propaganda played a key role in the vote of many Slovene Carinthians. Lastly, the majority of Slovene Carinthians being farmers, reliant on Austrian trade opportunities, swayed them ............................... toward a pro-Austrian vote. Thus, the Carinthian plebiscite of Maria isabella reinhard 1920 builds a strong case against the assumption that ethno- University of St Andrews, St. -

Arnoldstein - AUSTRIA
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 385000 390000 395000 400000 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 13°30'0"E 13°33'0"E 13°36'0"E 13°39'0"E 13°42'0"E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -

Gerhard Neweklowsky Der Gailtaler Slowenische Dialekt: Feistritz an Der Gail/Bistrica Na Zilji Und Hohenthurn/Straja Vas
Gerhard Neweklowsky Der Gailtaler slowenische Dialekt: Feistritz an der Gail/Bistrica na Zilji und Hohenthurn/Straja vas. Unter Mitarbeit von Denise Branz, Christina Kircher-Zwittnig und Juruj Perč. Klagen- furt-Wien/Celovec-Dunaj: Drava Verlag/Založba Drava. 2013. 178 pa- ges. ISBN: 9783854357193. The languages of the “old” Slavic minorities in Austria, the Slovenes in Carinthia and Steiermark and the Croatians in the Burgenland, only rarely receive the atten- tion they deserve. This is surprising because these languages are of special interest to linguists for a number of reasons. Firstly, they show the effects of intense, long-term contact with neighbouring German dialects. These contacts often resulted in large- scale lexical and structural borrowing. Although all areas show heavy borrowing, the influence of German is not always equally large and the elements that were borrowed are not always identical. Secondly, both Slovene and Croatian spoken in Austria often preserve archaisms not found in Slovenian spoken in Slovenia or Croatian spoken in Croatia. Finally, the Slovene and Croatian dialects in Austria (unfortunately) often present interesting case studies for language loss and language death. Detailed studies of the subjects mentioned above are made more difficult be- cause of the linguistic heterogeneity of the Slovene and Croatian spoken in Aus- tria. In the case of Carinthian and Styrian Slovene, this is because their 1400-year presence in mountainous terrain with only limited mutual contact led to significant dialectal differences. In the case of Burgenland Croatian, the people who settled the Burgenland in the 16th century from various parts of what are now Bosnia and Croatia brought different dialects with them. -

Hermagor-Arnoldstein) Nebst Weiteren Beiträgen Zur Flora Von Kärnten 255-298 Download
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Jahrbuch des Naturhistorischen Landesmuseums von Kärnten Jahr/Year: 1900 Band/Volume: 26 Autor(en)/Author(s): Prohaska Karl Artikel/Article: Flora des unteren Gailthales (Hermagor-Arnoldstein) nebst weiteren Beiträgen zur Flora von Kärnten 255-298 download www.biologiezentrum.at Jlora des unteren Qailthales (Hermagor—Araoldsteiu) Beist weiteren Beiträgen m Flora von Kärnten. Von K arl Prohaska. Seit 1894 beschäftigte ich mich in den Hauptferien mit den Gefässpflanzen Kärntens und wendete meine Aufmerk samkeit namentlich der Flora des unteren Gailthale*. ins besondere der Pflanzenwelt der Umgebung von Hermagor zu. In der folgenden Abhandlung stelle icli die Ergebnisse, meiner Beobachtungen, die ich hiemit zu einem vorläutigen Abschlüsse bringe, in systematischer Reihenfolge zusammen. Ueber das Vorkommen, beziehungsweise über die V er breitung einiger schwieriger zu unterscheidenden Formen kritischer Gattungen, z. B. von Achillea. Thymus. Antium. im Gebiete habe ich mir bisher noch nicht volle Klarheit ver schaffen können. Hier sind noch weitere Beobachtungen nothig. Das Ergebnis derselben soll im Vereine mit etwaigen weiteren Funden aus dem Gailthale in einem Nachtrage geliefert werden. Den Standortsangaben liegen ausschliesslich meine eigenen Funde zugrunde. Die Belegstücke für die meisten der hier aufgezählten Arten und Formen erliegen in meinem Privatherbare. Der Inhalt meiner kleinen, in der ..Carinfhia II“ veröffentlichten, auf Kärnten bezugnehmenden floristischen Beiträge (Jahrgang 1895, p. 218—224. Jahrgang 1896, p. 237—245, Jahrgang 1897, p. 220—230) ist in die nach stehende Zusammenstellung mit einbezogen worden; einige dort gemachte irrige Angaben haben hiebei ihre Richtig stellung gefunden. download www.biologiezentrum.at Die Pflanzenwelt des Lesachthales ist uns durch Baron M. -

The Gail Once More Full of Life and Safe
LIFE+ GAIL NATUR FLUSS LIFE-project Gail – Concise Report the gail once more full of life and safe 1 Prefaces Content In the past five years, With the LIFE-project much has happened at at the Gail, the Federal the middle section of the Water Engineering Ad- Gail in the municipalities ministration in Carinthia of Feistritz, Nötsch and has set an impressive Welcome to one of Nature’s jewels – The European Protected Area Görtschacher Moos ...4 St. Stefan. Not only on site at the river, but sign. The project shows a common path for The Gail – a heavily regulated river................................................................................................6 also in the minds of the people. They have an optimum of ecological amelioration and once more experienced their river, the Gail, simultaneous adherence to the guidelines The LIFE-project Gail – A model for integrated river development.........................................8 and have learned to value it – as a life vein, a set by flood protection. An Overview of the Measures........................................................................................................10 local recreation area or simply as a source of On three pilot stretches along the Gail, employment in a rural region. different variants of measures for the A new bed for the Gail – A test with three „pilot stretches“.....................................................12 The LIFE-project repeatedly served as a maintenance of the discharge profile were Measures outside the Gail..............................................................................................................16 -

Carinthian Flow: Research by the River
Carinthian Flow: Research by the River High Tech Campus Villach GmbH Europastrasse 12 | 9524 Villach | Austria | Europe Phone +43.4242.24 800 | offi[email protected] www.hightechcampus.at A Park in the Park The High Tech Campus Villach is a center for technology enterprises, research and training facilities, offering ambitious start-ups the best environment for development of a good business idea into a successful company. With the focuses of electronics, microelectronics, mecha tronics, actoric s|sensorics, the “Park in the Park” is being constructed at the left banks of the river Drau in four steps. The location at the area of the tpv Techno logypark Villach and in direct proximity of the Carinthia University of Applied Sciences offers the best conditions for collaboration and cooperation. The first development stage of 4,000 square meters rental space is available immediately. The final development will cover about 16,000 square meters. 7 Buildings and rental space The buildings are two-floor reinforced-steel framework constructions with a highly heat-insulated wooden façade and opening wooden windows that are equipped with sun and glare protection on the outside. The central hot-water preparation and the central cooling facility using concrete core activation ensure the best control of the room climate. The lab and research areas on the ground floor have a room height of 3.90 meters. The office units on the upper floor can be designed flexibly. 3 meters high and with large windows, they form a ring around an atrium, accessible terraces and the large entrance area with a Green Wall.