Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

'Sharenting': the Forgotten Children of the GDPR
PHRG Peace Human Rights Governance Volume 4, Issue 1, March 2020 ‘Sharenting’: The Forgotten Children of the GDPR Sheila Donovan Research Articles* DOI: 10.14658/pupj-phrg-2020-1-2 How to cite: Donovan, S. (2020) ‘“Sharenting”: The Forgotten Children of the GDPR’, Peace Human Rights Governance, 4(1), 35-59. Article first published online March 2020 *All research articles published in PHRG undergo a rigorous double-blind review process by at least two independent, anonymous expert reviewers VA ADO UP P PHRG 4(1), March 2020 ‘Sharenting’: The Forgotten Children of the GDPR Sheila Donovan* Abstract The exponential growth of the internet and social media use in the recent past followed by a widespread increase of the scale, scope and sharing of information has impacted greatly on the concept of privacy. This growth has been accompanied by innumerable duplication and storage in perpetuity of personal data. While debates surrounding the protection and safety of social network users, in particular minor users have emerged as a matter of concern, there has been minimal focus on the privacy of minors, in particular, those minors who are the subject of ‘sharenting’ which is defined as ‘the online posting of images and data of children’. The introduction of the General Data Protection Regulation 2016 was designed to give more robust protection and rights to all individuals, in particular children, who were recognised as being particularly vulnerable. The GDPR, however, in seeking to address the security and safety of the private identity of minors who engage in social networking, places the oversight of minors’ digital privacy into parental hands, regardless of their digital competency. -

The “Puer Optionis:” Contemporary Childhood Adultization, Spectacularization, and Sexualization
Ricerche di Pedagogia e Didattica – Journal of Theories and Research in Education 12, 2 (2017). ISSN 1970-2221 The “Puer Optionis:” Contemporary childhood adultization, spectacularization, and sexualization Davide Cino ABSTRACT This paper tries to conceptualize postmodern childhood by suggesting the expression “Puer Optionis” as a way to summarize the condition of contemporary children in the Western world. Why are our children prone to looking for an audience? According to some academics, our Zeitgeist evolved and, along with it, the values spread through our children have changed, shifting from communitarian and altruistic to individualistic and narcissistic (Uhls, Greenfield, 2011). In a “spectacularized” society (Codeluppi, 2007), fame and desire for visibility are shown as goals to be reached during a developmental phase, childhood, where the construction of a belief system (Bandura A. et al., 1963) can considerably magnify them. Three examples of “showcases” are suggested, regarding the child spectacularization process: the city; the stage; social networking sites (SNS), opening a short parenthetical about “Sharenting.” Finally, an evolution of the Imaginary Audience theory by David Elkind (Elkind, 1967) will be assessed: in a world where every aspect of our lives can be dragged into the spotlight, is this audience still “imaginary?” What are the implications for our children and the educational challenges we face as educators? L’articolo propone un’analisi di alcuni aspetti dell’infanzia postmoderna, abitata da quello che viene definito “Puer Optionis”: il bambino adultizzato dell’attuale. Nell’intento di supportare la tesi per cui certi indicatori del nostro Zeitgeist stanno rendendo sempre più flebili i confini tra mondo adulto e infantile, verranno presentati i concetti di adultizzazione, vetrinizzazione e sessualizzazione. -

European Crime Prevention Network
European Crime Prevention Network Thematic Paper Youth Internet Safety: risks and prevention In the framework of the project ‘The further implementation of the Multiannual Strategy of the EUCPN and the Informal network on the Administrative Approach’- EUCPN Secretariat, May 2018, Brussels With the financial support of the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission – Directorate-General Home Affairs Thematic Paper Youth Internet Safety Abstract This thematic paper is published by the EUCPN Secretariat in connection with one of the EU priorities, more specifically cybercrime. It focusses on the prevention of risks children encounter online. A brief overview is given of several forms of cybercrime considering youth and what motives and facilitating factors enhance them. The last part of the paper focusses on prevention tips with existing examples. Citation EUCPN (2018). Youth Internet Safety: Risks and Prevention. In: EUCPN Secretariat (eds.), EUCPN Theoretical Paper Series, European Crime Prevention Network: Brussels. Legal Notice The contents of this publication do not necessarily reflect the official opinions of any EU Member State or any agency or institution of the European Union or European Communities. Authors Orchana De Corte, Intern, EUCPN Secretariat Jorne Vanhee, Research Officer, EUCPN Secretariat Cindy Verleysen, Senior Research Officer, EUCPN Secretariat Febe Liagre, Strategic Policy Officer, EUCPN Secretariat EUCPN Secretariat Waterloolaan / Bd. De Waterloo 76 1000 Brussels, Belgium Phone: +32 2 557 33 30 Fax: +32 2 557 35 23 [email protected] – www.eucpn.org 2 Thematic Paper Youth Internet Safety Table of contents 1. Introduction ................................................................................................. 4 2. International legislation: ............................................................................... 6 3. Dangers on the internet ............................................................................... -

A Dangerous Inheritance: a Child's Digital Identity
A Dangerous Inheritance: A Child’s Digital Identity Kate Hamming* “[Y]ou can choose your friends but you sho’ can’t choose your family, an’ they’re still kin to you no matter whether you acknowledge ‘em or not, and it makes you look right silly when you don’t.”1 ABSTRACT This Comment begins with one family’s story of its experience with social media that many others can relate to in today’s ever-growing world of technology and the Internet. Technology has made it possible for a person’s online presence to grow exponentially through continuous sharing by other Internet users. This ability to communicate and share information amongst family, friends, and strangers all over the world, while beneficial in some regard, comes with its privacy downfalls. The risks to privacy are elevated when children’s information is being revealed, which often stems from a child’s own parents conduct online. Parents all over the world are creating their children’s digital identities before these children even have the chance to develop them on their own. And other safety issues are often overlooked, such as those relating to online pedophiles and identity theft. This Comment argues the need for a legislative solution in the United States incentivizing adults to restrict the types of information that they choose to disclose online. However, such legislation must consider First Amendment hurdles and incorporate realistic and unambiguous restrictions, which are based in tort law and provide for a private right of action that can ultimately serve the specific * J.D. Candidate 2020, Seattle University School of Law; B.A., University of Washington; Sympo- sium Chair, Seattle University Law Review. -

To Stop Sharenting & Other Children's Privacy Harms, Start Playing
PLUNKETT (DO NOT DELETE) 6/4/2020 2:40 PM TO STOP SHARENTING & OTHER CHILDREN’S PRIVACY HARMS, START PLAYING: A BLUEPRINT FOR A NEW PROTECTING THE PRIVATE LIVES OF ADOLESCENTS AND YOUTH (PPLAY) ACT Leah Plunkett* I. SHARENTING: WHAT IT IS & WHY IT IS RISKY (AND ALSO WHY IT CAN BE BENEFICIAL) .............................................................. 460 A. Sharenting Snapshot .......................................................... 460 B. Criminal, Illegal, or Dangerous Ramifications ................. 468 C. Legal—Invasive, Opaque, and Suspect ............................. 468 D. Identity Formation Consequences (Reputation, Interpersonal Relationships, Sense of Self) .......................................... 471 E. Benefits .............................................................................. 473 II. CURRENT FEDERAL LEGAL LANDSCAPE ...................................... 474 A. Bedrock Sharenting Legal Framework ............................. 474 B. COPPA .............................................................................. 474 C. Notice & Consent .............................................................. 476 D. FERPA .............................................................................. 478 E. PPRA ................................................................................. 479 F. Non-Federal Privacy Innovation........................................ 480 III. PPLAY ........................................................................................ 481 A. Why PPLAY? .................................................................. -

Susie Alegre Data Daemons: Protecting the Child’S Right to Dream
FREEDOM SECURITY SECURITY PRIVACY FREEDOM The Future of Childhood in the Digital World FREEDOM SECURITY PRIVACY The Future of Childhood in the Digital World Published and distributed by 5Rights Foundation Copyright © 5Rights Foundation, 2020 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, copied or transmitted save with written permission from the publishers or in accordance with the Copyright Designs and Patents Act, 1988. Designed by David Weller and Daniel McGhee Printed by Park Communications Ltd. Original cover photograph by Anchalee Yates 5Rights Foundation Charity number: 1178581 Company number: 11271356 www.5rightsfoundation.com FREEDOM SECURITY PRIVACY The Future of Childhood in the Digital World 9 Introduction ON FREEDOM 18 Susie Alegre Data Daemons: Protecting the Child’s Right to Dream 24 Audrey Tang A Young Democracy is a Strong Democracy: Civil Rights of Taiwan’s Children 30 Kade Crockford A New Digital Divide? Protecting Lower- Income People from Hyper-Digitalisation 36 Dr Towela Nyirenda-Jere A Child is a Child is a Child: Conversations in Africa About Children in the Digital World 42 Baroness Helena Kennedy QC New Freedom? How the Digital Environment Poses Complex Legal Challenges for the Promotion of Children’s Rights 50 Laura Higgins How Fear is Affecting Our Ability to Accept Digital Rights to Play. And Our Common Sense… 56 Farida Shaheed Cultural Rights of Children and Young Adults in the Digital World ON SECURITY 68 Dr Ian Levy On the Need for Software Safety in a Digital World 76 Uri Sadeh Who Are We Afraid Of? 84 RX Radio Our Voices: The Importance of Listening to Young People to Make the Digital Environment a Safe and Inclusive Place 90 H.E. -

Sharenting and the (Potential) Right to Be Forgotten
Indiana Law Journal Volume 95 Issue 3 Article 9 Summer 2020 Sharenting and the (Potential) Right to Be Forgotten Keltie Haley Indiana University, Maurer School of Law, [email protected] Follow this and additional works at: https://www.repository.law.indiana.edu/ilj Part of the First Amendment Commons, Fourteenth Amendment Commons, Law and Society Commons, and the Privacy Law Commons Recommended Citation Haley, Keltie (2020) "Sharenting and the (Potential) Right to Be Forgotten," Indiana Law Journal: Vol. 95 : Iss. 3 , Article 9. Available at: https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol95/iss3/9 This Note is brought to you for free and open access by the Law School Journals at Digital Repository @ Maurer Law. It has been accepted for inclusion in Indiana Law Journal by an authorized editor of Digital Repository @ Maurer Law. For more information, please contact [email protected]. Sharenting and the (Potential) Right to Be Forgotten KELTIE HALEY* INTRODUCTION Social networking sites—like Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube—provide parents with the ability to instantly share information about their children with family and friends across the globe. While most parents are content sharing birthday pictures and humorous anecdotes about their toddlers with a select group of Facebook friends, other parents have capitalized (socially and monetarily) on disclosing information about their children to strangers on the internet.1 Social media accounts dedicated to images, videos, and information about the accountholder’s children are often -
Protecting Children in the Frontier of Surveillance Capitalism
Texas A&M University School of Law Texas A&M Law Scholarship Student Scholarship 2-2021 Protecting Children in the Frontier of Surveillance Capitalism Cole F. Watson Follow this and additional works at: https://scholarship.law.tamu.edu/student-scholarship Part of the Consumer Protection Law Commons, Internet Law Commons, Juvenile Law Commons, Law and Society Commons, and the Science and Technology Law Commons Richmond Journal of Law & Technology Volume XXVII, Issue 2 PROTECTING CHILDREN IN THE FRONTIER OF SURVEILLANCE CAPITALISM Cole F. Watson* Cite as: Cole F. Watson, Protecting Children in the Frontier of Surveillance Capitalism, 27 RICH. J.L. & TECH., no. 2, 2021. * J.D. Candidate, 2021, Texas A&M Univ. School of Law; B.A., 2016, Univ. of Texas at Austin. This paper is dedicated to my soon-to-be-born son: you are fiercely loved. Many thanks to my wife and family for encouraging me through this process. To Ivan Escobar, Josh Jones, Ryan Cairns, and Christian Albuquerque: thank you for your much-needed insights and much-appreciated Bluebook knowledge. To the Richmond JOLT Editorial Staff: your comments and editing skills were invaluable. All errors, omissions, and missed steaks are my own.” 1 Richmond Journal of Law & Technology Volume XXVII, Issue 2 “Come senators, congressmen Please heed the call Don’t stand in the doorway Don’t block up the hall For he that gets hurt Will be he who has stalled There’s a battle outside and it is ragin’ It’ll soon shake your windows and rattle your walls For the times they are a-changin’”1 –Bob Dylan I. -

Whose Information Should Be Shared with Whom?: Parents' Awareness of Children's Digital Privacy in Turkey
Media Literacy and Academic Research | Vol. 3, No. 2, December 2020 photo: Denisa Valachová Derya Gül Ünlü, Oya Morva Whose Information Should Be Shared With Whom?: Parents’ Awareness Of Children’s Digital Privacy In Turkey ABSTRACT Today, parents make use of social media accounts for many different purposes, such as obtaining information, giving advice, receiving support, and exchanging ideas with other parents. In parallel with the use of social media, according to their parenting roles, individuals frequently share various content related to both their own daily practices and the development processes of their children. The fact that most of the content shared is about children raises the question of digital privacy in this context. Based on this focus, this research aims to determine the priorities attached by the parents when they share content about children on their social media accounts, and what kind of measures they take in sharing this content to protect the digital privacy of their children. Therefore, a questionnaire based quantitative field study was carried out within the scope of this research. As a result of the study, it was found that parents primarily prefer sharing special occasions with their children, family photographs and photographs of their children at early ages; if the child is at a later age, they tend to consult him/her before sharing the content, but they do not tend to pay enough attention to ensuring that the child's identity is kept confidential and sharing of personal information is avoided. KEY WORDS Sharenting. Digital parenting. Digital privacy. Studies page 109 Media Literacy and Academic Research | Vol. -
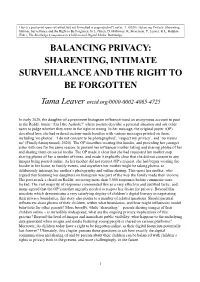
Sharenting, Intimate Surveillance and the Right to Be Forgotten
This is a post-print (peer reviewed, but not formatted or paginated) of Leaver, T. (2020). Balancing Privacy: Sharenting, Intimate Surveillance and the Right to Be Forgotten. In L. Green, D. Holloway, K. Stevenson, T. Leaver, & L. Haddon (Eds.), The Routledge Companion to Children and Digital Media. Routledge. BALANCING PRIVACY: SHARENTING, INTIMATE SURVEILLANCE AND THE RIGHT TO BE FORGOTTEN Tama Leaver orcid.org/0000-0002-4065-4725 In early 2020, the daughter of a prominent Instagram influencer used an anonymous account to post to the Reddit forum ‘Am I the Asshole?’ where posters describe a personal situation and ask other users to judge whether they were in the right or wrong. In her message, the original poster (OP) described how she had ordered custom-made hoodies with various messages printed on them, including ‘no photos’, ‘I do not consent to be photographed’, ‘respect my privacy’, and ‘no means no’ (FinallyAnonymous6, 2020). The OP describes wearing this hoodie, and providing her younger sister with one for the same reason, to prevent her influencer mother taking and sharing photos of her and sharing them on social media. The OP made it clear that she had requested her mother stop sharing photos of her a number of times, and made it explicitly clear that she did not consent to any images being posted online. As her mother did not respect OP’s request, she had begun wearing the hoodie in her home, to family events, and anywhere her mother might be taking photos, to deliberately interrupt her mother’s photography and online sharing. -
SHARENTING DURING COVID-19 PANDEMIC: YAY OR NAY Aima Nabila Muhammad Azhar1*, Anis Shuhaiza Md Salleh2*
Volume 6 Issue 22 (March 2021) PP. 159-167 DOI 10.35631/IJLGC.6220015 INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW, GOVERNMENT AND COMMUNICATION (IJLGC) www.ijlgc.com SHARENTING DURING COVID-19 PANDEMIC: YAY OR NAY Aima Nabila Muhammad Azhar1*, Anis Shuhaiza Md Salleh2* 1 School of Law, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, Malaysia Email: [email protected] 2 School of Law, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, Malaysia Email: [email protected] * Corresponding Author Article Info: Abstract: Article history: In this 21st century, social media has taken over as a dominant form of social Received date: 09.11.2020 interaction and the recent COVID-19 quarantine or ‘stay at home’ during Revised date: 15.11.2020 Movement Control Order (MCO) has left many even more dependent on social Accepted date: 10.12.2020 media to stay in touch with family, friends and the outside world. Many parents Published date: 10.03.2021 are unaware of the risks associated with excessive sharing of detailed information about their children online and that oversharing information about To cite this document: children on social media poses immediate and long-term risks to the children’s Azhar, A. N. M., & Md Salleh, A. S. physical safety, online privacy, and emotional well-being. Thus, it is critical (2021). Sharenting During Covid-19 for parents to understand these risks and realize that their children’s right to Pandemic: Yay or Nay. International privacy and safety supersedes the benefits of sharenting. By using a qualitative Journal of Law, Government and analysis on library-based sources, the objective of this study is to determine Communication, 6 (22), 159-167. -

Communications Law Volume 23 Number 1 2018 Pages 1-54
Communications Law Communications Volume 23 Number 1 2018 Pages 1-54 A User’s Guide to Data Protection Paul Lambert Data protection is a minefield of complex rules and regulations. It is an area of law that impacts on every organisation, large or small, that handles personal data. EDITORIAL A User’s Guide to Data Protection: Law and Policy, Third Edition sets out all the compliance issues that organisations need to be aware of in order to successfully IN BRIEF comply with UK data protection rules and regulations, along with a full assessment of the EU Data Protection Regulations and their impact on UK practice. ARTICLES The work is a first-port-of-call text providing clear guidance through the complex web of data protection issues and regulation, in relation to internal issues affecting Sharenting: balancing the conflicting rights of parents and children employees, agents, contractors, etc. It also addresses external issues concerning Claire Bessant customers, prospective customers and users across all areas of data interface. The third edition has been fully updated and includes coverage and analysis of: Are children more than ‘clickbait’ in the 21st century? • The General Data Protection Regulations (GDPR) to be implemented by May 2018 Baroness Beeban Kidron • Coverage of the new UK Data Protection Bill • Latest Information Commissioner Office investigations, reports and guidance, office Interpreting the child-related provisions of the GDPR cases, complaint decisions and penalties • Brexit negotiation issues and post-Brexit data protection